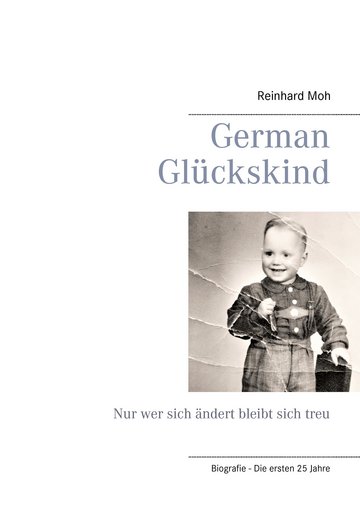Meine erste Heimat
Meine Kindheitserinnerungen sind eng verbunden mit meiner Oma und Uroma, genannt „Mohnoma“. Die hatte ein kleines Hexenhaus, das ich später als junger Erwachsener noch einmal sehen durfte. Genau wie die Mauer vor dem Bauernhof war für mich als kleiner Steppke alles riesig und groß. Die Oma bekam ihren Spitznamen, weil sie am Wochenende immer einen Mohnkuchen buk, aber auch ihre Mohnknödel waren ein Traum. Ob wir dadurch damals alle wöchentlich ein- oder zweimal high wurden, weiß ich nicht mehr. Jetzt bin ich 67, da ist noch nicht alles vorbei, und habe drei Generationen meiner Familie miterlebt. Das war mir früher nie so bewusst, und heute empfinde ich es als Privileg, viele erlebt zu haben. Glück gehabt.
Wann, wie und warum ich als kleines Kind, und mit wie viel Jahren eigentlich genau, aus Heidelberg im Westen in die Deutsche Demokratische Republik im Osten gekommen bin, weiß keiner mehr so genau. Die, die es wissen könnten, sind leider schon gestorben. Das ist also nicht mehr zu klären. Da wir zu der Zeit vier Kinder waren, war wohl einer zu viel an Bord, und meine Eltern konnten wohl noch nicht alle sattkriegen. Oder hatte ich damals schon gesundheitliche Probleme? Gekränkelt habe ich ja meistens, auch heute noch. Im Rückblick kommt mir die Tatsache, dass ich so früh zu meinen Großeltern kam, schon etwas seltsam vor. Der tatsächliche Grund lässt sich heute auch nicht mehr mit Bestimmtheit sagen, da meine Eltern und meine Oma nicht mehr leben, und Zeitzeugen wie meine Schwester Irmtraud sich nicht daran erinnern können. Es ist aber naheliegend, dass, wie auch heute bei vielen Familien, wirtschaftliche Gründe eine Rolle gespielt haben. Damit wäre ich dann wohl einer der ersten Wirtschaftsflüchtlinge, die vom Westen in den Osten rüber machten, obwohl die Flucht in die andere Richtung damals sicher deutlich häufiger vorkam.
Irgendwann befand ich mich dann in Meltewitz Nr. 2, Kreis Wurzen nah bei Leipzig, auf dem Bauernhof der Familie Wünsche, die meine Großeltern nach dem Krieg aufgenommen hatte. Ernst und Edith Wünsche waren herzensgute Menschen. Sie hatten zudem noch eine Tochter namens Heidrun, ein Jahr älter als ich, und damit war meine Kindheit eigentlich vollkommen.
Beide waren wir Glückskinder, da uns nichts und niemand etwas anhaben konnte und wir eine tolle Kindheit hatten, die ich heute jedem Kind auf dieser Welt von ganzem Herzen wünsche. Hier war man sicher für einige Jahre.
Meine erste Familie lebte auf einem Vierkanthof. Das waren die Wünsches mit Heidrun und die Jopkes mit mir. Meines Opas Vorname war Ernst, ein Jahrhundertmann mit zwei dieser unsäglichen Weltkriege im Gepäck, die er als Bürde mit sich herumtrug. Er sprach wenig mit mir, heute verstehe ich das. Im Gedächtnis bleibt, dass er grauschwarze Haare hatte, und jeden Morgen sah ich ihn rasierend vorm Spiegel stehen. Er trug Hosen mit Hosenträgern, die aber locker an den Seiten hingen und erst später, nach dem ersten Kaffee, umgelegt wurden. Ich glaube, er musste sehr hart auf dem Feld arbeiten, genau wie meine Oma, denn das war die Gegenleistung für die Bleibe, Speis und Trank auf dem Hof. Sie gehörten jetzt zur Familie, und ich war glücklicherweise mittendrin. Als mein Opa starb, war mir noch nicht bewusst, dass zum Leben auch das Sterben gehört. Das wurde mir zum ersten Mal später, als ich mit 18 Jahren zur Bundeswehr kam, richtig klar, und spätestens da war „Schluss mit lustig“.
Eines der starken Bilder der Erinnerung ist der große Turm in Leipzig, den man immer bei „In aller Freundschaft“, einer Arztserie aus dem Fernsehen, sieht. Dieses Bild, das sich wie ein Wahrzeichen in mir festgesetzt hat, als ich es als Kind zum ersten Mal sah, löst jetzt jeden Dienstagabend ein starkes Gefühl von Heimat in mir aus.
Die Bilder, die ich von meiner Oma in Erinnerung habe, sind stark und immer allgegenwärtig. Meine Oma, Jahrgang 1900, gehörte zu den 1,2 Millionen Schlesiern, die nach Ende des Zweiten Weltkrieges flüchten mussten. Da regen wir uns heute über ein paar tausend Flüchtlinge in der Woche auf. Damals haben die Deutschen das auch geschafft, aber die Flüchtlinge hatten es am Anfang genauso schwer wie heute, und erst Jahre später gab sich das dann.
Ihr Vorname war Emma, heute hören wieder viele Mädchen auf diesen Namen. Sie hatte den gleichen Geburtsnamen wie der Nachname meiner Mutter nach ihrer Heirat und war aber auch gleichzeitig die Mutter meiner Mutter. Das wusste ich aber damals noch nicht. Emma Jopke, geborene Moh, das fand ich immer witzig. Ich habe es leider immer versäumt herauszufinden, wer aus welcher Linie stammt.
Meine Großmutter, deren Reisepass aus der DDR mit der Nummer 1750408 ich heute noch immer besitze, war mittelgroß und hatte hell leuchtend graue Haare, die sie streng zurückgekämmt trug. Ihre blaugrauen Augen strahlten Stärke und Zuversicht aus, und ihr Herz und ihre Güte waren größer, höher und breiter als der höchste Berg der DDR, der Brocken. Eine wertvolle Brosche hielt ihre Bluse zusammen und für mich sah es so aus, als ob das ein Zeichen von Ordnung signalisieren sollte und ich sicher sein konnte, dass in ihrer Nähe mein Leben nicht in Unordnung geraten könne.
Meine geliebte Oma Emma Jopke
Es gab nur einmal ein Ereignis, wo ich so richtig den Arsch versohlt bekommen habe. Womit? Mit Recht! Was war passiert? Ich ging, obwohl es verboten war, auf das Eis des noch nicht ganz zugefrorenen Dorfteiches, bin eingebrochen und wurde gerade noch so mit langen Stangen, an die ich mich klammern konnte, gerettet. Wer kennt das nicht? „Habe ich doch nicht mit Absicht gemacht“, muss ich wohl unter den Tränen der Tracht Prügel gemurmelt haben. Heute noch träume ich, dass ich auf dünnem Eis einbreche, und anstatt mich sofort auf den Bauch zu legen, laufe ich zur Mitte, und hinter mir bricht das Eis immer weiter, wie im Film. Während meiner Hatz zur Mitte, wo das Eis ja dicker sein musste, wache ich immer auf. Heute verstehe ich, wenn jemand zu einer anderen Person sagt: „Ganz dünnes Eis“.
Zu den starken Bildern gehört natürlich noch die Familie Wünsche, der Bauernhof, der Ort Meltewitz, die vielen Tiere und die weiten Felder. Die waren bunt, manchmal gelb vom Weizen, und die Ähren sahen aus wie geflochtene Mädchenzöpfe. Es gab auch Felder mit Wildblumen, die so bunt waren, als ob hunderte von Künstlern diese Landschaft im Frühjahr bis zum Sommer gemeinsam gemalt hätten. Die Düfte und das Friedliche der Natur sind unvergessen. Das alles hat sich fest und unauslöschlich in mir eingebrannt.
Später, als ich wieder zurück zu meiner Familie im Westen kam, sind wir immer als Kinder in den Sommerferien zu meiner Oma gefahren und verbrachten eine unbeschwerte Zeit. Meine Mutter begleitete uns allein, da mein Vater ja als Berufssoldat nicht in die DDR einreisen durfte.
Der Alltag allein mit meiner Oma, Opa starb irgendwann, war ein Traum. Das Leben auf dem Bauernhof war jeden Tag spannend, und Emma passte auf mich auf, damit mich auch ja kein Fuchs stehlen konnte, so wie er das oft bei unseren Hühnern machte. Einmal in der Woche, meist freitags, wurde geschlachtet, Frettchen wurden gejagt und ich half mit, das Heu einzufahren. Jeden Nachmittag gab es Tee aus einer Emaille- oder Blechkanne. Zum Tee gab es immer so dicke „Bemmen“, also ein Butterbrot mit grober Leberwurst. Lecker. Da steh ich heute noch drauf, aber dieser besondere Geschmack des Brotes und der Wurst kam später nicht mehr zurück. Mit Heidrun hatte ich schon meine erste Freundin und das schon als Kind. Wenn das mal kein Omen sein sollte für mein späteres Leben.
Das Schlachten im Hof war als Kind immer ein Erlebnis, aber wenn Opa Wünsche den Bolzen an das Gehirn des Schweines hielt, um es zu betäuben, mussten wir Kinder kurz den Hof verlassen. Wir sollten halt nicht sehen, wie Ernst Wünsche den anschließenden Kehlenschnitt ausführte. Später erklärte man Heidrun und mir, dass das Tier ausblutet und den Schnitt nicht mehr spürt. Das Schlachten mit den frischen warmen Würsten habe ich heute noch fest gespeichert und obwohl ich weiß, was drin ist und wie ungesund es sein soll, esse ich heute noch mit Vorliebe Wurst und vieles, was ein Metzger so für uns bereithält, wenn man Glück hat, einen in seiner Nähe zu haben. Vegetarier gab es nicht in der DDR und auf dem Dorf schon gar nicht, denn Mangelwirtschaft war ein Fremdwort in der verschworenen Dorfgemeinschaft.
Hunger kannte ich also nicht, und ein Höhepunkt für uns Kinder in dieser Zeit, aber auch später, war das mehrmalige Klingeln des Eismannes. Der hielt mit seinem Wagen mit drei Rädern, das eine vorne, die anderen beiden hinten, direkt vor unserem Hoftor. Das vordere Rad war für sein Fahrrad und die hinteren zwei waren mit dem Eiswagen verbunden, der wie ein Kasten aussah und auf dem in großen roten Buchstaben das Wort „Eis“ von Hand aufgemalt war. Drei Deckel aus porzellanähnlichem Material verbargen die einzige Süßigkeit, die wir so hatten oder an die ich mich noch erinnern kann. Und immer, wenn das Klingeln zu hören war,...