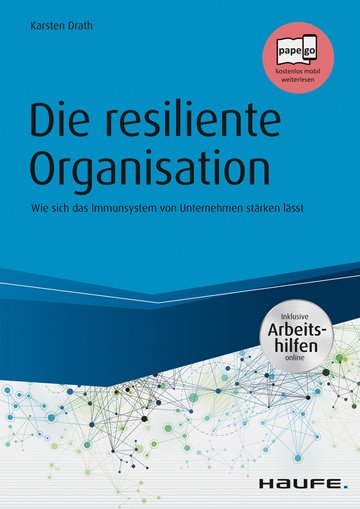Warum dieses Buch?
„Das Leben kann nur im Rückblick verstanden,
aber nur mit dem Blick voraus gelebt werden.“
(Søren Kierkegaard, dänischer Philosoph und Theologe, 1813 bis 1855)
Doch warum noch ein Buch über Resilienz? Das Thema „Umgang mit Krisen und Rückschlägen“ interessiert mich seit jeher, und das hat, wie so oft, auch bei mir persönliche Gründe, die ich Ihnen gerne schildern möchte. Als ich aufwuchs, waren viele Dinge in meiner Familie in Ordnung und einige waren es nicht, genau wie das bei vielen anderen Jugendlichen auch heute der Fall ist. Als Kind hatte ich immer irgendwie gespürt, dass ich gewollt und geliebt wurde, aber es gab über viele Jahre einfach zu viel Alkohol und Betablocker zu Hause. Dies schuf ein Umfeld von Sucht und Co-Abhängigkeit – und ich war Teil davon, ohne es zu verstehen. Als Familie erschufen wir eine Fassade, die wir der Außenwelt präsentierten. Dazu gehörte auch, dass ich keine Freunde mit nach Hause brachte. Über die wirklich wichtigen Dinge wie Emotionen sprachen wir nicht. Als Kind passte ich mich an und fand das auch nicht ungewöhnlich. Ich hatte ja keine Vergleiche. Wenn zu Hause alles fragil und zerbrechlich ist, sind Kinder meist nicht sehr rebellisch. Sie spüren, dass die eigenen Eltern einfach keine Kapazität mehr haben, um mit irgendwelchen weiteren Schwierigkeiten fertig zu werden. Zumindest war das bei mir der Fall.
Einige Wochen waren schlimmer als andere. Ich erinnere mich an mindestens drei Situationen, in denen meine Mutter wegen akuter Vergiftung vom Notarzt ins Krankenhaus gebracht wurde. Einmal sogar, als ich gerade mitten im Abitur steckte. Selbst wenn ich mich an so etwas vermeintlich gewöhnt hatte, war das keine schöne Situation für mich. Jegliche Versuche, über Sucht zu sprechen und einen Verbündeten in meinem Vater zu finden, blieben erfolglos. Natürlich hat mich dieses Klima von Sucht und Schweigen nachhaltig geprägt. Ich hatte so gut wie kein Selbstbewusstsein, war oft depressiv, und es wäre wahrscheinlich ein Leichtes gewesen, ein paar falsche Entscheidungen zu treffen. Es gab jedoch einige zentrale Ereignisse, die mir geholfen haben, einen guten Weg für mich selbst zu finden.
Über einen Schulfreund erfuhr ich von einer Organisation namens zis, einer gemeinnützigen Organisation, die vor inzwischen mehr als 60 Jahren gegründet wurde und auch heute noch existiert. Seit 1956 vergibt zis Studienreisestipendien an junge Menschen zwischen 16 und 20 Jahren. Man bewirbt sich mit einem Land und einem Studienthema, das einen interessiert. Schulnoten spielten bei der Vergabe damals wie heute keine Rolle, was gut für mich war. Wurde das Projekt akzeptiert, erhielt man damals umgerechnet etwa 325 Euro (650 DM zu dieser Zeit) als Stipendium. Heutzutage gibt es luxuriöse 600 Euro, doch wie damals darf man immer noch kein eigenes Geld mitnehmen, muss alleine reisen und mindestens vier Wochen im Ausland bleiben. Darüber hinaus muss man eine Abschlussarbeit zur Studienreise verfassen und Tagebuch führen, um seine Erlebnisse, Gedanken und Emotionen festzuhalten. Die gesamte Idee geht auf den französischen Architekten Jean Walter zurück. 1899 radelte dieser um die 6.000 Kilometer von Paris nach Istanbul und retour, nur weil er die Hagia Sophia sehen wollte. Da er nicht viel Geld hatte, verdiente er sich seinen Lebensunterhalt unterwegs mit Trompetespielen auf der Straße. Er erlebte diese Reise als ein sehr schwieriges, aber auch äußerst aufregendes Unterfangen, das seine Perspektive auf das Leben nachhaltig verändern sollte. Ungefähr 40 Jahre später, inzwischen war er erfolgreich und wohlhabend, gründete Walter eine Organisation, die jungen Menschen Reisestipendien gewährte, um ihnen die Möglichkeit zu geben, ein ähnliches Abenteuer zu erleben. Etwa zehn Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war diese Idee Inspiration für die Gründung der Organisation zis an der Schule Schloss Salem. Verantwortlich dafür zeichnete Marina Ewald, eine Lehrerin an der renommierten Privatschule am Bodensee, die in der Anfangsphase die Stipendien aus eigener Tasche finanzierte.
Meine erste zis-Reise habe ich mit 17 Jahren zum Thema „Fischerei an der Westküste Schottlands“ unternommen. Ich mochte eigentlich keinen Fisch, wollte aber unbedingt die tolle Küstenlandschaft mit ihren Fjorden sehen. Um mit dem Geld auszukommen, bin ich mit dem Fahrrad gereist und habe insgesamt rund 1.700 Kilometer zurückgelegt. Ich hatte unterwegs keinen einzigen platten Reifen; allerdings brach mir bei Inverness die Hinterachse. Eine Woche lebte und arbeitete ich mit Fischern im Küstenort Mallaig, was enorm spannend war. Für dieses Projekt wurde ich mit einem zweiten zis-Stipendium ausgezeichnet. Diesmal beschloß ich, nach Island aufzubrechen, um dort das wissenschaftliche Walfangprogramm zu studieren. Das war zu dieser Zeit ein sehr politisches und emotionales Thema. Für diese Reise bekam ich 400 Euro pro Monat. Es gab jedoch ein kleines Problem: Man kommt mit 400 Euro nicht nach Island, auch damals vor nunmehr 30 Jahren nicht. Das einzige, was dieses Unterfangen weniger aussichtlos aussehen ließ, war ein Empfehlungsschreiben von der UNESCO. Mit diesem gerüstet kontaktierte ich die isländische Botschaft und bat sie darum, mich idealerweise kostenlos nach Island zu bringen. Ich wurde natürlich abgewimmelt. Also rief ich wieder an und das Spiel wiederholte sich einige Wochen. Doch ich ließ nicht locker. Schließlich ließ man mir ausrichten, ich könne in zwei Tagen an Bord eines Trawlers gehen, der Bremerhaven mit Kurs auf Reykjavik verlassen würde. Man vergaß nicht hinzuzufügen, dass ich bitte nicht mehr anrufen solle. Also fuhr ich zwei Tage später Richtung Norden, um ein ziemlich rostiges Fangschiff zu besteigen. Als wir abgelegt hatten, wurde das Wetter sehr unangenehm. Drei ganze Tage war ich seekrank, bis wir schließlich die Hauptstadt von Island erreichten. Als wir angekommen waren, lebte ich noch einige Tage im Hafen von Reykjavik auf dem Trawler. Das lag einerseits an dem kalten Wetter, da es im Mai noch schneite und ich das Geld für ein Hostel nicht hatte. Der eigentliche Grund war jedoch, dass mich die Einwanderungsbehörde abschieben wollte, weil ich nicht genug Geld dabeihatte, um meine Heimreise zu bezahlen. Vorschrift ist Vorschrift, auch in Island. Zu dieser Zeit sah ich zudem aus wie ein typischer Aktivist von Greenpeace oder Sea Shepherd, einer militanten Abspaltung der Ökoaktivisten. Im Jahr zuvor hatten diese im Hafen von Reykjavik zwei Walfangschiffe mit Haftminen versenkt und die zentrale Walfangstation sabotiert, was der Walfangindustrie Schäden in Millionenhöhe zugefügt hatte. Um alles noch schlimmer zu machen, reiste just zu dieser Zeit der Papst in Island und ich wurde als potenzielles Sicherheitsrisiko angesehen. Das Einzige, was mich davor bewahren konnte, abgeschoben zu werden, war ein Einladungsschreiben, das mir das Ministerium für Fischerei während der Vorbereitung dieser Reise geschickt hatte. Allerdings lag dieser rettende Brief 3.000 Kilometer entfernt bei mir zu Hause. An sich ja kein Problem, sagen Sie? Damals schon, denn all dies ereignete sich zu einer...