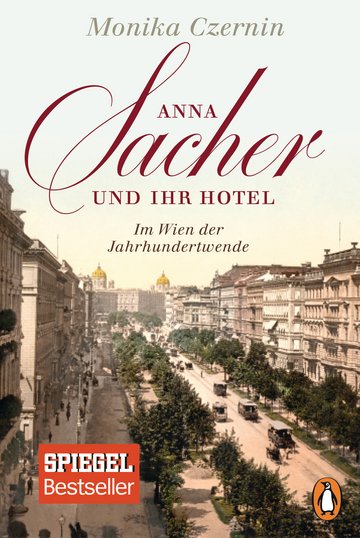Einleitung
Leute, die damals noch nicht gelebt haben, werden es nicht
glauben wollen, aber schon damals bewegte sich die Zeit so
schnell wie ein Reitkamel. (…) Man wusste bloß nicht wohin.
Robert Musil: Der Mann ohne Eigenschaften (1930)
Das Bild zeigt eine Frau in den besten Jahren, sie trägt ein weißes, spitzenbesetztes Kleid, das hübsche Gesicht in die Hand gestützt, die zu Locken getürmten Haare von einem Hut mit Straußenfedern gebändigt. Zwei französische Zwergbulldoggen sitzen auf ihrem Schoß wie bei anderen Leuten Kinder in Matrosenanzügen. Ihr Mund verrät Willenskraft. Klug und skeptisch blickt die Porträtierte den Betrachter an, fast unangenehm ist dieser Blick, der sein Gegenüber präzise taxiert, dem nichts entgeht. Hier ist eine Frau, der man kein X für ein U vormachen kann.
Es ist die wohl berühmteste Fotografie der Anna Sacher. Die legendäre Hotelbesitzerin wusste sich selbstbewusst in Szene zu setzen und in den bodenständigen Satz zu kleiden: »Das Sacher, das bin ich und sonst niemand.« Die Fotografie drückt genau das aus und inszeniert gleichzeitig den Charme und Witz, den diese Kultfigur des Wiener Fin de Siècle gehabt haben muss. Die Fotografin des raffinierten Porträts war eine nicht minder bekannte Dame: Dora Kallmus, genannt Madame d’Ora. So hieß auch ihr Fotostudio, das sie 1907 im ersten Wiener Gemeindebezirk eröffnet hatte. Anna Sacher kannte die junge Frau. Ihr Vater Philipp Kallmus entstammte einer jüdischen Familie aus Prag, er hatte als Hof- und Gerichtsadvokat Karriere gemacht wie so viele Juden der Gründerzeit, die aus den k. u. k. Ländern in die Hauptstadt des Kaiserreiches gezogen waren, zuerst aus Böhmen, Mähren und vor allem Ungarn, später dann auf der Flucht vor den antisemitischen Ausschreitungen in Galizien oder vor der Armut der Schtetl. Philipp Kallmus war schon in den Jahren, als Annas Ehemann Eduard noch lebte, ein gern gesehener Gast im Sacher gewesen, auch wenn sich das seltsam verloren hat in den Geschichten über das Hotel. Und so wird er wohl eines Tages auch seine Tochter der zwanzig Jahre älteren Chefin des Hauses vorgestellt haben. Die d’Ora und die Sacher gehörten zu jenen Frauen der Zeit, die wie selbstverständlich emanzipiert waren, sie hatten ungewöhnliche Karrieren gemacht, und zwar in einem gesellschaftlichen Umfeld, das Frauen derartige Positionen und eine derartige Selbstständigkeit erst allmählich zugestehen wird.
Mit ihrer Fotografie hat Madame d’Ora an der Legende der Anna Sacher mitgewirkt. Die Bullys der Frau Sacher waren fast so berühmt wie die Sachertorte, mit der die ganze Geschichte noch vor der bürgerlichen Revolution von 1848 im Wiener Biedermeier ihren Anfang nahm. Die Hündchen fügten sich geschmeidig zu den zahlreichen Anekdoten über Erzherzöge und andere meist aristokratische Gäste, die sich in den Salons und Separees des Hotels tummelten und die Gerüchtebörse der Stadt mit allerlei Pikanterien zu füttern wussten. Der bloß mit einem Säbel bekleidete Erzherzog Otto, der stets in Husarenuniform auftretende Dauergast Nikolaus Szemere samt illustrer Runde, der nackte Kronprinz höchstpersönlich mit König Milan von Serbien und Eduard Sacher im Praterteich und so weiter und so fort. Das Sacher war immer mehr als ein Hotel: Es war einer der Mittelpunkte der Wiener Gesellschaft, ein Dreh- und Angelpunkt der großen Epoche vor dem Ersten Weltkrieg und der bitteren Zeit nach dieser Urkatastrophe, einer Zeit, die heute von Historikern gern als ein Kontinuum, als »lange Jahrhundertwende« (von 1880–1930) bezeichnet und gedeutet wird.
Bis heute hängt die Fotografie der Anna Sacher im Gang von der Hotellobby zum Restaurant »Anna Sacher«. Vor dem Hotel halten Fiaker, Menschen eilen in die Staatsoper, der k. u. k. Hoflieferant Jungmann & Neffe lässt krachend die Rollläden herunter, ein paar Herren, sehr elegant und aus der Zeit gefallen, betreten das Hotel. Im Raum lesen wir die Zeit: Nirgends gilt das so sehr wie in Wien. Hier lärmt nicht nur das Heute, sondern auch das Gestern, und so muss man nicht viel tun, um die Zeit hundertfünfzig Jahre zurückzudrehen und sich die Geräuschkulisse vorzustellen, als die Ringstraße – damals noch die größte Baustelle Europas – von Kaiser Franz Josef feierlich eröffnet wurde. Statt Autos rumpelten Fiaker und Equipagen über das Stöckelpflaster, was für großen Lärm sorgte, und aus dem Stimmengewirr der Menschen hörte man neben Deutsch und Französisch die unzähligen Sprachen des Habsburgischen Vielvölkerstaates heraus.
Was für eine Zeit! Die Gründerzeit, die Ringstraßenepoche, die Zeit des Liberalismus! Alles wandelte sich damals – Technik, Städte, Verkehrswesen, Wissenschaft und der Alltag der Menschen. Alles war auf Veränderung programmiert, auf Bewegung, ja Beschleunigung. Kapitalismus und freie Marktwirtschaft feierten einen Sieg nach dem anderen, schufen aber auch eine Ungleichheit, deren soziale Sprengkraft von den oberen Zehntausend unterschätzt wurde. Wenn man heute die Ringstraße entlanggeht, kann man diesen Geist noch spüren, man muss nur den Blick über die prunkvollen Fassaden gleiten und sich die Geschichten der Gebäude und des Lebens, das sich hinter ihren Mauern abgespielt hat, erzählen lassen.
Dreißig Jahre später dann, um die Jahrhundertwende, war Wien mit seinen fast zwei Millionen Einwohnern zu einer der größten Städte der Welt geworden, eine nervöse Metropole, eine Stadt der Millionäre und der Obdachlosen, eine Hochburg der Künste und Wissenschaften, das Mekka der modernen Medizin, Ökonomie, der Rechtswissenschaften und der Chemie. Überall nur Superlative. Es kam zu einer wahren Explosion des Schöpferischen. Die Künstler des Fin de Siècle sind weltberühmt: Gustav Klimt, eine Generation später Egon Schiele und Oskar Kokoschka. Auch in der Musik geschah Bahnbrechendes – vor allem durch Gustav Mahler und Arnold Schönberg. Und in den Cafés der Stadt traten sich die Literaten auf die Füße und schufen Werke voller Zeitlosigkeit. Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Stefan Zweig, Karl Kraus, Hermann Broch und Felix Salten. Und natürlich Sigmund Freud, dessen Analyse der Seele das Selbstbild des Menschen und den Blick auf die Kultur unwiderruflich verändern sollte. Er bat seine Patientinnen auf die Couch und entließ sie als krönenden Abschluss womöglich auf einen nervenberuhigenden Tee in den Damensalon des Sacher.
Im gesellschaftlichen Leben der späten Habsburgermonarchie gaben seit Jahrhunderten der Hof und die Aristokratie den Ton an, die Erzherzöge, die Metternichs, Kinskys, Schwarzenbergs, Wilczeks und Hohenlohes. Sie achteten auf soziale Distinktion und durch die Etikette gezogene Schranken. Jene sogenannte erste Gesellschaft mischte sich mit niemandem, schon gar nicht mit den gesellschaftlichen Aufsteigern der zweiten Gesellschaft, wie man im hierarchieverliebten Wien zu den höheren Beamten und zum Großbürgertum zu sagen pflegte. Das waren vor allem die jüdischen Großhändler, die Fabrikanten und Bankiers. Und dennoch: Auch der alte Adel wusste, dass, wer seine Stellung behaupten und nicht nur auf seinen Landgütern mächtig sein wollte, mit der neuen Zeit gehen musste, mit der Industrialisierung, dem Welthandel, der Börse. Keine andere gesellschaftliche Gruppe prägte die Gründerzeit und Jahrhundertwende so stark wie das jüdische Großbürgertum, das sich durch die Gleichstellung der Juden im Laufe des 19. Jahrhunderts gebildet hatte. Über die Hälfte der Wiener Millionäre waren jüdischer Herkunft, in Deutschland waren es hingegen nur sechzehn und in England nur zwei Prozent. Sie alle, die Rothschilds, Ephrussis, Todescos, Königswarters, Liebens, Schey von Koromlas, Epsteins oder Gutmanns hatten ihre Palais im eleganten vierten Bezirk oder auf der Ringstraße – in unmittelbarer Nähe des Sacher also, das sich hinter der neuen Hofoper direkt am Ringstraßenkorso befand. Und so kann es eigentlich gar nicht sein, dass diese meist nur in ein bis zwei Generationen zu Reichtum und wirtschaftlichem Einfluss gelangten Großbürger nicht im Sacher verkehrten, nur weil fast niemand von ihnen in der berühmten Bildergalerie der Anna Sacher hängt oder das berühmte Gästetischtuch der Anna Sacher vor allem ein Who’s who des europäischen Adels ist. Und wenn sie doch alle im Sacher gewesen sind, wieso tauchen sie dann so selten in den Geschichten und Büchern über das Hotel auf? Und was sagt uns diese Lücke über die damalige Zeit?
Als Anna Sacher 1930 starb, schwelgten die Zeitungen in Habsburg- und Monarchie-Nostalgie und zementierten so das Klischee vom Sacher als jenem Ort, an dem Aristokraten und Erzherzöge ein- und ausgingen, als dem Ort, an dem die Hofgesellschaft zu speisen geruhte, wenn sie bei Hofe nicht satt geworden war. Das Sacher galt als Hort jener oberflächlichen und verschwendungssüchtigen Adligen, die, wie Hermann Broch befand, längst »die Flucht ins Unpolitische« angetreten hatten und im »flüchtigsten Lebensgenuss« – dem saisonalen Auf und Ab von Jagden, Bällen und Pferderennen – ihr soziales Überleben zu finden glaubten. Und so lautete denn auch der Tenor aller Geschichten und Artikel, die ich über das Sacher gehört und gelesen hatte. »Es ist das Hotel zum alten Österreich«, schrieb etwa das Wiener Journal zum Tod Anna Sachers. »Denn hier ging aus und ein, was zu den Notabilitäten der österreichisch-ungarischen Monarchie gehörte. In den Speisesälen ließen sich österreichische Erzherzöge blicken, ungarische Magnaten aßen hier das berühmte Wiener Beinfleisch, tranken alte Bordeauxweine, Grafen und Barone machten die Honneurs und ließen sie sich machen.« Manche der Herren hatten es zu nichts gebracht außer...