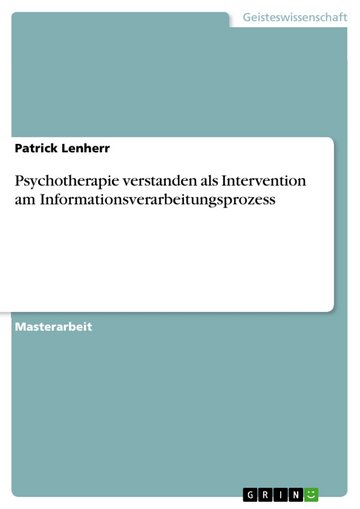Psychotherapie ist ein ausgesprochen komplexer Handlungsprozess, der sich das Ziel setzt, „handlungsorientierte Strategien zur Beeinflussung von Erleben und Ver-halten“ zu entwickeln, welche dazu dienen, „psychisch bedingte oder mitbedingte Krankheiten oder Verarbeitungsstörungen [...] zu beseitigen oder zu mildern“ (Senf & Broda 2012, S. 2f.) bzw. vorzubeugen. Diese schwierige Aufgabe verlangt nach einem „Konzept der psychotherapeutischen Grundorientierung“, das in der Lage ist, „bei allen Problemen, Krankheiten und Störungen und bei allen Persönlichkeitstypen von Patienten gleich wirksam zu sein.“ (ebd., S. 3f.). Die starren, schulorientierten Sichtweisen erfüllen diesen Anspruch nicht. Es braucht stattdessen ein integratives Theoriekonzept mit übergeordneten, d.h. schulübergreifenden theoretischen Hinter-grundannahmen, um den beschriebenen Anforderungen gerecht zu werden.
Ein solches psychotherapeutisches Konzept ist ohne grundlagenwissenschaftliche Erkenntnisse der Psychologie schwer denkbar. Erst die genaue psychologische Er-kundung des Erlebens und Verhaltens macht es möglich, therapeutische Verände-rungsprozesse einzuleiten. In jede psychotherapeutische Tätigkeit fliesst demnach allgemeinpsychologisches Wissen ein, das die Basis für Strategien der Veränderung ausmacht. Auf diese Weise können überzeugende Antworten auf die zwei zentralen Fragen der Psychotherapie gegeben werden:
- Wie kommt menschliches Erleben und Verhalten zustande? (= Psychologie als Grundlagendisziplin)
- Wie und unter welchen Umständen erfolgen Anpassungs- und Veränderungspro-zesse bzw. wie können diese eingeleitet werden? (= Psychotherapie als Anwen-dungswissenschaft)
Es wird sich zeigen, dass unter Berücksichtigung allgemeinpsychologischer Theorien viele verschiedene Möglichkeiten und Ansatzpunkte für eine Veränderung bestehen. Dadurch wird klar, dass „zur Indikation psychotherapeutischer Massnahmen die Aus-gangslage und die Zielvorgaben der Patienten relevant sind und nicht ideologisch eingefärbte Überzeugungen, die systematisch einzelne Forschungsergebnisse aus-blenden.“ (Kämmerer 2012, S. 78). Anstelle eines Denkens und Handelns unter dog-matischen Gesichtspunkten treten allgemeine Leitlinien, welche ein professionelles sowie verantwortungsvolles Arbeiten ermöglichen und zur Erfüllung des psychothera-peutischen Auftrags beitragen.
Wie kommt menschliches Erleben und Verhalten zustande?
Um „handlungsorientierte Strategien zur Beeinflussung von Erleben und Verhalten“ (Senf & Broda 2012, S. 2) zu entwickeln, ist ein tiefes und breites Verständnis vom Menschen erforderlich. Mit dieser Thematik haben sich sowohl die Psychologie als auch die Psychotherapie seit jeher auseinandergesetzt (vgl. Kriz 2007), wobei die Vielfalt der Lösungsansätze verdeutlicht, wie komplex der Untersuchungsgegenstand Mensch ist. Die unterschiedlichen Ansätze sind v.a. auf die dahinterliegenden Para-digmen zurückzuführen. Jedes Paradigma legt einen bestimmten Standpunkt und damit verbunden eine spezifische Sichtweise fest. Dies gleicht der berühmten Para-bel von den Blinden, die einen Elefanten abtasten und je nach Tastgegenstand (Bein, Zahn, Ohr, usw.) zu ganz verschiedenen Befunden gelangen. Die erste Hürde einer Grundlagentheorie besteht also darin, ein Paradigma zu schaffen, das einen übergeordneten Standpunkt erlaubt. Die Idee vom Menschen als selbstorganisieren-dem System[1] (vgl. Haken & Schiepek 2006; Schiepek 2006; Kriz 2004, 2008) scheint diese Anforderung zu erfüllen.
In Bezug auf selbstorganisierende Systeme kann man von einer Beziehung zwischen einem Organismus und seiner Umwelt[2] sprechen. Diese Beziehung ist wesentlich durch Wechselwirkungen gekennzeichnet. Der Mensch will und muss sich in der Welt zurechtfinden. Wir erkunden, entdecken und gestalten die Welt. Wir verändern die Welt, die Welt verändert uns. Menschliche Entwicklung ist im Wesentlichen auf diesen Austausch zurückzuführen.
Experimente mit sensorischer Deprivation (Hebb 1973) zeigen die Bedeutung der Person-Umwelt-Interaktion aus psychologischer Sicht. Werden einem Menschen über längere Zeit die sensorischen Reize (optische, akustische, gustatorische, taktile Wahrnehmung) entzogen, indem man sie absoluter Dunkelheit und Einsamkeit aus-setzt, führt dies zu Wahrnehmungsstörungen in Form von Halluzinationen bis hin zu schweren Psychosen und Panikattacken. Die Untersuchungen von Donald Hebb zeigten, dass das menschliche Gehirn auf eine ständige Reizzufuhr angewiesen ist, um zu funktionieren, ansonsten kommt es zu degenerativen Prozessen.
Wenn man das menschliche Erleben und Verhalten als ein Zusammenspiel zwischen dem Individuum und seiner Umwelt betrachtet, ist es hilfreich, die Vorstellung eines Informationsaustausches zu verwenden, wie eine Analogie von Watzlawick et al. (1969) zeigt: Wenn man beim Gehen gegen einen Stein tritt, wird Energie vom Fuss auf den Stein übertragen und der Stein wird dadurch ins Rollen gebracht. Schliess-lich bleibt er an einer Stelle liegen, die durch die übertragene Energiemenge, die Form und das Gewicht des Steins, die aktuellen Windverhältnisse usw. vollkommen determiniert ist. Wenn man im Gegensatz dazu einen Hund tritt, könnte dieser auf-heulen und zubeissen. In diesem Fall wäre die Beziehung zwischen dem Tritt und dem Biss eine grundlegend andere, denn zweifelsohne würde sich der Hund der Energie seines eigenen Körperhaushalts und nicht der des Tritts bedienen. Hier wird demnach nicht mehr Energie, sondern Information übertragen. Mit anderen Worten, „der Tritt wäre eine Verhaltensform, die dem Hund etwas mitteilt, und der Hund reagiert darauf mit einer entsprechenden anderen Verhaltensform.“ (ebd., S. 30). Diese Begriffsverschiebung von „Energie“, wie sie in der klassischen Psychoanalyse verwendet wurde, hin zu „Information“, wie sie in der Synergetik[3] verwendet wird, führt dazu, dass der Prozess der Informationsverarbeitung fundamental aufgewertet wird. Das Gehirn wird dabei als Informationsverarbeitungsorgan betrachtet. Unter diesem Gesichtspunkt geht die Psychologie davon aus, „dass die Verhaltensäusse-rungen und das Erleben Resultate dieser Informationsverarbeitung sind.“ (Bösel 2006, S. 9).
Für die Psychologie als die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten eröffnet dieser Ansatz viele neue Erklärungsansätze. Wie fruchtbar dieses Paradigma der Informa-tionsverarbeitung ist, kann anhand einer Geschichte, die von Karl Popper anlässlich eines Vortrages[4] wiedergegeben wurde, dargelegt werden: Der Perserkönig Darius wollte den griechischen Bewohnern seines Landes eine Lektion erteilen. Bei den Griechen war es Brauch, ihre Toten zu verbrennen. Der König rief die in seinem Lande lebenden Griechen zu sich, und fragte sie, um welche Geldsumme sie bereit wären, die Leichen ihrer Väter zu essen. Sie antworteten, dass nichts auf der Welt sie dazu bringen könnte. Darauf rief der König die Kaladzier zu sich, die tatsächlich die Leichen ihrer Väter assen und fragte sie in Anwesenheit der Griechen, die einen Übersetzer zur Verfügung hatten, bei welcher Geldsumme sie bereit waren, die Kör-per ihrer verstorbenen Väter zu verbrennen. Sie schrien laut auf und flehten Darius an, eine solche Abscheulichkeit nicht einmal auszusprechen.
Dieses Beispiel verdeutlicht, wie menschliches Erleben und Verhalten als ein Infor-mationsverarbeitungsprozess verstanden werden kann:
1. Der Mensch nimmt externe (z.B. tote Mitmenschen) und interne (z.B. Ekel- und Angstgefühle, Gefühle des Entsetzens und der Abscheu) Informationen wahr.
2. Externe und interne Informationen werden selbstorganisiert verarbeitet und sind in einem zirkulären Ursache-Wirkungs-Verhältnis miteinander verbunden. Externe In-formationen (z.B. tote Mitmenschen) lösen interne Informationen in Form von Ge-fühlen (z.B. Trauer, Todesangst), Gedanken (z.B. in Form der Fragen: Warum gerade er/sie? Was passiert nach dem Tod? usw.) und Intentionen (z.B. die Ab-sicht, die Toten zu begraben) aus. Genauso denkbar ist allerdings, dass interne Informationen (z.B. ein Hungergefühl) Auswirkungen auf die Betrachtungsweise externer Informationen (tote Mitmenschen) haben können. Die toten Mitmenschen werden dann nicht mehr als Verstorbene, denen die letzte Ruhe zugestanden wird, sondern als potenzielle Nahrungsquelle betrachtet. Dieses auf den ersten Blick makabre Gedankenspiel geht auf eine wahre Gegebenheit zurück und wird im Tatsachenroman Alive: The story of the Andes Survivors von Piers Paul Read beschrieben. Das Buch schildert den Überlebenskampf eines Rugby-Teams aus Uruguay, das auf dem Weg zu einem Spiel in Chile über den Anden abgestürzt war. 72 Tage vergingen, bis einige Überlebende gerettet werden konnten. Um nicht zu verhungern, entschieden sie sich, die Überreste ihrer toten Kameraden zu essen. Traditionsgemäss würden Uruguayaner ihre toten...