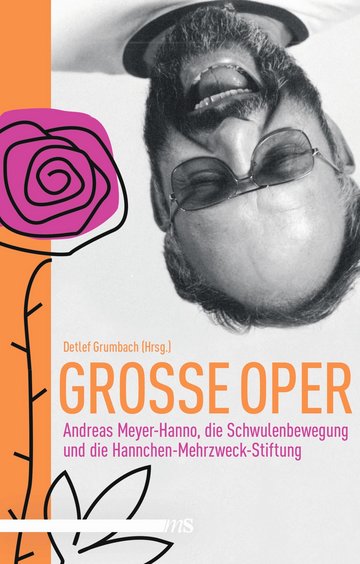ANDREAS MEYER-HANNO
ANTWORT AN WAGNER: «PELLÉAS UND MÉLISANDE»
ZUM 50. TODESTAG VON CLAUDE DEBUSSY AM 26. MÄRZ 1968
(1968)
Mit drei Texten ist Andreas Meyer-Hanno im Jahrgang 1968 der Zeitschrift Opernwelt vertreten. Sie beziehen sich auf die Diskussionen dieser Zeit des Umbruchs. Seine Erinnerung an Debussy (Nr. 3/1968, S. 44-46) verrät sehr viel über seine eigenen Vorstellungen zum Verhältnis von Text und Musik.
Das Vokalwerk Claude Debussys zeichnet sich von Anbeginn durch das hohe literarische Niveau der komponierten Texte aus. Der leicht zum Esoterischen neigende, doch von untrüglichem Gefühl für literarische Qualität geleitete Geschmack Debussys prägt sich in der Wahl seiner Texte aus, ob es sich um die Vertonung von Gedichten des englischen präraffaelitischen Malers und Dichters Dante Gabriel Rosetti handelt, ob Debussy nach altfranzösischen Texten greift oder ob die Komposition von Dichtungen Verlaines, Baudelaires, Pierre Louys’ oder d’Annunzios, von der Auseinandersetzung des Musikers mit der Literatur seiner Zeitgenossen zeugt. Das dichterische Schaffen des jungen symbolistischen Dichters Maurice Maeterlinck, dessen erstes Stück «La princesse Maleine» 1889 den jungen Belgier mit einem Schlage bekannt machte, musste Debussys Aufmerksamkeit erregen, entsprach doch die Dichtung Maeterlincks in ihrer starken Wendung zum Irrealen, vor allem in ihrer starken Bildhaftigkeit dem Wesen Debussys, der das Bild als Mittel der Darstellung über alles liebte, sowohl das Abbild wie das Sinnbild. Debussys Vorstellungen vom musikalischen Theater, die sich vermutlich nach der Begegnung mit Maeterlincks dramatischem Erstling zu konkretisieren begannen (Debussy bewarb sich tatsächlich bei dem Dichter um die Kompositionsrechte der «Princesse Maleine»), finden ihren Niederschlag in einer Äußerung innerhalb eines Gesprächs mit seinem Lehrer Ernest Guiraud aus dem Jahre 1889: «Ich träume von kurzen Dichtungen, von beweglichen Szenen (ich gebe nichts auf die drei Einheiten!), von Szenen, die unterschiedlich im Schauplatz und Charakter sind, von Gestalten, die nicht diskutieren, die das Leben, das Schicksal hinnehmen ... »
Passivität ist die Grundhaltung der Maeterlinckschen Gestalten. Sie erleiden ihr Geschick; das Walten eines unerklärlichen Fatums ist ihnen bewusst, aber sie machen keinen Versuch, sich gegen das Schicksal aufzubäumen oder zumindest seinen Sinn zu ergründen. Die starke Übereinstimmung des Debussyschen Kunstwillens mit den Ideen Maeterlincks sollte schließlich zur Zusammenarbeit führen, die nach dem Erscheinen des «Pelléas»-Dramas in Buchform, vor allem aber nach dem starken Eindruck der szenischen Uraufführung im Pariser «Théâtre de l’Œuvre» 1893 auf Debussy konkrete Formen anzunehmen begann. Rückblickend schreibt der Komponist: «Das ‹Pelléas›-Drama, das trotz seiner traumhaften Atmosphäre mehr Menschlichkeit in sich trägt als die sogenannten ‹Lebensdokumente›, schien mir ganz wunderbar dem zu entsprechen, was ich schaffen wollte. Es ist darin eine beschwörende Sprache, deren Sensibilität durch die Musik und die orchestrale Ausdeutung vertieft werden konnte.» Bei der persönlichen Begegnung zwischen Debussy und dem Dichter des «Pelléas» in Gent war Maeterlinck dem Komponisten bei der Einrichtung des Textbuches zwar behilflich, gab jedoch seine vollkommene Inkompetenz in musikalischen Dingen unumwunden zu. Jahre später sollte sich die Beziehung der beiden Künstler trüben, als Maeterlinck, aufs äußerste aufgebracht darüber, dass nicht seiner Frau, der Sängerin Georgette Leblanc, sondern der jungen Schottin Mary Garden für die Uraufführung die Partie der Mélisande anvertraut worden war, der Vertonung seiner eigenen Dichtung nicht nur das Interesse entzog, sondern dem Werk sogar jeglichen Misserfolg wünschte. Die Komposition des Maeterlinckschen Textes sollte Debussy von 1893 bis 1902 beschäftigen, ein Jahrzehnt zum Bersten angefüllt mit Versuchen, eine neue Form der musikalischen Deklamation zu entwickeln. Debussy experimentiert, skizziert, verwirft, arbeitet um. Aus manchem Takt scheint der Pferdefuß Wagners [...] hervorzulugen; anderes mag zu sehr an Massenet oder d’Indy anklingen und wird völlig neu komponiert. Einzelne Szenen werden in ganz anderer Reihenfolge als im Ablauf des Dramas vertont, eine Erstfassung entsteht 1895, die verworfen und in dreijähriger Arbeit völlig neu geformt wird. Die endgültige Fassung liegt schließlich 1901 vor, allerdings ohne den wesentlichen Anteil der sinfonischen Zwischenspiele, die zum Ausfüllen der Umbaupausen zum Teil noch während der Probenarbeit zur Uraufführung komponiert werden. Und doch stellt sich endlich die Partitur von «Pelléas und Mélisande» trotz des großen Zeitraums ihrer Entstehung als künstlerischer Organismus von seltener Geschlossenheit und Dichte heraus. Die Dichtung Maeterlincks steht in krassem, höchst programmatischem Gegensatz zur psychologisierenden realistischen Literatur des ausgehenden neunzehnten Jahrhunderts. Der «Pelléas» ist bewusst völlig a-psychologisch; seine Gestalten sind geprägt, ja sie sind stark geprägt, dass sich ihre Entwicklung innerhalb des Dramas vollkommen ausschließt. Auch die Aktion entwickelt sich nicht mehr im Sinne der klassischen Dramaturgie. Was an Handlung überhaupt noch von Gewicht ist, vollzieht sich zwischen den Zeilen. Woher kommt Mélisande? Niemand weiß es, so wenig, wie jemand erfahren wird, wer ihr Leid angetan hat, warum sie ihre Krone, die auf dem Grund des Quells liegt, nie mehr zurückhaben will. Auch das Schloss Arkels wird sich nie erhellen – niemand weiß, warum es so trostlos und traurig ist, warum nie die Sonne in sein Gemäuer dringt. Der Wald, der es umgibt, ist gleichermaßen düster und dumpfig-schwül; und ab und zu wird irgendwo draußen ein Toter aufgefunden, welcher der Hungersnot zum Opfer fiel, die ringsum herrscht. Das Unausgesprochene triumphiert. Niemand weiß, woran des Pelléas Vater erkrankt ist, ob er je gesunden wird, niemand wird je erfahren, ob der Freund des Pelléas sterben muss. Es gibt keine philosophischen Exkurse mehr – Maeterlincks Diktion, keineswegs frei von einer gewissen Manieriertheit, ist absolut dinglich, real, beinahe naiv. Die Lacher im Publikum bei der Uraufführung der «Pelléas»-Oper sind im Wesentlichen auf die gewollte Einfachheit des Textes zurückzuführen, der ein mit allen Wassern des Psychologismus gewaschenes Publikum unbefangen zu folgen nicht mehr imstande war. Fakten, Empfindungen werden ausgesprochen; die Dinge werden nicht mehr entwickelt, sondern stehen reliefartig nebeneinander in der Unendlichkeit des Raumes. Sinn, logischer Aufbau von Gedankengebäuden ist nichts mehr, Gefühl, Farbe, Nuance ist alles.
Dieser Text konnte nur von einem Komponisten vertont werden, dessen Sprachgefühl aufs Höchste entwickelt, dessen Sinn für die Nuance aufs Feinste ausgebildet war. Debussy nähert sich diesem Text mit der Sensibilität eines Seismografen. Nicht dass er etwa der Sprachmelodie mit dem aktiven, beinahe wissenschaftlichen Forscherdrang nachspürte, wie das beinahe zur gleichen Zeit Leoš Janáček unternimmt. Debussys Haltung seinem Text gegenüber ist durchaus passiv. Der sprachliche Duktus der Maeterlinckschen Sätze trägt ihn, das Melos ihrer Konstruktion, das Aroma der Vokale und Konsonanten in den einzelnen Worten erschließt sich ihm wie von selbst. Als oberstes Gesetz scheint das Prinzip der absoluten Asymmetrie zu herrschen; keine Phrase gleicht der anderen, und die Wiederholung als formbildendes Gestaltungsmittel ist völlig vermieden. Jede pathetische Wendung, jede opernhafte Übersteigerung des Ausdrucks wird bewusst vermieden. Nur an einigen Höhepunkten des Werks erhebt sich die aus beinahe psalmodierender Deklamation entwickelte Diktion zu größer ausschwingenden melodischen Bildungen – man verfolge etwa die sich steigernde Intensität der Gesangsphrasen Pelléas’ und Mélisandes von der noch schüchternen ersten Begegnung über den Lyrismus der nächtlichen Szene an Mélisandes Turm bis zur jubelnd-überschwenglichen Abschiedsszene der Liebenden am Brunnen. Das Einzelwort wird, ganz im Gegensatz zu Richard Strauss’ zu gleicher Zeit entstehenden frühen Opern, nicht im Detail ausgedeutet. Dafür ist die Grundstimmung einer Szene von Anfang an gegeben; sie wird mit sparsamsten Mitteln erzeugt und bestimmt in der Folge den Ablauf eines ganzen Bildes.
Das Leitmotiv existiert; es wird sogar in der Wagnerschen Technik der mehrfachen Überlagerung verschiedener Themen angewandt, doch geschieht dies in unprogrammatischer, gleichsam beiläufiger Weise. Die starke Besetzung des Orchesters steht im Gegensatz zu seiner kammermusikalisch ausgesparten, durchsichtigen Behandlung. Der schlanke, durch vielfache Teilung des Streichquintetts gesättigte Ton hüllt die Stimmen in ein dichtes, stets transparentes Klanggewand ein, verstärkt und unterstützt die aufs Äußerste nuancierten Gesangsphrasen. Und an einigen wesentlichen Situationen der Oper setzt das Orchester ganz aus, um der Singstimme den Vorrang zu lassen.
Aus all diesen Merkmalen ergeben sich, ohne dass dies bisher ausgesprochen wurde, die größten Gegensätze zu dem die damalige europäische Musikwelt beherrschenden Gesamtkunstwerk Wagners. Debussy, der sich vom begeisterten Bayreuth-Pilger zum Gegner der Wagnerschen Ideenwelt entwickelte, hat seine Wagner-feindliche Haltung nirgendwo so entschieden in die künstlerische Praxis umgesetzt wie in der «Pelléas»-Oper. Deren dramatische Ausgangssituation ist der des «Tristan» durchaus ähnlich, doch stehen den Wagnerschen Riesengestalten die kleinen, fast unbewusst handelnden Menschenkinder Debussys gegenüber. Bei Wagner die Ballung der inneren und äußeren Aktion in...