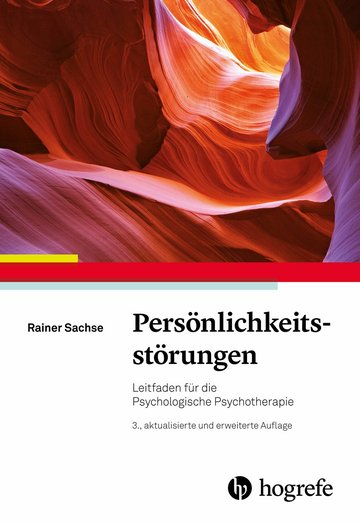|1|1 Wesentliche Grundkonzepte von Persönlichkeitsstörungen
1.1 Einleitung
Das Konzept „Persönlichkeitsstörungen“ (es wird hier dafür die Abkürzung „PD“ für „personality disorders“ gewählt) hat eine lange Geschichte, und das hat zur Folge, dass sich sehr unterschiedliche Vorstellungen dazu entwickelt haben; Vorstellungen, die z. T. weit voneinander abweichen und die kaum noch kompatibel sind* .1
Neuere Entwicklungen des Konzeptes gehen davon aus, dass man Persönlichkeitsstörungen nach zwei Aspekten erfassen sollte: Man sollte konzeptualisieren, was PD im Allgemeinen psychologisch sind, und zweitens genau definieren, was, auf der Grundlage dieses allgemeinen Konzeptes, einzelne PD ausmacht.2 Solche Überlegungen wurden auch im DSM-5 aufgegriffen (APA, 2013).
Das hier vorgestellte Konzept von Persönlichkeitsstörungen verfolgt ein äquivalentes Vorgehen: Es wird ein allgemeines Modell über das „psychologische Funktionieren von Persönlichkeitsstörungen“ vorgestellt und, auf der Grundlage dieses Modells, werden die einzelnen Störungen definiert. Außerdem werden aus dem allgemeinen wie aus den spezifischen Modellen therapeutische Implikationen abgeleitet (vgl. Döring & Sachse, 2008a, 2008b, 2008c, 2017a, 2017b, 2017c).
Die Aufgabe dieses Buches soll jedoch nicht darin bestehen, die Konzeptentwicklungen nachzuzeichnen oder zu diskutieren: Die Aufgabe des Buches soll vielmehr darin bestehen, ein bestimmtes Konzept von Persönlichkeitsstörungen, nämlich das der Klärungsorientierten Psychotherapie (KOP), darzustellen. Zu diesem Zweck werden zunächst grundlegende Vorstellungen des Ansatzes über Persönlichkeitsstörungen deutlich gemacht, um aufzuzeigen, von welchen Vorstellungen hier ausgegangen werden soll.
|2|1.2 Der Begriff „Persönlichkeitsstörung“
Ursprünglich wurde davon ausgegangen, dass es Störungen gibt, die sehr umfassend, sehr tiefgreifend und sehr behandlungsresistent sind, und diese Störungen wurden deshalb als „Störungen der Gesamtpersönlichkeit“ (bzw. des „Charakters“) aufgefasst (vgl. Kernberg, 1978; Kretschmer, 1921; Schneider, 1923).
Nach heutigen psychologischen Analysen muss man immer noch davon ausgehen, dass diese Störungen komplex sind und dass die spezifischen psychologischen Konstellationen der Störungen diese immer noch relativ schwer behandelbar machen (vgl. Millon, 1996, 2011; O’Donohue et al., 2007): Man entfernt sich aber weitgehend von den Auffassungen, die Störungen als „Störungen der Persönlichkeit“ anzusehen. Vielmehr wird deutlich, dass die Merkmale, die eine PD charakterisieren, häufig auch schon in leichteren Ausprägungen vorkommen und dann als weitgehend „normal“ gelten: Und damit erscheinen dann „schwerere“ Ausprägungen nur noch als „Extremisierungen normal-psychologischen Geschehens“ (Fiedler, 2007; Fiedler & Herpertz, 2016) und damit als eine „Variation des Normalen“ und nicht mehr als „pathologisch“.
Damit hat eine weitgehende Tendenz zur „Entpathologisierung“ und „Normalisierung“ von „Persönlichkeitsstörungen“ eingesetzt: Weiterhin ist aber klar, dass die Störungen den Personen große Kosten erzeugen und dass es daher sinnvoll ist, sie therapeutisch zu behandeln; es ist aber auch wichtig, die Betroffenen nicht zu stigmatisieren. Wir (Sachse, Sachse & Fasbender, 2010, 2011; Sachse, Fasbender, Breil & Sachse, 2012) würden, anders als Emmelkamp und Kamphuis (2007), Persönlichkeitsstörungen damit auch nicht als eine „chronic psychiatric disorder [...] characterized by pathological personality traits“ auffassen. Ich halte es für unangemessen, von „pathologischen traits“ zu sprechen, und ich weiß auch nicht, was genau eine „psychiatric disorder“ sein soll: Da Persönlichkeitsstörungen sich gut psychologisch erklären und psychotherapeutisch behandeln lassen, sind sie aus meiner Sicht eine Domäne der Psychologie.
Es ist wesentlich, Persönlichkeitsstörungen als extreme Ausprägungen „normaler“ psychologischer Prozesse aufzufassen, die den betreffenden Personen so hohe Kosten erzeugen, dass eine Psychotherapie sinnvoll ist.
Und damit werden Klienten mit PD hier auch nicht als „infantil“, „unreif“, „pathologisch“, „schwer gestört“ oder als „charakterlich defizitär“ eingestuft oder bezeichnet: Es ist wichtig, von solchen Abwertungen wegzukommen. (Dies ist schon wichtig, um mit den Klienten eine gute therapeutische Beziehung zu gestalten!)
Im Grunde wäre es sinnvoll, auf den Begriff „Persönlichkeitsstörungen“ zu verzichten oder ihn durch den Begriff „Interaktionsstörung“ zu ersetzen. Da der Be|3|griff sich aber weitgehend eingebürgert hat, kann man ihn weiter verwenden, wenn man weiß, was man damit meinen will und was nicht.
1.3 Stil und Störung
Damit in Zusammenhang steht die Auffassung, dass eine psychologisch definierbare Einheit wie z. B. eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ein Kontinuum bildet, das von einem „leichten Stil“ bis zu einer „schweren Störung“ reicht (Kuhl, 2001; Kuhl & Kazén, 1997).
Personen mit einem leichten Stil weisen Charakteristika einer psychologischen Einheit in leichter Ausprägung auf und Personen mit einer schweren Störung weisen diese Charakteristika in einer massiven Ausprägung auf.
Eine wichtige Implikation dieser Sichtweise ist, dass es keine eindeutigen Kriterien dafür gibt, wann aus einem Stil eine Störung wird (deutlich ist, dass auch DSM- oder ICD-Kriterien vollkommen willkürlich und keineswegs empirisch validiert sind!): Im Grunde gibt es keine empirisch validen Kriterien, die angeben könnten, wann genau aus einem Stil eine Störung wird.3
Daher ist es im Psychotherapieprozess sinnvoll, jeweils mit einem Klienten auszuhandeln, ob der Klient seine Störung letztlich für so „störend“ hält, dass er eine Therapie für indiziert erachtet. Auf keinen Fall kann ein Therapeut einem Klienten eine Psychotherapie verweigern, weil er „nicht genügend Kriterien“ erfüllt; eine solche Vorgehensweise ist weder empirisch noch ethisch zu rechtfertigen.
1.4 Das Stellen von Diagnosen
Ein wichtiger Aspekt der „Entpathologisierung“ ist, dass man Diagnosen von PD nicht stellt, um Personen „abzustempeln“: Stellt man „offizielle“ Diagnosen (also solche, die an offizielle Stellen weitergeleitet werden), dann sollte man sich immer darüber im Klaren sein, dass diese durchaus gegen Klienten verwendet werden können und damit sollte man vorsichtig sein. Intern, d. h. in der Supervision, dienen Diagnosen aber ausschließlich dazu zu verstehen, was genau die Störung des Klienten ist, um dann konstruktiv mit dem Klienten umgehen zu können.
Der Sinn von Diagnosen ist ausschließlich, daraus sinnvolle therapeutische Maßnahmen ableiten zu können (Sachse, 2017a).
|4|Daher ist es prinzipiell sinnvoll, dass ein Therapeut
eine Diagnose vergibt,
sich bewusst ist, dass diese immer eine mehr oder weniger gut belegte Hypothese ist, also eine „Arbeitshypothese für die Psychotherapie“,
eine Diagnose möglichst früh im Prozess (und als „erste Hypothese“) erstellt,
eine PD bei einem Klienten nie übersieht.
Und dann kann es durchaus sinnvoll sein, z. B. von „Narzissmus“ zu sprechen, obwohl der Klient lediglich einen „Stil“ aufweist: Denn es kann auch dann schon hilfreich sein, weil man auf Spiele, Motivationsprobleme etc. vorbereitet ist.
Allgemein ist es sinnvoll, einen Persönlichkeitsstil bzw. eine Störung im Therapieprozess zu berücksichtigen, d. h. also zu diagnostizieren und im therapeutischen Vorgehen zu berücksichtigen, wenn
und/oder