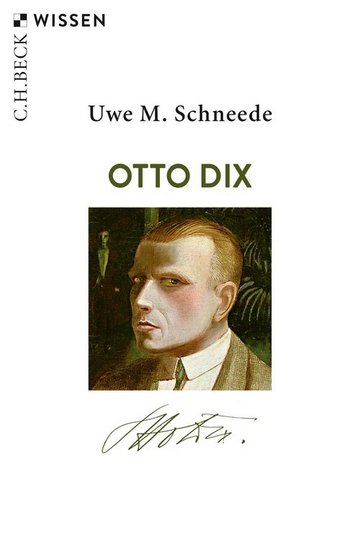Frappierende Stilwechsel; der Beginn
Selbstbildnisse 1912–1915
Eine grundlegende Besonderheit dieses Werks lassen bereits die frühen Selbstbildnisse erkennen. Sie führen eine kunsthistorisch einzigartige Heterogenität der Stile vor. Otto Dix war gerade 20 Jahre alt, geboren 1891 im thüringischen Gera als Sohn eines Formers in einer Eisengießerei und einer Näherin; 1905 bis 1909 hatte er eine Lehre als Dekorationsmaler bei einem Geraer Malermeister absolviert und ab 1910 in Dresden mit Hilfe eines Stipendiums an der Königlichen Kunstgewerbeschule studiert – bis er 1914 in den Krieg eingezogen wurde.
In dieser Zeit entstand eine Reihe erstaunlicher Selbstbildnisse. Sie begann 1912 mit einem skeptisch dreinblickenden Jüngling mit Nelke in der Hand in der Manier der italienischen Frührenaissance (Abb. 7). Es folgten zweimal Naturburschen, nicht mehr altmeisterlich, sondern im Stil Ferdinand Hodlers. Ebenfalls 1913 präsentierte sich der Künstler als expressionistisch hingehauenen, rauchenden Bohemien im Atelier und im Jahr darauf provokant als ungestümen, kahlgeschorenen Berserker mit riesiger, selbstbewusster Signatur (Abb. 8). Mal erscheint er als Landsertyp in der Art trockenster naiver Jahrmarktsmalerei (Abb. 9) und mal in glühendem Rot vor schwarzem Grund gleich in mehreren Ansichten als allgegenwärtiger finster-grimmiger Dämon aus dem Spiegelkabinett. Schließlich gab er sich 1915 – noch vor dem Fronteinsatz – in einem futuristischen Wirrwarr aus Trümmern, Leichenteilen, Tierkörpern und Blut mythologisch als Kriegsgott Mars aus, der jedoch selbst in den Strudel dieser Weltzerstörung gerät. Und dann folgte 1918 das emphatische Selbstbildnis Sehnsucht als Allegorie (Abb. 10): der Kopf blau wie der Himmel, flankiert von den Symbolen des Tages und der Nacht, der Fauna und der Flora. Ein abgehobener Poet des Kosmos.
Gegensätzlicher kann man sich selbst kaum darstellen. Künstler verwandelten sich gern in ihren eigenen Bildern. Rembrandt verkleidete sich und grimassierte, um ein anderer zu sein und mit fremden Erfahrungen bildlich experimentieren zu können. Vincent van Goghs Kopf veränderte von Mal zu Mal das Aussehen, als er, besser: weil er in seiner Pariser Phase die bei den bereits avancierten Kollegen beobachteten neuen Bildverfahren an sich selbst erproben wollte. Max Beckmann schlüpfte bildnerisch in verschiedene Rollen, um das Selbstverständnis als Künstler im jeweiligen Zeitkontext zu erkunden.
Ganz anders Dix. Er präsentierte sich selbst in unterschiedlichsten Stilen, Epochen, Bildtypen. Es kommt hinzu, dass er von der feinen, flächigen Lasurtechnik bis zur ruppigen Alla-prima-Geste, direkt nass-in-nass auf die Leinwand aufgetragen, bis zu pastosen, plastisch wirkenden Partien sämtliche Malweisen durchging. Normalerweise würde man sagen, der junge Mann sei als Künstler auf der Suche nach einem eigenen Stil gewesen und habe nach und nach alles – sei es noch so gegensätzlich, wenn nicht unvereinbar – ausprobiert, was ihm in den Weg kam, Kunstgeschichte oder Avantgarde, um den eigenen Weg zu finden.
Dix aber setzte bei der in diesem kunsthistorischen Moment bereits zutage liegenden Gleichzeitigkeit und Gleichwertigkeit der Stilmöglichkeiten an und benutzte sie zur angemessenen Repräsentanz unterschiedlicher Künstlerselbstverständnisse. Er entwickelte keinen neuen Stil, er nutzte vorhandene Stile. Offenbar erkannte er, dass sich bestimmte Eigenschaften – hier das Stille, das Brutale, das Bäuerliche oder das Naive – durch entsprechende Malweisen einprägsam veranschaulichen ließen. So nutzte er die diversen Bildmittel zum Aufrufen ganz unterschiedlicher Typen. Die praktizierte Verfügbarkeit des stilistisch Heterogenen und das Verlangen, aus dem Persönlichen, Individuellen – hier den Selbstbildnissen – etwas Typisches abzuleiten, sollten zur Grundlage seines weiteren Werks werden.
Mit einem solchen Vorgehen unterschied sich Dix zutiefst von der voraufgegangenen Generation der Expressionisten. Für sie gab es nicht diese Wahlfreiheit der Bildmittel, sondern nach dem Durchgang durch van Gogh die zwangsläufige Ausprägung eines eigenen, emotional-identifikatorischen Stils. Auch lag den Expressionisten die Distanzierung von der eigenen Person fern. Wenn sie sich selbst darstellten, ging es ihnen in der Nachfolge von Edvard Munch um ihre eigene Person, ihre eigene Identität, ihre eigenen Leiden – man denke nur an Ernst Ludwig Kirchner oder Ludwig Meidner.
Dix dagegen war auf der Suche nach verschiedenen, nach möglichen Identitäten, immer in gewisser Distanz zu sich selbst. Er meinte am Ende gar nicht sich selbst. Vielmehr wurden – am eigenen physiognomischen Beispiel und damit am jederzeit verfügbaren Modell – Entwürfe von extremen Typen und Rollen außerhalb des Bürgerlichen geschaffen, also Selbstbildnisse als Entwürfe in verschiedenen Idiomen für eine Galerie Unzeitgemäßer und Unangepasster. Sein ganzes späteres Porträtwerk wird schließlich von Sonderlingen und Außenseitern dominiert sein.
Dazu will bedacht sein, dass der junge Dix noch vor dem Krieg als Student an der Kunstgewerbeschule in der Dresdner Galerie Ernst Arnold und im Kunstsalon Emil Richter der Moderne in ihrer ganzen Spannbreite innewerden konnte. Es fanden dort anspruchsvolle Ausstellungen von Vincent van Gogh, Paul Cézanne, Paul Gauguin oder Edvard Munch statt; die legendäre Schau zum italienischen Futurismus machte 1913 auch bei Emil Richter Station; Arnold zeigte 1912 Ferdinand Hodler, Richter 1914 Pablo Picasso. In einem offenbar weitgehend auf Herwarth Waldens Erstem Deutschen Herbstsalon beruhenden Überblick Expressionistische Ausstellung – Die neue Malerei präsentierte Arnold 1914 Werke unter anderen von Max Ernst, Lyonel Feininger, Wassily Kandinsky, Paul Klee und den Malern der Brücke und des Blauen Reiter. Alles, was die Moderne an subjektivem Seelenausdruck, an neuen Bildverfahren, Farbexplosionen, Formveränderungen, an Menschengestaltung und Bildverständnis hervorgebracht hatte und gegenwärtig hervorbrachte, fand Dix dort ausgebreitet. Es war die neue Welt der Kunst, in die er aufbrach. Gleichzeitig nahmen ihn in der Dresdner Gemäldegalerie alle großen Epochen und Facetten der Kunstgeschichte in Anspruch.
Als Kandinsky im Almanach Der Blaue Reiter 1912 seinen Aufsatz «Über die Formfrage» veröffentlichte, formulierte er einen Grundsatz der Moderne: Es gebe in der Gegenwart keinen Vorrang eines Stils oder einer künstlerischen Verfahrensweise mehr. Kennzeichnend seien vielmehr zwei Pole. «1. die große Abstraktion, 2. die große Realistik», nämlich «das ‹Reinkünstlerische› und das ‹Gegenständliche›». Diese Pole, so Kandinsky, seien zwei unterschiedliche Wege, die zu einem Ziel führten. Entscheidend sei in jedem Fall die «innere Notwendigkeit». Der Gedanke war ähnlich im Jahr zuvor bei Beckmann in einem Brief vom 18. April an Harry Graf Kessler aufgetaucht: «Der eine empfindet kosmischer und dramatischer der andere mikroskopischer und lyrischer. Beides ist gleichberechtigt, wenn es nur aus einer innern Einheit entspringt.» Er, Beckmann, habe aus «dem fast bewussten Gefühl» heraus gehandelt, «durch alles hindurchgehen zu müssen, alles bis in’s letzte kennen und können gelernt [zu] haben um dann ganz man selbst seien zu können», heißt es in einem Brief vom 10. Mai 1919. Auf dieser selbstbewussten Aneignung der Alten Meister und der frühen Erneuerer baute Beckmanns Bemühen um eine die Moderne überwindende Synthese auf. Und auf einer ebenso selbstbewussten Aneignung der Alten Meister und der aktuellen Erneuerer fußte Dix’ Eigensinn in der Moderne.
Der Gedanke von der Verfügbarkeit der Stile und damit von der Vollendung der Moderne manifestierte sich im selben Augenblick auch institutionell, und zwar in den ersten umfassenden Ausstellungen, welche die letzten künstlerischen Entwicklungen rekapitulierten, dabei Künstler wie van Gogh, Gauguin, Cézanne und Munch als Klassiker herausstellten und so für das ganze 20. Jahrhundert kanonisierten: die Kölner Sonderbund-Ausstellung von 1912, der erwähnte Erste Deutsche Herbstsalon 1913 in Berlin sowie die Armory Show in New York, ebenfalls 1913. In ihnen wurde die Bilanz der Moderne als einer Synthese der Gegensätze gezogen.
Das ist der Hintergrund, vor dem auch Otto Dix’ Werk gesehen werden muss: dem Bewusstsein von der vollzogenen Moderne, von der Verfügbarkeit unterschiedlichster Stile und der Möglichkeit einer lebhaften Synthese als Gewinn aus der vorgefundenen Uneinheitlichkeit. ...