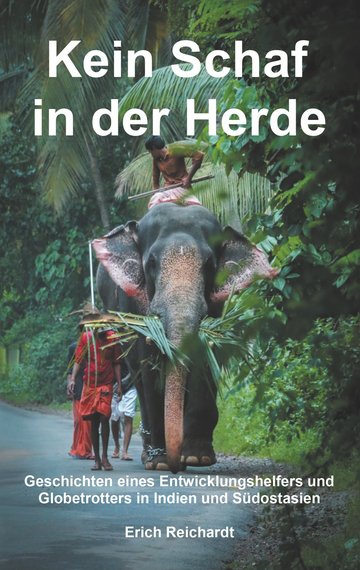Zugfahrt nach Hyderabad, Andrah Pradesh
Am hektischen Bahnhof von Cuttack kauften wir meine Zugfahrkarte, diesmal konnte ich Schlafwagen buchen, da die Fahrt über 24 Stunden dauerte und mich, laut DED-Regelung, für ein besseres Ticket qualifizierte. Fahrplanmäßig hätte der Zug morgens um 4.45 Uhr losfahren müssen. Um 7.30 Uhr, wir waren bereits müde vom Warten, beschlossen wir in der Bahnhofskantine einen Tee zu schlürfen. Schließlich kam die Durchsage, dass der Zug in ca. 30 Minuten eintreffen würde. Gott sei Dank gibt es für einen Europäer an einem indischen Bahnhof genügend zu sehen. Indische Bahnhöfe sind mit ihren vielen Menschen, Farben und Gerüchen ein Abenteuer für sich. Und irgendwie ist auch immer noch das Englische präsent, dass man sich hier und da in die Kolonialzeit zurückversetzt fühlt, nur mit dem Unterschied, dass sich inzwischen Hunde und Kühe und allesmögliche Federvieh auf dem Bahnhof rumtummeln. Affen sind natürlich auch mit von der Partie, da es ja genügend zu futtern gibt, denn überall wird gekocht und gebrutzelt und so indische Essensgerüche können manchmal schon ganz schön penetrant sein. Diesem Abwechslungsreichtum war es zu verdanken, dass wir uns während der langen Wartezeit nicht gerade langweilten. Der Zug kam natürlich nicht, wie man uns angekündigt hatte, nach 30 Minuten, sondern erst viel später, nach ca. 4 Stunden. So hatten ich mehr als 7 Stunden Verspätung und nach den Aussagen meiner Kollegen, welche die ganze Zeit mit mir gewartet hatten, war dies nicht normal, da Verspätungen sonst nicht mehr als 1 oder 2 Stunden betragen. Als der Zug dann endlich mit viel Dampf und einem höllischen Lärm in die Halle des Bahnhofs einfuhr, herrschte augenblicklich eine große Hektik, da alle anhand ihrer Wagennummer nach ihren Wagen suchten. Zudem versuchten Verkäufer, sowohl bei den Passagieren vor dem Zug, als auch bei denen, die schon im Zug Platz genommen hatten, ihre Ware los zu werden. Nachdem wir den Wagen, für den ich ein Ticket hatte, gefunden hatten, ging’s ans Verabschieden. Ich bedankte mich bei den Kollegen für die Gastfreundschaft und da ich die beiden recht gerne hatte, verabschiedeten wir uns mit einer kräftigen Umarmung und versprachen uns, in Kontakt zu bleiben. Dann suchte ich mein Abteil auf – 20 Minuten später ging es dann endlich los. In meinem Abteil waren zwei dicke Inder, deren Mund vom kauen des Betelnussblatts rot gefärbt war. Den Pan, wie ein Betelnussgemisch genannt wird, gibt es in den unterschiedlichsten Variationen mit verschiedensten Zutaten und konnte Lippe und Zunge und die gesamte Mundhöhle rotfärben. Reiche Inder kauen dieses Zeug nach dem Essen als Verdauungshilfe, die Armen weil es das Hungergefühl verdrängt. Manche Verkäufer bieten Pan mit einer Beimischung an Rauschmitteln an. So konnte man von einem Betel Pan richtig „high“ werden. In Indien wird gerne die Geschichte eines japanischen Geschäftsmanns erzählt, der von seinen indischen Partnern nach Kolkata eingeladen worden war, und nachdem er das Flughafengebäude verlassen hatte, gleich wieder umgekehrt sei, da jeder Taxifahrer, Rikscha-Puller, einfach jeder, den er gesehen hatte, um den Mund rotgefärbt war oder rotes Zeug ausspuckte, das für ihn wie Blut ausgesehen haben muss. Er hatte das, was er dort sah, für eine schlimme Krankheit, wie Tuberkulose oder eine andere Seuche gehalten und hatte auf dem Absatz kehrt gemacht, bevor ihn diese Pest ebenfalls heimsuchen würde. Es könnte so gewesen sein, denn wer diese Betelkauer zum ersten Mal sieht, kann ohne weiteres zu dem Schluss kommen, dass diese Menschen krank sind und Blut spucken. Für mich war der Pan im Laufe der Jahre zu einer Art Delikatesse geworden, speziell nach kräftigem indischem Essen. Mehta Pan Kalkutta war ein süßlicher Pan, der nicht die rote Färbung in der Mundhöhle und um den Mund hinterließ und der aufgrund verschiedenster Gewürze, wie Anis, die Verdauung angeregte. Den roten Pan mochte ich persönlich nicht, aber ich gewöhnte mich an den Anblick derer, die ihn kauten. Bei Frauen sah dies oft besonders hässlich aus und gab ihnen je nach Aussehen ein vampirartiges Gesicht. Die Zugfahrt war in jeder Hinsicht eine Strapaze. Ich hatte, außer ein paar Bananen und einem kleinen Sandwich, nichts zu essen und zu trinken dabei und leider waren die Einkaufsmöglichkeiten auf den Haltebahnhöfen sehr limitiert. Es gab hauptsächlich Tee oder Kaffee oder wenn man Glück hatte, eine Coca Cola zu kaufen. Einige Jahre später war auch dies nicht mehr möglich, da Coca Cola in den 1970er Jahren aus Indien verbannt wurde. Zu essen wurde entweder ein vegetarisches oder nicht vegetarisches Curry auf einem Bananenblatt angerichtet angeboten, welches meistens sehr gut und feurig gewürzt und auch schmackhaft war aber nicht immer hygienisch zubereitet oder serviert wurde. Je nach Tageszeit gab es dazu Chapati oder Reis. Im Norden des Landes gab es mehr Brot, also Chapati, und im Süden mehr Reisgerichte. Die Auswahl war im Allgemeinen bescheiden – es gab fast immer das Gleiche – mich hatte es, nach dem Verzehr eines solchen Imbiss, während der Weiterfahrt im Zug voll erwischt – offensichtlich Amöben – ich hatte einen flotten Otto, den ich bis zu meiner Ankunft in Hyderabad und etliche Tage später, also mehr als 36 Stunden später, nicht mehr loswurde. Indische Zugtoiletten sind nicht ohne Tücken. Es sind französische Stehtoiletten, auf denen man in die Knie gehen und im richtigen Winkel zielen muss, was nicht so einfach ist, da die indischen Züge nicht sehr ruhig fahren und man somit des Öfteren hin und her geworfen wird. Wenn man anschließend die Wasserspülung betätigt, geht man besser in Deckung um keine Sommersprossen zu bekommen. Toilettenpapier ist in dieser Klasse natürlich nicht vorhanden. Ich erinnere mich an Szenen, wo früh morgens unzählige nackte Ärsche an Bahngleisen und Bahnabhängen ihre Toilette verrichteten. Zuerst durften Frauen und Kinder und dann die Männer, alles in allem eine Prozedur, die sich über 2 bis 3 Stunden ab 5.00 Uhr morgens hinzog. Ich zählte die Ärsche, die sich einem entgegen reckten pro Minute und unterschied sie nach Schönheit, Hässlichkeit oder Größe. Das hört sich vielleicht etwas pervers an, aber was sonst soll man 36 Stunden in einem indischen Bummelzug machen. Den Scheißern machte es nichts aus, ihnen war es egal, ob sie beim kacken gesehen wurden, sie kackten fröhlich weiter, wenn ein Zug vorbeifuhr. Die Fahrt verlief anfangs über die nördlichen Städte Bhopal und Allahabad, von dort ging es dann Richtung Süden, nach Vishakhapatnam und Kazipet, bis wir schließlich über Secunderabad nach Hyderabad fahren sollten.
Gegen 6.00 Uhr morgens rollte der Zug in Secunderabad ein und ich fühlte mich hundeelend. Laut Schreiben des DED-Kollegen sollte ich am Bahnhof von Hyderabad abgeholt werden und ich bereitete mich darauf vor, in ca. 30 Minuten einen Kollegen zu treffen. Der Kollege Siegfried hatte bereits seit einigen Stunden auf dem Bahnhof von Hyderabad gewartet. Da man jedoch nie genau wusste, wann solch ein Zug ankommt, hatte er sich auf den Weg ins 15 Kilometer entfernte Secunderabad gemacht, um mich am dortigen Bahnhof im richtigen Moment zu finden. Aufgrund meines desolaten Zustands war ich auf meinem Platz sitzen geblieben und hatte aus dem Fenster geträumt, als plötzlich ein deutschaussehendes Gesicht am Abteilfenster auftauchte und sagte, „Los geht’s, komm raus“. Ich packte meine Sachen schleunigst zusammen und verließ den Zug, der sich in diesem Moment schon wieder gemächlich in Bewegung setzte, dass ich vom Wagen abspringen musste – in Indien kein Problem, da es der Normalzustand ist, alle taten das – die Züge rollten langsam. Im Gegensatz zu Hyderabad, das einen Sackbahnhof hat, ist der Bahnhof der Schwesternstadt Secunderabad ein Verkehrsknotenpunkt und somit der lebendigere der beiden Bahnhöfe. Ich war glücklich und freute mich endlich an meinem Zielort angekommen zu sein. Allerdings hatte mich die Freude darüber nicht von den Schmerzen im Analbereich ablenken können, denn ich war während dieser langen Reise mindestens fünfzehnmal auf der Zugtoilette gewesen und hatte somit einen erheblichen Wasserverlust erlitten. Siegfried war ein Mann von Welt und dazu noch aus Oldenburg und sagte mir, dass meine Darmverstimmung noch gar nichts sei und ich mich auf Schlimmeres gefasst machen sollte. Ob er mich erschrecken wollte, weiß ich nicht – es kam tatsächlich etwas schlimmer, aber darüber mehr an späterer Stelle. Vor dem Bahnhof nahmen wir ein Trishaw, ein Auto-Rikscha, in welches wir uns, inklusive meines Gepäcks, regelrecht hineinzwängen mussten, da ich mit meinen 93 Kilogramm nicht gerade ein Leichtgewicht war. Die Inder saßen aber meistens mit vier oder fünf Leuten in solch einem Gefährt.
Es waren gut 15 Kilometer vom Bahnhof in Secunderabad bis zum Industrial Training Centre von Boys Town. Die Fahrt war für mich ein Höllentrip. Es ging über Stock und Stein, Gott sei Dank gab es aber auch einige asphaltierte Straßen. Ich konnte von Glück...