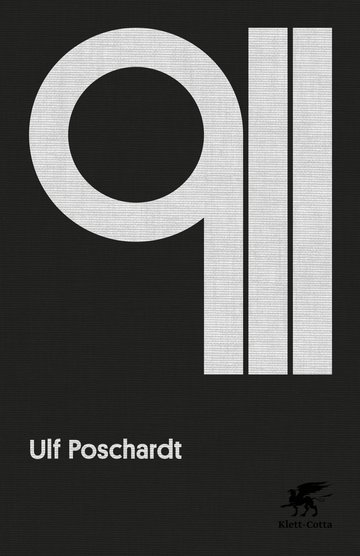»What a Krautwagen!«, schwärmte Boris Johnson beim Anblick des Porsche 911 Targa, den man ihm zum Testen vor die Tür gestellt hatte. Boris Johnson war damals, 2003, ein einflussreicher Oppositionspolitiker der Tories, 2008 wurde er Bürgermeister von London und seit dem Amtsantritt von David Cameron als Premier gilt Johnson als künftiger Kandidat für den Tory-Vorsitz. Nebenbei wirkte er als Schriftgelehrter, Freigeist, Exzentriker und Autoliebhaber. Für ihn, den Briten, war und ist der Porsche 911 zunächst ein sehr deutsches Auto mit einem Namen, das nach den Terroranschlägen vom 11. September so absurd klingt wie ein Nissan Osama oder ein Datsun Pearl Harbor. Gegen Ende seines Tests für die britische »GQ« nach all den Spötteleien und Witzen über den Namen lobt er den Elfer in nahezu unbritischer Überschwänglichkeit und befiehlt seinen Lesern, sich unverzüglich einen zuzulegen. Diese etwas militärische Geste ist eine ironische Anspielung auf jenes im Elfer vermutete Preußentum.
Andere Briten agieren weniger freundlich. Jeremy Clarkson zum Beispiel. Der wohl berühmteste Autojournalist der Welt hasst den Porsche. »Wäre der Porsche 911 eine Frau, es wäre Brünhild, wäre er ein Gebäude, es müsste ein Bunker sein, und wäre es eine Speise, dann wohl eine Torte aus Fleisch«, vermutete Clarkson in einem mittlerweile berühmt-berüchtigten Film, der im Internet auch heute Elfer-Freunde amüsiert. Er zeigt Clarkson beim Versuch, einen Porsche zu ermorden. Leidvoll muss er feststellen, dass es wohl doch kein Gerücht sei, dass diese Autos aus Granit gefertigt werden. Ein altes Klavier kracht auf den betagten roten Elfer und verursacht lediglich eine Beule. Dann kracht er gegen ein Haus und sieht dessen Mauerwerk zerstört, nicht aber die Fahrtüchtigkeit des Porsche. Er schießt auf den Elfer, übergießt den Motor mit Säure. Es hilft nichts. Schließlich lässt er den Elfer von einem zehn Meter hohen Kran auf einen mit Gas gefüllten Wohnwagen herunterkrachen, um das Auto in die Luft zu jagen.
So gerät der Akt der Zerstörung wider Willen zu einer britischen Verbeugung vor der Qualität dieses »Supercars«, das eigentlich zu solide ist für dieses Orchideenfach des Automobilbaus. In einer anderen Sendung gibt sich Clarkson mit seiner Abneigung weniger Mühe. Eigentlich, so spottet er, sei der Porsche 911 ein Käfer mit Sportschuhen. Der Motor im Heck eine Absurdität, als würden bei einer Kutsche die Pferde hinten angezäumt, um Menschen und Gepäck durch die Gegend zu schieben. Das eigenwillig Teutonische des Sportwagens wird als Monstrosität gefürchtet, bewundert und bestaunt. Am anderen Ende des Erdballs ist die Exotik des Fahrzeugs potenziert. In Japan verwandelt ein kettenrauchender Tuner betagte und weniger betagte Elfer in Haikus unter Verwendung der deutschen Sprache. Abgekürzt heißt Akira Nakais Unternehmen RWB. Die drei Versalien stehen für »Rauh Welt Begriff«, eine Zeile konkreter Poesie, die hierzulande für Verwirrung sorgen könnte, die aber in Japan für eine der freisinnigsten Arten des Autotunens stehen. Während die aus Filmen wie »The Fast and the Furious« bekannte Tuning-Szene vor allem asiatische Fahrzeuge modifiziert, besitzt der Porsche 911 etwas doppelt Exotisches: Er ist nicht nur europäisch, sondern deutsch. »Sekund Entwicklung« fantasiedeutscht es da auf wuchtigen Heckspoilern der RWB-Porsche. Und alle von Akira Nakai getunten Fahrzeuge haben einen Aufkleber am oberen Rand der Frontscheibe, auf der »Rauh Welt« zu lesen ist. Zur skulpturalen Gestaltung der breiter, tiefer und hysterischer veredelten Porsche Elfer kommt eine theatralische Sprache, die in Tokio wohl nur ein paar Mitarbeiter des Goethe-Instituts und Germanistikstudenten verstehen werden. Johnson, Clarkson und Akira Nakai aber eint ihre Agitiertheit durch ein Produkt, das nicht nur einzigartig, sondern eben auch einzigartig deutsch ist. Deutsch wird für den in Interviews eher wortkargen Schrauber zu einer Hubraumerweiterung seiner Fantasie und zum Drehzahlverstärker der Mythologisierung jenes Sportwagens, der weltweit als eine der fünf großen Motorsportlegenden gilt. Dem teutonisch puritanischen Gefährt nimmt Akira Nakai seine Strenge und lässt es mit monströsen Heckflügeln, Radkästen und ultrabreiten Slicks zu einem Fabelwesen werden, das in Verkennung der Realität die Straßen dieser Welt mit einer unendlichen Rennstrecke verwechselt. Aus dem deutschen wird ein globaler Paradiesvogel.
Seinen deutschen Kern pflegt er stolz und aufgrund der historischen Verwicklungen mit den düstersten Ecken der Geschichte nicht ohne Mühen. Damit erreichte Porsche auch dafür schwierige Märkte, wie den amerikanischen an Ost- und Westküste, wo die freiberufliche, kreative und unternehmungslustige Klientel oft auch jüdischer Herkunft ist. »Ich bin Halbösterreicher und habe eine – wenn Sie so wollen – spezielle ästhetische Verbindung zu diesen Autos«, erklärt Jerry Seinfeld. »Wenn ich einen Porsche ansehe, löst er in mir Gefühle aus wie kein anderes Auto. Ich liebe die Geschichte von Porsche und baue die Sammlung so auf, dass diese Geschichte auch erzählt wird. Von den Anfängen in Gmünd bis zu den neuesten Modellen.« Die Nazi-Wurzeln der Firma stören ihn, der auch in seinem Werk seine jüdische Identität betont, nicht. »Die Nazis selbst verstören mich mehr als die Autos, die in dieser Zeit entwickelt wurden. Für mich war der VW Käfer fast schon eine Art Wiedergutmachung am Rest der Welt.«
Der Elfer hat aus seinen Wurzeln nie einen Hehl gemacht, im Gegenteil: Die Ahnentafel des bis heute erfolgreichsten Sportwagens aller Zeiten reicht direkt in die frühen 30er Jahre, als das Unglück zuerst über Deutschland und dann von dort über den Rest der Welt kroch. Inmitten der Weltwirtschaftskrise hatte der damals schon renommierte Ingenieur Ferdinand Porsche in Stuttgart ein Konstruktionsbüro eröffnet, aus dem im April 1931 die »Dr. Ing. h.c. F. Porsche Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Konstruktion und Beratung für Motoren- und Fahrzeugbau« wurde. Zusammen mit seinem Schwiegersohn Anton Piëch und bald auch seinem Sohn Ferry arbeitete er als Ingenieurdienstleister für Autofirmen wie Wanderer, NSU oder Zündapp. Für Letztere ging es in den Aufträgen um die Entwicklung eines Kleinwagens, der auch in Krisenzeiten massenhaften Absatz finden könnte. Am anderen Ende der Auftragspalette standen die Konzeption von Hochleistungsmotoren und die Entwicklung eines Formel-Rennwagens für die Auto Union. Porsche interessierte sich stets für beides, wobei auch als Ingenieur bei Austro Daimler und Mercedes-Benz seine Neigung für sportliche Fahrzeuge immer deutlich zu erkennen war. Beeindruckt habe ihn, so sein Enkel Ferdinand Piëch, wie Bugatti leichte Rennwagen mit leistungsfähigen Motoren kombinierte und so das Beste aus beiden Welten vereinte. Für Austro Daimler konstruierte Porsche mit dem »Sascha« einen Rennwagen in Leichtbauweise mit einem Motor, der mit spärlichen 1,1 Litern Hubraum auskam. Dieser nach Graf Sascha Kolowrat-Krakowsky getaufte Wagen war eine entscheidende Wegmarke in der Entwicklung des späteren Volkswagens. Der Spagat zwischen Alltag und Rennstrecke prägte Porsches Leben früh und wurde mit den ersten Porsche-Sportwagen ab 1948 ideal geschlossen, durch seinen Sohn Ferry, der das Lebenswerk seines Vaters in dessen Sinne fortführte.
Die Arbeiten an niederpreisigen Kleinwagen und exklusiven Rennwagen führte im Konstruktionsbüro in Stuttgart zu einer Kompetenzanhäufung in einer ungewöhnlichen Kombination. Ferdinand Porsche ahnte, dass die Verbindung dieser bis dahin sich weitgehend unversöhnt gegenüberstehenden Autogenres eine Chance sein könnte. Doch die Zeit dafür war noch nicht reif. Die Grundkonzeption des ersten Porsche, der 1948 auch so genannt werden durfte, war bereits in dem Kleinwagenentwurf für NSU, genannt Typ 32, vorhanden: Er besaß ein Fließheck und einen Vierzylinder-Boxermotor im Heck, der luftgekühlt war. Nach der Machtergreifung der Nazis und des ziemlich autoverrückten Führers präsentierte Ferdinand Porsche im Januar 1934 seine Vorstellung eines »Deutschen Volkswagens«. Wichtig war ihm dabei neben Windschnittigkeit, technischer Innovation und einem bezahlbaren Preis ein neues Grundverständnis des Volkswagens: Er sollte – wie Porsche in einem Exposé für das Reichsverkehrsministerium ausführte – keine Schrumpfform eines großen Wagens sein, sondern etwas ganz Eigenes auf der Höhe der Zeit. Die Verwendung für das Militär deutete er lediglich in einem Nebensatz an. Wenig später nach der selbstbewussten Bewerbung erhält die kleine Stuttgarter Manufaktur vom Reichsverband der Automobilindustrie (RDA) den Auftrag zum Bau dieses Kleinwagens. Aufgrund der unzähligen Vorarbeiten und Prototypen, die Porsche bis dahin schon entworfen hatte, konnte bereits ein Jahr später eine Art Ur-Käfer vorgestellt werden. Ende 1935 wurden der erste und der zweite Versuchswagen in München Adolf Hitler präsentiert, der ziemlich begeistert war.
Weniger begeistert war die Konkurrenz über den neuen Liebling des Führers und die kleine Ingenieursbutze in Stuttgart, die dabei war, den vielleicht größten Auftrag der 30er Jahre zu bekommen. Die Missgunst störte Porsche kaum. Unbeirrt reist er in die Vereinigten Staaten, um dort bei Ford und General Motors zu studieren, wie effizient und zügig Kleinwagen produziert werden können. Im Mai 1937 wird in Berlin die »Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens mbH«, kurz GeZuVor, gegründet. Ferdinand Porsche wird einer der drei Geschäftsführer und soll sich im noch zu gründenden Volkswagen-Werk um Planung und Technik kümmern.
Doch Porsche ist keineswegs mit den Anfängen von VW absorbiert und so vergrößert...