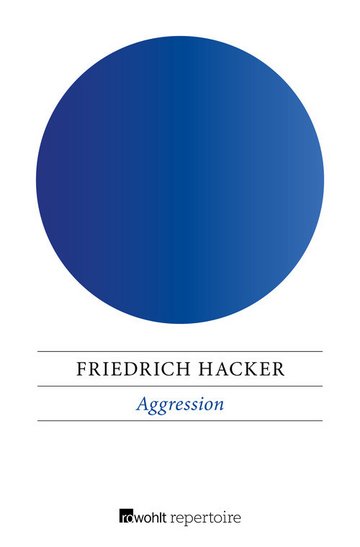Vorwort von Konrad Lorenz
Ich verstehe viel zuwenig von Psychoanalyse, um wirklich dazu berechtigt zu sein, ein Vorwort zu dem Buch eines Psychoanalytikers zu schreiben. Meine Meinungen werden sicher einseitig sein, vom Standpunkt der vergleichenden Verhaltensforschung aus gefaßt. Aber dieses Vorwort gibt Gelegenheit zu einem reuigen Geständnis: Ich hegte jahrelang ein schweres Vorurteil gegen die Psychoanalyse, obwohl – oder vielleicht weil – ich meine psychologische Ausbildung in Wien empfing und in dem von den Professoren Bühler und Pötzl gehaltenen Seminar viel mit Psychoanalytikern in Berührung kam. Was mich damals aufs heftigste abschreckte, war der Umstand, daß Freuds Anhänger ganz offensichtlich keine Schüler, sondern Jünger waren. Sie gaben dies auch ganz offen zu, indem sie von ihm als «dem Meister» und von allen seinen Aussagen wie von völlig unbezweifelbaren Offenbarungen sprachen. In der Wissenschaft aber ist es, wie mir schon damals völlig klar war, die erste Pflicht des Schülers, die empfangene Lehre zu kritisieren. Gerade wenn der Lehrer ein großes Genie ist und neue Erklärungen und Erkenntnisse errungen hat, ist es sein Prärogativ, die gefundenen Erklärungsprinzipien zu überschätzen. Dann ist es Sache seiner weniger genialen Schüler, Mitarbeiter und Freunde, seinen Geistesflug kritisch zu überwachen und ihn vor dem Schicksal des Ikarus zu bewahren. Die anbetende Haltung, die alle mir bis dahin bekannten Psychoanalytiker ihrem Meister gegenüber einnahmen, veranlaßte mich, nicht ganz zu Unrecht, der Psychoanalyse den Charakter wissenschaftlicher Forschung abzusprechen. Was mich außerdem zu diesem harten Urteil veranlaßte, war die wissenschaftlich nicht begründbare Ausschließlichkeit, mit der die Psychoanalytiker das analytische Gespräch mit dem Patienten als alleinige Wissensquelle betrachteten und alle anderen ablehnten.
Erst Jahre später, als in meiner eigenen Forschung die Spontaneität instinktiver Antriebe zum zentralen Problem aller Untersuchungen geworden war und als ich, im Verein mit Erich von Holst, an dem Kampf gegen die alles beherrschende Lehre vom Reflex als einzigem Erklärungsprinzip teilzunehmen begann, wurde mir die Größe Sigmund Freuds klar. Zu einer Zeit, da es niemandem einfiel, an der absoluten Richtigkeit der Sherringtonschen Lehre vom Reflex sowie an der Pawlowschen Lehre vom bedingten Reflex auch nur die geringsten Zweifel zu hegen, erkannte Freud klar, daß die Antriebe des Verhaltens nicht re aktiv sind, daß sie nicht wie ungebrauchte Maschinen und wie Reflexe passiv des Reizes von außen her harren, der sie in Gang setzt, sondern daß es ganz im Gegenteil der aktiven Aufwendung von Energie bedürfe, um ihre Auswirkungen wenigstens zeitweise zurückzudämmen. Erst jetzt ahnte ich in Sigmund Freud den großen Helfer und Bundesgenossen im Kampf gegen das bereits zur Ideologie gewordene Erklärungsmonopol des Reflexes und der bedingten Reaktion.
Der erste Analytiker aber, dessen Fragestellungen und Methoden uns, den vergleichenden Verhaltensforschern, klarmachten, wie nahe verwandt die Probleme der Psychoanalyse und der Ethologie im Grunde genommen sind, war René Spitz. Er untersuchte das Lächeln des menschlichen Säuglings mit Hilfe von Attrappen, er quantifizierte die spontane Produktion von Saugbewegungen durch Zählen von Leerlaufbewegungen, kurz, er hatte die wesentlichen Fragestellungen und Methoden der Ethologie unabhängig für sich entwickelt, und zwar auf Grund von unvoreingenommener Beobachtung. Wenn dieser Mann viele Erkenntnisse Sigmund Freuds auf Grund seiner unabhängigen Erfahrungen zwar teilweise kritisierte, im Ganzen aber für grundsätzlich richtig hielt, hatte dies für mich mehr Gewicht als die Predigten der gläubigen Jünger. Ich begann aufs neue, mich mit Psychoanalyse zu beschäftigen.
Im Jahre 1960/61 hatte ich meine Meinung über sie so weit berichtigt, daß ich eine Einladung der Menninger Clinic annahm, als Sloan Professor nach Topeka zu kommen. Ich tat dies mehr, um dort zu lernen als zu lehren. Unter den Analytikern der Menninger Clinic traf ich eine ganze Reihe von Männern an, auf die meine Vorurteile nicht zutrafen, die ich vielmehr als ernst zu nehmende Wissenschaftler und Forscher gelten lassen mußte. Unter ihnen war Friedrich Hacker, der ebenfalls als Sloan Professor tätig war. Als einzige Wiener im weiten Middle West freundeten wir uns bald an, und ich habe von ihm sehr viel über Psychoanalyse gelernt, über ihr Wesentliches und ihren Wahrheitsgehalt so gut wie über die Schwächen ihrer Theorie. Er war fürwahr kein Jünger, der die Worte des Meisters unkritisiert als Offenbarung nachbetete! Sein scharfer Geist und sein ebenso scharfer Humor, dem immer etwas bubenhaft (die Zensur hat hier die Vorsilbe «laus»- gestrichen) Respektloses anhaftet, machten vor den Theorien des Meisters keineswegs halt. Aber gerade dadurch kam ihr Wahrheitsgehalt oft besonders klar zutage. Niemals vorher zum Beispiel war mir der Freudsche Begriff des Ich und seine Funktion des Vermittelns zwischen den Trieben und dem Über-Ich so deutlich geworden wie damals, als Hacker es mit jener sprichwörtlich gewordenen Figur des österreichischen Amtslebens verglich, dem stets etwas kläglichen und bedauernswerten «Beschwichtigungs-Hofrat».
Einer der Gründe, die mich veranlaßten, nach Topeka zu gehen, war mein Wunsch, mit Psychoanalytikern über die Freudsche Gleichsetzung von Aggression und Todestrieb zu diskutieren, gegen die ich schwere Einwände hatte, da mir seit langem klar war, daß Aggressivität an sich ein ebenso lebenswichtiger und ebenso unabhängiger Antrieb tierischen und menschlichen Verhaltens sei wie Hunger, Furcht und Sexualität. Ich erkannte bald, daß ich mit meiner Theorie der Aggressivität an der Menninger Clinic offene Türen einrannte.
Die Stärke und der konstruktive Charakter der Kritik, die Friedrich Hacker der Freudschen Trieblehre und insbesondere den Freudschen Anschauungen über die Aggression angedeihen läßt, sind sicherlich zum großen Teil dem Umstand zu danken, daß er neben dem analytischen Gespräch noch andere Wissensquellen ausbeutet. Hacker ist Psychiater, Professor für Psychiatrie an der University of Southern California, außerdem Gerichtspsychiater und Spezialist für Jugendkriminalität. Ich hörte in Topeka ein Seminar von ihm, in dem er die neurotische Seite gewisser rebellierender Jugendlicher, die damals Beatniks hießen, mit einer glücklichen Kombination von Sympathie und einsichtiger Kritik behandelte. Friedrich Hacker kennt die menschliche Natur von sehr verschiedenen Seiten her, er betrachtet sie mit einfühlendem Wohlwollen, das er bei seiner profunden Illusionslosigkeit nur durch seinen stets etwas satirisch gefärbten, Nestroy-ähnlichen Humor aufrechtzuerhalten vermag. Auch über tierisches Verhalten vermag er mitzureden, wie ich anläßlich eines Seminars über Instinkt innewurde, an dem wir beide neben Harry Harlow, Karl Menninger, Margaret Mead und anderen teilnahmen. Wer die Ansichten der genannten Forscher kennt, kann sich vorstellen, daß die Diskussionen mehr als lebhaft waren. Friedrich Hacker und ich fanden uns erstaunlich oft auf derselben Seite des Treffens widerstreitender Meinungen, und besonders dann, wenn das aggressive Verhalten von Mensch und Tier den Gegenstand der Disputation bildete.
Ich kenne also Friedrich Hackers Anschauungen über die Natur der Aggression ziemlich gründlich, und dies berechtigt mich dazu, dieses Vorwort zu schreiben. Die wesentliche Erkenntnis, die ihm in meinen Augen einen großen Teil seines Wertes verleiht, ist die folgende: Der Umstand, daß Aggressivität durch verschiedene Umgebungseinflüsse in gesetzmäßiger Weise als Re-aktion ausgelöst werden kann, ist kein Argument gegen die durch viele Gründe gestützte Annahme, daß sie, wie alle anderen Instinkte auch, ihren besonderen spontanen Antrieb hat. Das Argument, daß die Aggression, vor allem die menschliche, deshalb keinen derartigen Antrieb haben könne, weil sie durch Angst, Stress und Frustration usw. in gesetzmäßiger Weise ausgelöst werde, ist genauso abwegig, als wollte jemand behaupten, die Sexualität des Menschen könne keinen spezifischen und spontanen Antrieb haben, weil sie nachweislich durch bestimmte, vom anderen Geschlecht ausgehende Reize ausgelöst werde. Wenn gescheite Leute bezüglich der Aggression hartnäckig Ansichten dieser Art vertreten, so läßt sich dies nur aus tief eingefressenen Vorurteilen erklären. So mancher sonst durchaus ernst zu nehmende Forscher verhält sich nach dem Vorbild von Christian Morgensterns Palmström und «schließt messerscharf, daß nicht sein kann, was nicht sein darf». Auf diesen a-logischen Schluß folgt dann meistens die ideo-logische Attacke: es wird nämlich demjenigen, der das aggressive Verhalten so darstellt, wie es wirklich ist, alsbald mit großer moralischer Überheblichkeit vorgeworfen, daß er in höchst gefährlicher Weise jegliche Aggression entschuldige und sich zum Verteidiger des Völkermordens mache! Was in Wirklichkeit eine ernste und dringende Warnung vor Gefahren ist, die Menschheit und Menschlichkeit bedrohen, wird so in eine satanische Apologie des Bösen schlechthin umgefälscht.
Vorwürfe dieser Art werden auch diesem Buch nicht erspart bleiben, denn es stellt sich tatsächlich die Aufgabe, die Aggressivität des Menschen so darzustellen, «wie sie wirklich ist», das heißt ohne Voreingenommenheit und ohne Vereinfachung. Die pathologische Fehlfunktion der Aggressivität wird zur Wissensquelle, die zu Aussagen über die normale, arterhaltende Leistung befähigt, die dieser Trieb im komplexen Wirkungsgefüge menschlicher Antriebe zu erfüllen hat. Das Studium der menschlichen Motivationen zeigt so manche Analogien zu dem der endokrinen Drüsen...