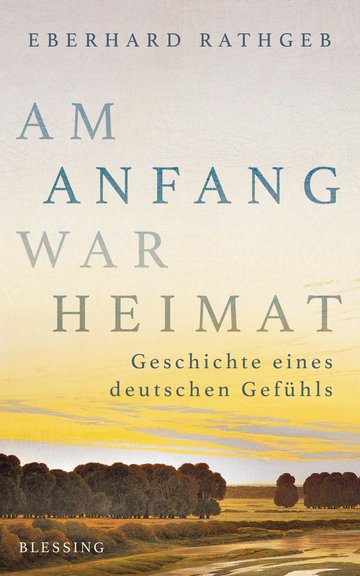2
EIN GEFÜHL FÜR DEUTSCHLAND
Deutschland ist ein gutes Land, dachte mein Vater ohne jede Leidenschaft, und er sagte das nicht, weil es sich von selbst verstand, und wenn da einer gewesen wäre, dem er das erst hätte sagen und erklären müssen, mit dem hätte er nicht lange geredet. Wer das nicht sah und nicht merkte, wo lebte der, dachte er und schwieg, erfüllt von der Ruhe eines jahrzehntelangen Einverständnisses, vom Gefühl der Zugehörigkeit. Unmöglich oder ungeheuerlich wäre es für ihn, wenn einer schlecht über das Land redete, und sobald er darüber nachdachte, regte er sich auf, aber dann sagte er bloß: Ach, und winkte mit der Hand ab. Und wir Kinder dachten, er führt wieder Selbstgespräche, jetzt bricht er die Diskussion ab, gleich steht er auf und geht, weil es sich nicht lohnt, mit so einem, der nichts versteht, weiterzureden. Auch der Blick aus dem Fenster weckte in ihm keinen Zweifel am Leben in Deutschland. Weder die monotonen Einfamilienhäuser noch ihre Vorgärten und die Supermärkte, noch die Menschen, die hier wohnten, irritierten ihn, von einigen Ausnahmen abgesehen. Auch die Kinder störten sich nicht daran und spielten im Garten Fußball, gingen die Straße hinunter zur Schule, den Ranzen auf dem Rücken, fuhren mit dem Fahrrad zum Schwimmbad, und wenn ein Einkauf im Supermarkt anstand, waren sie sofort dabei und drängelten sich zwischen den Regalen und holten sich ihre Tüten mit Süßigkeiten.
Mein Vater ertrug das Leben stoisch, als sei es gut so, wie es war, oder als hätte er keine Wahl, als sei das Leben, wie es sich ihm zeigte, nicht zu ändern. Und wie ihm erging es den anderen auch, sie machten allesamt einen zufriedenen Eindruck: Familie, Arbeit, Haus, Garten, Auto. Er setzte voraus und forderte, dass Gesetze, Regeln und Konventionen eingehalten wurden und nannte das: sich benehmen können. Selten hörte er Musik, am liebsten Beethoven, und dann konnte es passieren, dass er mitten im Wohnzimmer stand, den Kopf nach vorne gebeugt, den einen Arm angewinkelt, die Finger der Hand ausgestreckt, und diese Gerade ging im Takt auf und ab, und er sagte dazu leise, Tack, tack, tack, er dirigierte ein unsichtbares Orchester, er ordnete seine Welt und vergaß die Politik, die ihn immerzu auf Trab hielt, ging es doch um sein Land.
Nur auf dem Sterbebett dachte er nicht mehr daran, dass die Regierung sich des Landes als würdig erweisen und das Richtige tun sollte. Die Verantwortlichen müssten nur vernünftig sein, dachte er, dann wäre alles einfach und das Land würde nicht kaputt gehen, nicht zerstört werden wie ein Haus, das zusammenfiel, weil die Bewohner es verrotten ließen. Diese Sorge trieb über mehrere Flüsse bis an die Landesgrenzen und darüber hinaus. Der Satz, der sich anschloss und als halbe Portion in der Luft hängen blieb, lautete: Wenn die Menschheit nur vernünftig wäre … Darauf schwieg er, weil die Annahme keinen Sinn machte, und die Folgen aufzuzählen erübrigte sich für ihn, er war kein Träumer, der glaubte, dass es irgendwann keine Kriege mehr geben werde, keinen Hunger, kein Leid und keine Not.
Er hielt die Zeitung in den Händen aufgeschlagen vor sich, ein Dach, ein Zelt, unter dem er für Stunden verschwand, zur Hälfte unsichtbar geworden, ein Denkmal des informierten Bürgers, und las jeden Satz, aus Interesse an der Gegenwart, um ein Teil von etwas Größerem zu werden, und weil er wissen wollte, was um ihn herum geschah, mit ihm und in seinem Sinne oder gegen seine Vorstellungen. Er vertiefte sich in die Zeitung auch, um die Zeit bis zum Mittagessen totzuschlagen und der Enge zu entkommen, in die das Alter ohne Beruf ihn geführt hatte. Diese Stunden waren für ihn die besten am Tag. Auf sie freute er sich, er verließ das Haus, ohne sich bewegen zu müssen, er kam durch die Welt, er traf auf Menschen, die wichtig genug waren, dass über sie berichtet wurde. Er vergaß sich selbst, wo er war und wie alt er war. Wenn er die Zeitung beiseitelegte, wurde das Leben schwieriger, es gab für ihn nichts zu tun, nichts Notwendiges, Sinnvolles, keine Arbeit.
In den Regalen standen Bücher, traurig und stumm, Überbleibsel einer anderen Lebensverbundenheit. Er las keine Bücher mehr, dafür hatte er keine Zeit, nicht einmal wenn er sich langweilte und mit sich nichts anzufangen wusste. Die Zeit, die ihm noch blieb, ging schnell dahin, er musste mit ihr haushalten und vorsichtig mit ihr umgehen. Romane waren in dieser Zeitnot eine Provokation, historische Werke ein Affront für einen, der kaum noch Leben und Zukunft besaß, er würde den Rest seiner Tage nicht anderen Geschichten, auch nicht der Vergangenheit opfern, und so machte er sich regelmäßig für einige Stunden daran, die Zeit selbst, wie sie in der Gegenwart sich zeigte, zu verfolgen, das Zeitgeschehen. Er schüttelte den Kopf, wenn Politikern Fehler unterliefen, er ärgerte sich, wenn sie kein Einsehen hatten und nicht verstanden, was sie falsch gemacht hatten, wenn sie nicht sahen, was zu tun war, und er regte sich auf, wenn erkennbar wurde, dass sie dem Land mit Absicht schadeten. Langsam arbeitete er sich in der Zeitung voran, Spalte für Spalte, von Deutschland in die Welt, in Gegenden, wo Leid, Not und Hunger herrschten und Kriege geführt wurden, und kaum ging es auf dem einen Flecken Erde wieder besser, fing auf einem anderen ein Übel an. Er saß geschützt in seinem Haus, bedroht nur vom eigenen Verfall, von Krankheit und Tod, dem normalen Lauf der Dinge, gegen den sich nichts machen ließ. Dankbarkeit erfüllte ihn, Demut, dass er hier war und nicht in einem Land der Katastrophen und Bürgerkriege.
Alles, was aus ihm wurde, wäre anders gekommen, wenn er nicht hier und in jenem, seinem Jahrzehnt im letzten Jahrhundert geboren worden wäre. Auch er selbst wäre ein anderer geworden. Ein Großteil dessen, was er als Gefühl von sich selbst in sich trug und was er kaum beschreiben konnte, es war diffus und schwierig zu greifen, hatte er Deutschland zu verdanken, der Region und der Zeit, in der er aufwuchs, sowie seinen Eltern, die Deutsche waren und aus jener Region stammten, keine Zugezogenen, sondern Eingewachsene. Diese feinfaserige Ausstattung der Seelen war auf den alten Fotografien, die er nicht mehr anrührte, nicht zu sehen. Auf ihnen war nichts Bedeutsames zu erkennen. Er wusste, was fehlte, er hatte es ja erlebt.
Hinzu kam, dass sein Leben vorbei war, die Erinnerungen taugten zu nichts mehr. Er zählte die Zeit, die ihm blieb, in Tagen, so eng war die Aussicht geworden. Noch hundert Tage, dachte er, um sich Mut zu machen. Er sagte nicht, noch einen Frühling oder noch einen Sommer, wenn der Frühling oder der Sommer gerade vorüber waren. Das wäre Selbstbetrug gewesen, und eine Jahreszeit, an deren Anfang er stand und die seine Hoffnung gleich erfüllt hätte, war zu kurz, um auf diese Länge hin dem Leben noch Vertrauen schenken zu können. Wie schnell gingen ein Sommer und ein Herbst vorbei, und dann wusste er nichts mehr von ihnen, und wie traurig musste ein Sommer sein, von dem er annehmen musste, dass es der letzte sei. Ein Tag war ein gutes, flüchtiges und blasses Maß, es versprach Gegenwart, Halt, im besten Falle Fülle, dass ihm noch etwas Zeit blieb, mehr als er mit den Fingern einer Hand, beider Hände zeigen konnte. Noch viele Tage würden kommen, was war damit verglichen ein einziger Tag, er löste sich aus der Nacht und verschwand wieder dorthin zurück.
Mein Vater wollte wissen, was in dem Land passierte, in dem er lebte, was vor sich ging auf der Welt, deren Teil Deutschland war. Der Gedanke an den Tod, der in den leeren Stunden, die nicht mit den Nachrichten aus der Welt zu füllen waren, heranrückte, war jetzt weit weg, die Zeitung hatte ihn vertrieben. Das schaffte kein Gedicht. Das Land lag da, reich und schwer, und er war mittendrin.
Jeder wird sich vor dem Tod zu verstecken versuchen, wird in den Wald rennen und sich im Unterholz vergraben, die Lippen zusammenbeißen und die Tränen hinunterschlucken und hoffen, dass der Tod ihn nicht findet. Aber der Tod sieht und hört alles, und es ist so, als hätte sich einer, der klein ist, vor vielen, die groß sind, versteckt, er hat keine Chance, es sind einfach zu viele, die nach ihm suchen, sie werden ihn finden, aber er gibt die Hoffnung nicht auf, die Zuversicht, dass er entwischt, ist zäh, bis der Tod vor ihm steht und sich zu ihm hinunterbeugt, ganz so, als sei er ein lieber Onkel, der nur Gutes tut, und ihn fragt, ob er nicht hervorkommen wolle, na mach schon. Der kleine Mensch in seinem Versteck, so groß wie ein Bett, fühlt sich immer noch sicher, er redet sich ein, dass der Tod ihn nicht aus dem Unterholz herausziehen kann, er hat sich doch so tief darin vergraben, und wenn der Tod einsieht, dass alle Mühe vergeblich ist, dann wird er weitergehen und ihn hier zurücklassen und vergessen. Aber der Tod gibt nicht nach, und er gibt auch nicht auf, er schiebt die Hand durch das Unterholz und packt den kleinen, zitternden Menschen und zieht ihn hervor, klemmt ihn sich unter den Arm und geht mit ihm davon, und eine Zeitung rutscht vom Stuhl, ein Buch bleibt aufgeschlagen auf dem Bett liegen, eine Flasche fällt um, und der Wein kleckert auf das Kleid der toten alten Frau, ein Klavierkonzert hört nicht abrupt auf, nur weil keiner im Zimmer mehr zuhört, und ein Fernseher läuft weiter, obwohl keiner mehr zusieht, auch nicht das Häuflein Mensch, das dort im Sessel sitzt, und die zusammengerechten Blätter werden vom Wind hochgewirbelt und wehen über den toten alten Mann dahin.
Dass er eine Heimat hatte und sie ihm viel bedeutete, spürte mein Vater das erste Mal, als er sie 1929, er war ein kleiner Junge, verlassen musste. Weder mit den Eltern...