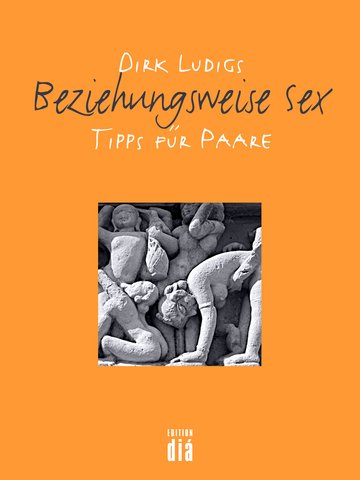Oversexed and Underloved
Die Welt weiß von Wichtigerem als Sex. Essen, Trinken, Kindern ein glückliches Zuhause schenken beispielsweise. Armut bekämpfen. Unser Klima retten.
Nun gut, das war ein Versuch. Realistischerweise ist Sex zwar nicht alles, doch ohne ihn alles nichts. Das ist nicht nur naturgegeben, an diesem Eindruck wird von interessierten Kreisen auch schwer gearbeitet. Denn Sex ist ein Wirtschaftsfaktor. Seit mehr als dreißig Jahren kommt unser Sexleben, meist unser gestörtes, nicht mehr aus den Schlagzeilen. ›Spiegel‹, ›Max‹ und Konsorten titeln »Titten«, wann immer die Auflage zu sinken droht. Kein TV-Magazin ohne bewegtes Fleisch, und wenn es sich nicht von alleine bewegt, bewegt sich zumindest die Kamera. Wir werden schon hingucken. Selbst dass Sex ein Thema ist, ist den Medien bereits meldenswert. Dann stehen die Alten vorm Zeitungsladen, lesen, verdrehen die Augen und sagen: »Die Welt weiß wahrlich von Wichtigerem!« Und denken an Clark Gable, Marilyn Monroe und Vico Torriani. Und die Jüngeren gehen rein und lesen den ganzen Artikel zweimal.
Er wird uns klarmachen, wie übersättigt wir sind; dass wir es nicht mehr hören können; dass Singles mit viel Aufwand wenig Sex haben und Paare ohne viel Aufwand gar keinen; dass Seitensprünge eine Lösung sind, aber Probleme mit sich bringen. Denn wer will schon »fremdgehen«? »To cheat« sagen die Amerikaner wie die Deutschen noch heute dazu: »betrügen«. Klingt eher nach Lösungsmittel als nach Lösung.
Dann doch lieber »Gabi allein zu Haus«. Immer mehr Menschen behalten es sich auch in ihrer Beziehung vor, den eigenen Fantasien hinterherzuonanieren. Wahrscheinlich ist Selbstbefriedigung ohnehin die gängigste Sexpraktik überhaupt. Denn eines lässt sich schwerlich ändern oder bestreiten: Die Beziehung zu sich selbst ist eine lebenslange, und »Masturbation Sex mit jemandem, den du liebst« – der Satz stammt von Woody Allen. Wer nicht einmal sich selbst liebt, und auch das scheinen immer mehr zu werden, lässt die Hände im Schoß ruhen.
Die wirklich neue universale Lustseuche unserer Tage ist eine grassierende Sexmüdigkeit, glaubt man dem reichlich vorhandenen Zahlenmaterial. Allerdings war der Mensch auch noch nie so gut und intensiv untersucht. Und bei der historischen Einordnung gilt es immer zu berücksichtigen, dass von dem, was wir hinterlassen, auf das geschlossen wird, was wir taten. So wird die Geschichte dennoch angesichts der Flut an einschlägigen Veröffentlichungen zum Thema von unserer als einer recht lustbestimmten Epoche sprechen. Aber Geschichtsschreibung und Leben sind zwei verschiedene Paar Stiefel. John Gagnon kommt am Ende einer Studie über das Sexualverhalten der US-Amerikaner Mitte der neunziger Jahre zu dem Schluss, große Teile der Hetero-Welt seien sexuell »sehr inaktiv«, Studien in Frankreich und England von 1993 und 1994 unterstreichen das, und der deutsche Sexualforscher Gunter Schmidt berichtet von einem dramatischen Anstieg der Zahl von Frauen und Männern, die wegen Sexmüdigkeit das Therapiegespräch suchen: In den zehn Jahren von 1984 bis 1994 stieg unter den Sextherapie-Suchenden der Anteil der »lustlosen« Frauen von zehn auf sechzig Prozent, bei Männern immerhin von fünf auf fünfzehn Prozent.
Die Zahlen beziehen sich auf Heterosexuelle. Schwule und Lesben scheinen von dieser Seuche ausnahmsweise einmal nicht betroffen zu sein, ein Hinweis darauf, dass die Krise etwas mit dem Verhältnis der Geschlechter zu tun haben muss. Ein Verhältnis, das in den letzten vierzig Jahren einigen Prüfungen ausgesetzt war – das Gepäck der letzten Jahrtausende wiegt allerdings auch schwer. Vermuten lässt sich, dass in erster Linie ein paar Erwartungen zu hochgesteckt sind. Die Erwartung zum Beispiel, dass in einer Zeit, in der das Verhältnis von Männern und Frauen sich mehr denn je im Umbruch befindet, ausgerechnet der Sex funktionieren soll.
Beziehung zurechtgelogen – erfolglos
Die jüdisch-christliche Tradition hat unsere Sexualität über mindestens zwei Jahrtausende mehr oder weniger erfolglos in das Zwangskorsett der von Männern geführten, monogamen Ehe einzusperren versucht. Diese »Leitmoral« erlebt seit dem späten 19. Jahrhundert, den Anfängen der Frauenbefreiung, einen schleichenden Zerfallsprozess. In den sechziger Jahren hat diese Entwicklung enorm an Tempo gewonnen und wird heute von immer weniger Menschen noch ernsthaft bekämpft. Motor war und ist die Selbstbefreiung der Frauen, der quälend langsame, aber unaufhaltsame Niedergang des Patriarchats in der westlichen Welt. Zugegeben, was die Unaufhaltsamkeit angeht, so ist darüber noch nicht endgültig entschieden, aber weit wesentlicher ist: Mit dieser ständig voranschreitenden Neuordnung des Verhältnisses der Geschlechter müssten wir eigentlich auch unsere Ideen über den Zusammenhang von Ehe und Partnerschaft einerseits und romantischer Liebe und sexuellen Wünschen andererseits neu definieren. In diesen Bereichen aber, so scheint mir, herrscht weithin tote Hose.
Ehre, wem Ehre gebührt. Es ist das Verdienst des Hamburger Psychotherapeuten Michael Mary, in seinem Buch ›Fünf Lügen, die Liebe betreffend‹ endlich auch den Heterosexuellen klargemacht zu haben, was viele Homosexuelle schon lange wussten, hauptsächlich weil sie ihre Sexualität zwangsläufig und lange genug nur außerhalb legitimierter Beziehungen leben durften, nicht weil sie so viel schlauer oder weniger romantisch wären als Heterosexuelle: Eine erfüllte Sexualität ist in einer Partnerschaft nicht das Maß der Liebe. Was immer Sexualität und Beziehung miteinander zu tun haben: Das eine ist nicht Voraussetzung für die Erfülltheit des anderen.
Die Idee der Einheit von Sex, Liebe und Lebenspartnerschaft entstammt vielmehr den Hirnen von interessierten Männern (und gerade die Frauen glauben daran, super), die sich allein dadurch qualifiziert glaubten, dass sie praktisch nichts mit dem Thema zu tun hatten, etwa Kirchenfürsten. Sie wird bis heute wiederholt von Politikern, Psychologen, Therapeuten, Filmregisseuren und Schlagertextern, hauptsächlich zur Mehrung und Festigung ihrer Macht oder ihres Reichtums. Die gängige Idee, erfüllter Sex sei ausschließlich in der festen, heterosexuellen Zweierkiste möglich, und ihre Schwester »Wenn es mit dem Sex nicht klappt, ist mit der Beziehung etwas nicht in Ordnung« werden trotz aller Vermarktung des Sexuellen bis heute als Mittel benutzt, direkten Einfluss und Kontrolle auszuüben. Warum sonst behaupten all die Männer in den schlecht sitzenden Anzügen, die »Homosexuellen-Ehe« sei das Ende der abendländischen Kultur, während sie zu »Vergewaltigung in der Ehe« gleichzeitig vielsagend schweigen? Eben: Es geht um Macht, und zwar um ihre.
Kunst- und Medienmacher wiederum verdienen daran, die romantische Lüge in unseren Köpfen zu zementieren; Psychologen und Therapeuten machen Umsatz mit den eingebildeten Kranken, die gesund genug sind, mit der Lüge nicht leben zu können.
Tatsache ist: Viele langjährige Partnerschaften funktionieren hervorragend, ohne dass die Partner noch miteinander schlafen; außerhalb fester Beziehungen hat Sex schon immer einen großen Reiz gehabt. Umgekehrt zerbrechen viele monogame, sexuell treue Liebesbeziehungen unsinnigerweise daran, dass die Lust nachlässt und das Treueversprechen zur Sollbruchstelle wird, obwohl die Beziehung ansonsten noch Potenzial birgt.
Anders als Sex war Liebe lange Jahrhunderte nicht einmal notwendige Bedingung in Partnerschaftsangelegenheiten. Vor zweihundertfünfzig Jahren hätte eine Liebesheirat genauso viel Neid wie Verwunderung und Stirnrunzeln ausgelöst. Noch unsere Großmütter waren überzeugt, dass der Heirat die Liebe nicht vorwegmarschieren muss: »Die kommt dann schon!«, pflegten sie zu sagen – und manchmal kam sie, manchmal auch nicht. Erst als die Ehe keine wirtschaftliche Notwendigkeit mehr war, konnte die Liebesheirat zum neuen Ideal werden. Leider hält die romantische Liebe der in gesellschaftliche Form gegossenen Verbindung, der Heirat, meist nicht lange stand.
Für Schwule galt das romantische Liebesideal ohnehin nie, denn unser Sex und unsere Beziehungen waren verpönt. Folglich standen viele Schwule und Lesben der Liebeslüge auch nach der schrittweisen Selbstbefreiung kritisch gegenüber. Erst seit den neunziger Jahren breitet sie sich langsam auch unter uns aus, vor allem unter der jüngeren Generation von Schwulen und Lesben. Das haben wir der größeren Sichtbarkeit von Homosexuellen in den Massenmedien zu verdanken, vor allem im Fernsehen, in dessen Soap Operas mittlerweile auch homosexuelle Paare in der Liebeslüge glücklich werden »dürfen«. Dann gibt es noch ein paar fehlgeleitete Lobbyisten, die glauben, dass jeder Schwachsinn, so er denn an Heterosexuellen verübt wird, in gleichem Maße auch Homosexuellen angetan werden müsse – und das für deren Befreiung halten. Wird das Ergebnis Schwule und Lesben glücklicher machen? Ich wage das zu bezweifeln.
Am 30. August 2001, also einen Monat nach Einführung der sogenannten Homo-Ehe, waren mein jetziger Gatte Anthony und ich das dreizehnte Paar im schwulenschwangeren Berliner Bezirk Kreuzberg, das sich lebenspartnerte. Dreizehn Paare nach vierzig Jahren Hochzeitsstau bei geschätzten fünfzigtausend Homosexuellen im Bezirk! Ich würde sagen: Diese Reform ist ein Rohrkrepierer! (Nicht für mich.) Unter den Heiratswilligen in skandinavischen Ländern und den Niederlanden liegt der Anteil der Homosexuellen mit 0,5 bis 1,5 Prozent deutlich unter ihrem Bevölkerungsanteil von fünf bis sieben Prozent. Bei überproportional vielen dieser »Ehewünsche« geht es in erster Linie um das Aufenthaltsrecht für den ausländischen Partner (wie eben auch bei mir). So überraschend das für...