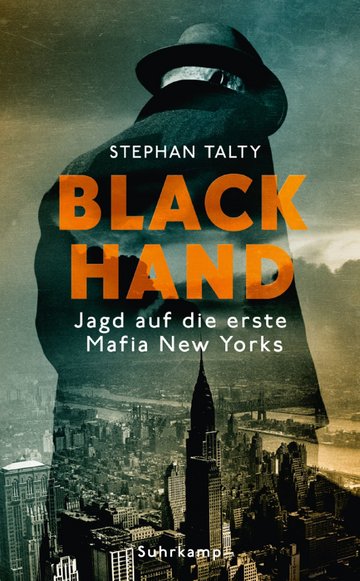Prolog
»Ein gewaltiges, alles verzehrendes Grauen«
Am Nachmittag des 21. September 1906 spielte ein fröhlicher Junge namens Willie Labarbera auf der Straße vor dem Laden des Obstgeschäfts seiner Familie in New York City, zwei Blocks vom glitzernden East River entfernt. Johlend sausten der Fünfjährige und seine Freunde einander hinterher und rollten Holzreifen über den Bürgersteig, lachten, wenn die Ringe auf der gepflasterten Straße umkippten. Schließlich wuselten sie zwischen Bankern, Arbeitern und jungen Frauen mit Straußenfederhüten hindurch nach Hause oder in eins der italienischen Restaurants des Viertels. In jedem neuen Schub Passanten verloren Willie und seine Freunde einander für ein, zwei Sekunden aus den Augen und fanden sich dahinter wieder. Dutzende Male war das an jenem Nachmittag bereits geschehen.
Immer mehr Menschen gingen vorüber, zu Hunderten. Dann, als das Funkeln auf dem Fluss langsam verblasste, wetzte Willie noch einmal um eine Ecke und verschwand in einer Gruppe Arbeiter. Diesmal aber tauchte er nicht wieder dahinter auf. Das fahle Abendlicht beschien nur einen leeren Bürgersteig.
Seine Freunde bemerkten das nicht gleich. Erst als ihre Mägen knurrten, drehten sie sich um und blickten auf das kleine Stückchen Pflaster, auf dem sie den Nachmittag verbracht hatten. Inmitten der wachsenden Schatten hielten sie Ausschau nach Willie. Umsonst.
Willie war ein eigensinniges Kerlchen. Schon einmal hatte er geprahlt, er sei zum Spaß von zuhause weggelaufen, sodass die anderen Jungs womöglich zögerten, ehe sie in den Laden seiner Eltern gingen und berichteten, dass etwas nicht stimmte. Früher oder später mussten sie den Erwachsenen aber doch Bescheid geben. Kurz darauf stürzten William und Caterina, Willies Eltern, aus dem Geschäft und suchten die umliegenden Straßen nach ihrem Kind ab, fragten die Besitzer von Naschbuden und Lebensmittelläden, ob sie den Jungen gesehen hätten. Hatten sie nicht. Willie war verschwunden.
Da geschah etwas Eigenartiges, fast Telepathisches. Noch bevor jemand die Polizei rief oder einen einzigen Hinweis fand, ging Willies Freunden und Angehörigen unabhängig voneinander auf, was dem Jungen zugestoßen war. Und auch in Chicago, St. Louis, New Orleans, Pittsburgh oder den unbedeutenden Städtchen dazwischen wären die Mütter und Väter vermisster Kinder, von denen es im Herbst des Jahres 1906 so ungewöhnlich viele gab, zu demselben Schluss gelangt. Wer ihr Kind hatte? Ganz bestimmt La Mano Nera, wie die Italiener sagten. Der Bund der Schwarzen Hand, die Black Hand.
Die Black Hand war eine berüchtigte Verbrecherorganisation — eine »teuflische, arglistige, finstere Bande« —, die in großem Stil erpresste, mordete, Kinder entführte und Bomben legte. Zwei Jahre zuvor war sie landesweit bekannt geworden, als sie in einem entlegenen Winkel von Brooklyn einen Drohbrief bei einem in Amerika zu Geld gekommenen Handwerker eingeworfen hatte. Seither tauchten die mit Zeichnungen von Särgen, Kreuzen und Dolchen verzierten Briefe des Geheimbunds in der ganzen Stadt auf, gefolgt von grausigen Taten, die einem Beobachter zufolge »in den vergangenen zehn Jahren für eine in der Geschichte zivilisierter Länder in Friedenszeiten unerhörten Verbrechensbilanz« gesorgt hatten. Lediglich der Ku-Klux-Klan sollte zu Beginn des Jahrhunderts die Massen in noch größeren Schrecken versetzen als die Black Hand. »Sie fürchten sie aus tiefstem Herzen«, schrieb ein Reporter über die italienischen Einwanderer, »ein gewaltiges, alles verzehrendes Grauen.« Auch vielen anderen Amerikanern ging das im Herbst 1906 nicht anders.
Als der erste Brief bei den Labarberas einging, wurden ihre Befürchtungen bestätigt. Die Entführer verlangten $ 5 000, für die Familie eine astronomisch hohe Summe. Der genaue Wortlaut ist nicht bekannt, doch enthielten solche Briefe häufig Sätze wie »Ihr Sohn ist bei uns« und »Zeigen Sie diesen Brief nicht der Polizei, sonst, bei der Mutter Gottes, ist Ihr Kind tot.« Ein paar Zeichnungen am Ende unterstrichen diese Botschaft: drei plumpe Tintenkreuze, dazu ein Schädel mit gekreuzten Knochen. Die Markenzeichen der Black Hand.
Manche behaupteten, der Bund und ähnliche Organisationen seien nicht nur verantwortlich für ein bis dato unerhörtes Ausmaß an Mord und Erpressung in Amerika, für ein finsteres Zeitalter unbeschreiblicher Gewalt, sondern agierten obendrein als eine Art fünfte Kolonne, die den Staat für ihre Zwecke untergrub. Dieser Meinung verdankten die Einwanderer aus Italien schon seit mindestens einem Jahrzehnt allerhand Schwierigkeiten. »Viele sind der Ansicht«, sagte Henry Cabot Lodge, Senator aus Massachusetts, über eine angebliche italienische Geheimgesellschaft, »sie breite sich ständig aus, schüchtere Geschworene ein und bringe Schritt für Schritt die Regierungen von Staat und Städten unter ihre Kontrolle.« Skeptiker wie der italienische Botschafter, den schon die bloße Erwähnung des Geheimbunds verärgerte, entgegneten, die Gruppe existiere gar nicht, sei nur ein Märchen, mit dem die »Weißen« die Italiener verunglimpften, zumal sie diese sowieso am liebsten wieder aus dem Land jagen wollten. Ein anderer Italiener witzelte über den Bund: »Seine ganze Existenz beschränkt sich eigentlich auf eine dichterische Phrase.«
Doch wenn die Black Hand ein Hirngespinst war, wer hatte dann Willie?
Die Labarberas zeigten die Entführung bei der Polizei an, und kurz darauf klopfte ein Detective an ihre Tür in der Second Avenue, Hausnummer 837. Joseph Petrosino, der Leiter des berühmten »Italian Squad« der Polizei, war ein kleiner, stämmiger Mann mit der Statur eines Hafenarbeiters. Seine Augen — die manche als dunkelgrau, andere als schwarz wie Kohle beschrieben — waren kühl und taxierend. Er hatte breite Schultern und »Muskeln wie Stahlseile«. Ein Rohling war er jedoch nicht, im Gegenteil. Er sprach gern über ästhetische Fragen, liebte die Oper, besonders die italienischen Komponisten, und war ein guter Geigenspieler. »Joe Petrosino«, schrieb die New York Sun, »konnte eine Fidel zum Sprechen bringen.« Seine wahre Berufung allerdings war die Aufklärung von Verbrechen. Petrosino war der »größte italienische Detective der Welt«, wie die New York Times fand, ja, der »italienische Sherlock Holmes«, wie man sich in der alten Heimat erzählte. Mit sechsundvierzig war seine »Karriere so aufregend wie die jedes Javert im Labyrinth der Pariser Unterwelt oder eines Inspektors von Scotland Yard — ein von Abenteuer und Heldentaten pralles Leben, wie nicht einmal Conan Doyle es sich hätte aufregender ausmalen können.« Er war zurückhaltend gegenüber Fremden, unbestechlich, still, tapfer bis zur Waghalsigkeit, brachial, wenn man ihn reizte, und ein derart begabter Verkleidungskünstler, dass selbst seine Freunde ihn auf der Straße oftmals nicht erkannten. Von der Schule war er nach der sechsten Klasse abgegangen, konnte sich dank seines fotografischen Gedächtnisses jedoch erinnern, was auf Zetteln stand, die er Jahre vorher kurz gesehen hatte. Frau und Kind hatte er nicht; er hatte sein Leben der Aufgabe verschrieben, sein geliebtes Amerika von der Bedrohung durch den Bund der Black Hand zu befreien. Beim Gehen summte er Operetten.
In seinem üblichen Outfit aus schwarzem Anzug, schwarzen Schuhen und schwarzer Melone trat Petrosino bei den Labarberas ein. William Labarbera, der Vater des vermissten Jungen, zeigte dem Detective die Briefe, konnte sonst aber nicht viel sagen. Die Black Hand war überall und nirgends, sie war brutal, und ihre Allwissenheit grenzte an Zauberei. Den beiden Männern war das genau bewusst. Petrosino sah Willies Eltern an, dass sie »fast verrückt vor Trauer« waren.
Umgehend machte sich der Detective an die Arbeit, quetschte seine Informanten nach Hinweisen aus. Sein weitverzweigtes Netzwerk solcher Spitzel — der sogenannten nfami — erstreckte sich über die ganze Metropole: Barmänner, Ärzte, Krämer, Anwälte, Opernsänger, Straßenfeger (die sogenannten white winger), Bankiers, Musiker, narbengesichtige sizilianische Ganoven. Willies Beschreibung erschien bald in allen Zeitungen der Stadt.
Doch niemand hatte den Jungen gesehen. Ein vierter Brief drängte die Familie, ihr bescheidenes Heim zu verkaufen,...