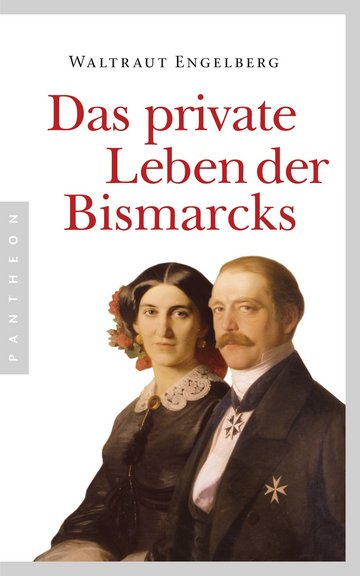Otto von Bismarck wurde am 1. April 1815 in Schönhausen geboren, verlebte aber seine ihm unvergesslichen Kinderjahre in Kniephof im Kreis Naugard, etwa sechzig Kilometer von Stettin entfernt. Nicht reizüberflutet, sondern erlebnisintensiv nahm er das Leben auf dem Lande wahr. Hier bildete sich sein wacher Sinn für eine Landschaft heraus, die ihm immer die liebste bleiben sollte – die waldige Ebene mit Hügeln, Hainen, Wiesen und Baumgruppen, mit Laubwäldern und Bächen. Warum sollte es dem Jungen nicht gefallen, im Sommer im Garten zu helfen – auch einmal die Radieschen herauszuziehen, um zu sehen, ob sie gut wuchsen –, im Winter auf dem Eise zu schlittern oder gar schon »als ganz kleiner Junge« den Vater auf der Rebhuhnjagd zu begleiten, »weil keiner besser als ich, vermöge meines weitern Gesichtes, zu entdecken vermochte, wo die Hühner eingefallen waren«.
Viel zu früh setzte die ehrgeizige Mutter diesen kindlichen Freuden ein Ende, weil sie so rasch wie möglich berufliche Weichen für den Sohn stellen wollte. Da überlegten sich die Eltern so mancherlei. Der Vater hätte »sehnlichst gewünscht«, Otto möge Geistlicher werden, »um einer Pfründe willen«, die nach Bismarcks Erinnerung fünfzehnhundert Taler betragen hätte und der Familie erhalten bleiben sollte. Als seine Frau Johanna im Jahre 1879 davon erfuhr, versuchte sie sich diese Entwicklung ihres Mannes auszumalen und schlussfolgerte ebenso arg- wie ahnungslos, dass er da viel glücklicher geworden wäre. Die Mutter, die ihn gern als »wohlbestallten Regierungsrat« gesehen hätte, wusste ihren Sohn da schon besser einzuschätzen. Sie setzte sich in Erziehungs- und Bildungsfragen auch immer energisch durch, nie der gutmütige Vater, dessen Stoßseufzer der Sohn gelegentlich zitierte: »Was tut man nicht, um den Hausfrieden zu erhalten.«
Auf Wunsch der Mutter wurde Otto drei Monate vor seinem siebten Geburtstag in die Plamannsche Erziehungsanstalt gegeben, ein seinem Wesen konträres Institut. Diese wohl zu unbedachte Entscheidung trübte sein Leben lang das Verhältnis zur Mutter. Bis zum zwölften Lebensjahr blieb er bei Plamann, und noch im hohen Alter urteilte er harsch über die dort verbrachte Zeit: »Meine Kindheit hat man mir in der Plamannschen Anstalt verdorben, die mir wie ein Zuchthaus vorkam.« Und: »Infolgedessen werden meine Jungen natürlich verzogen …«
Der Wechsel vom ungebundenen Umherstreifen in Wald und Feld oder in den Ställen zu einem streng disziplinierten Tagesablauf war zu abrupt, denn »in der ganzen Anstalt herrschte rücksichtslose Strenge … Die Plamannsche Anstalt lag so, daß man auf einer Seite ins freie Feld hinaussehen konnte. Am Südwestende der Wilhelmstraße hörte damals die Stadt auf. Wenn ich aus dem Fenster ein Gespann Ochsen die Ackerfurche ziehen sah, mußte ich immer weinen vor Sehnsucht nach Kniephof.«
Die Konflikte in seiner kindlichen Seele wurden zumindest von seinen Mitschülern nicht wahrgenommen. Im Gegenteil, später versuchte man sogar, ihm eine Führungsrolle unter den Schülern anzudichten, was er selbst resolut zurückwies. Er sei ein Junge gewesen wie andere auch. Zwölf Stunden fast täglich unter dem Joch eines rigiden Zeitplans aus Unterricht, Arbeitsstunden, gemeinsamem Spaziergang und offizieller Spielzeit – das erschien ihm als unerträglicher Zwang. In der Plamannschen Anstalt habe ein »künstliches Spartanertum« geherrscht, heißt es bei ihm, niemals habe er sich satt gegessen, und er rügte dabei das »elastische Fleisch« und die gekochten Möhren mit den harten Kartoffeln darin. Noch im Februar 1876 erinnerte er sich böse, dass man des Morgens die Kinder mit Rapierstößen weckte, und beschuldigte die von Rousseau beeinflussten Lehrer des Adelshasses.
Für seine Renitenz gegen dieses Erziehungssystem brachte Bismarck viele Gründe vor, wobei hier nicht erörtert sei, inwieweit die Anstalt bei seinem Eintritt ihren selbstgestellten Zielen noch gerecht wurde. Hier ist nur die abträgliche Wirkung auf Bismarck von Belang und vor allem eines: Alles, was ihm dort an Widrigkeiten zustieß, lastete er seiner Mutter an. »Ich bin nicht richtig erzogen. Meine Mutter ging gern in Gesellschaft und kümmerte sich nicht viel um mich.« Später meinte Bismarck zu seiner Frau, die Mutter habe wenig von dem gehabt, was der Berliner »Gemüt« nennt. Oft verdarb sie ihm auch noch die langersehnten Ferien in Kniephof, weil sie just zu der Zeit zur Kur fuhr, wo »man« sich damals traf. Otto wurde dann zum Onkel Fritz nach Templin bei Potsdam abgeschoben.
Friedrich von Bismarck, der früh in die Armee eingetreten war und es darin bis zum Generalleutnant gebracht hatte, sollte und konnte dem heranwachsenden Knaben von seinen militärisch-politischen Erfahrungen manches vermitteln, aber es war wohl doch nicht genug, um den Feriengast für die von den Eltern gewünschte militärische Laufbahn einzunehmen. Später hat er als gelegentlicher Gast in der Berliner Stadtwohnung der Bismarcks in der Behrenstraße bei den Zusammenstößen der nervösen Mutter mit den selbstbewusster werdenden Söhnen familiär besänftigend gewirkt.
Die schmerzlichen Kindheitserlebnisse hatten nachhaltige Folgen für Bismarcks Lebensgestaltung. Er nahm sich vor, dass es so, wie er es erfahren hatte, keineswegs in seiner künftigen Familie zugehen sollte. Er suchte das Gegenbild zu seiner Mutter, keine »Gesellschaftsfrau für andre«, sondern eine warmherzige Gefährtin für sich und eine gütige Mutter für die Kinder. Dabei lässt sich psychologisch Aufschlussreiches erkennen: Otto von Bismarck, dem Traditionelles besonders am Herzen lag, seien es die »Baumahnen« in der Natur oder die Vorfahren in der Familie, verfolgte interessiert nur die väterliche Traditionslinie, die junkerlich-ländliche. Die mütterliche, aus der ihm zweifellos viele geistige Anlagen überkommen waren, nahm er nicht wahr, weil er sie nicht wahrnehmen wollte. Die emotionale Blockade engte – wie oft im Leben – auch bei ihm das unbefangene Urteil ein. Wo das Gefühl sich verweigert, dort reduziert sich auch das geistige Erkenntnisvermögen.
Verglichen mit den Verhältnissen bei Plamann, erschien Bismarck seine Gymnasialzeit wie eine »milde Zucht«. Liebevoll erinnert er sich der Trine Neumann, die sich »redlich um meine Knabenzeit verdient gemacht hat«. Die kam vom väterlichen Gut in Schönhausen und war ihm und dem Bruder Bernhard beigegeben als »Haushof-, Küchen-, Keller- und Sittenmeisterin«. Sie hatte die Jungen gern, tat alles für sie und bereitete ihnen täglich abends ihr Leibgericht: Eierkuchen. Wie ein Rohrspatz konnte sie schimpfen, wenn die beiden wieder einmal zu spät kamen und ihre Eierkuchen aufgebacken werden mussten, weswegen sie ihnen prophezeite, dass aus ihnen im Leben nichts Vernünftiges werden würde. Aber wenn die Jungen sich dann auf die aufgebackenen Eierkuchen stürzten, war sie sogleich wieder versöhnt.
Heiter und wehmütig dachte Bismarck später an die gute alte Trine zurück, und auch den Kuhhirten Brand aus Kniephof vergaß er nie, der so alt gewesen sein muss, dass er noch Teilnehmer der Schlacht bei Fehrbellin kannte: »Wenn er mir ins Gedächtnis kommt, ist mir immer wie Heidekraut und Wiesenblumen.«
Es gibt nicht eine Zeile, in der Bismarck ähnlich liebevoll der Mutter gedachte. Lediglich in einem Brief an Johanna konzedierte er einmal: »Sie wollte, daß ich viel lernen und viel werden sollte, und es schien mir oft, daß sie hart, kalt gegen mich sei. Was eine Mutter dem Kinde wert ist, lernt man erst, wenn es zu spät, wenn sie tot ist; die mittelmäßigste Mutterliebe, mit allen Beimischungen mütterlicher Selbstsucht, ist doch ein Riese gegen alle kindliche Liebe.«
Ganz anders urteilte er über den Vater: »Meinen Vater liebte ich wirklich, und wenn ich nicht bei ihm war, faßte ich Vorsätze, die wenig Stand hielten; denn wie oft habe ich seine wirklich maßlos uninteressierte gutmütige Zärtlichkeit für mich mit Kälte und Verdrossenheit gelohnt. Und doch kann ich die Behauptung nicht zurücknehmen, daß ich ihm gut war im Grunde meiner Seele.« Das lässt sich vielfach erkennen; nicht nur, weil Bismarck die Schwester anwies, welche Briefe den Vater am meisten erfreuen würden, sondern auch, weil er selbst gutherzig jene inszenierten Fuchsjagden des Vaters mitmachte, bei denen man von vornherein wusste, dass kein Fuchs zu erlegen war.
Als Bismarck schließlich der Pensionszeit in Berlin entwachsen war, die er zuletzt bei einem Oberlehrer Bonnell am Grauen Kloster verbracht hatte – einem braven Mann, der ihn pflichtschuldigst »immer am Bändel« hielt –, und mit noch nicht ganz siebzehn Jahren auf die Universität nach Göttingen kam, da brachen alle Dämme; jetzt fühlte er sich »endlich mal in Freiheit«. Er hätte, so charakterisiert er es selbst, »wie ein junges Füllen nach hinten und vorn ausgeschlagen«.
Das krasse Gegenteil eines Fehlers ist oft wieder ein Fehler. Allzu starken Zwängen folgt als Reaktion nicht selten Zügellosigkeit. Bismarck kostete seine neu gewonnene »Freiheit« voll aus; die Studienjahre waren eine Zeit des unmäßigen Trinkens, Fechtens und Schuldenmachens.
STUDIENFREUNDE FÜRS LEBEN
Sein ganzes Leben lang bedurfte Otto von Bismarck vertrauter Menschen, denen er sich öffnen konnte, sei es im Gespräch oder in Briefen. In seinen wilden Studentenjahren in Göttingen schloss er einige Freundschaften, die lebenslang hielten.
Gleich zu Beginn seines Studiums, im Jahr 1832, schloss er sich dem Korpsbruder Gustav Scharlach an, der ihm später als preußischer Verwaltungsrat verbunden war. Zunächst aber ging es hoch her bei den Mitgliedern des Korps »Hannovera«. Bei Trinkgelagen und Ausschweifungen...