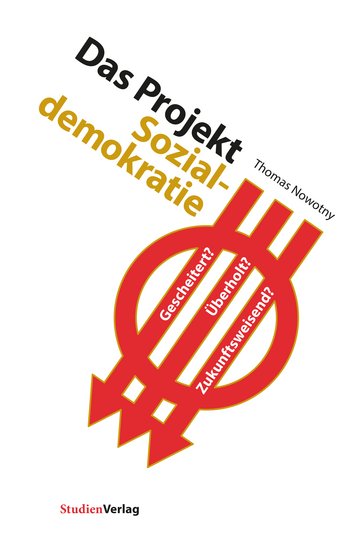Vorwort
Das Ende einer Ära
Sie neigt sich zu Ende – die lange Ära der europäischen Nachkriegszeit, die Zeit seit 1945, die dem Kontinent einen lang dauernden, durch keinen großen Krieg gestörten Frieden beschert hatte, in der man ein vorher nie gekanntes Maß an recht gleichmäßig verteiltem Wohlstand erreicht hatte, in der die letzten Diktaturen verschwunden waren und in der in einem zunehmend geeinten Europa enger Nationalismus überwunden schien.
All diese großen Trends scheinen erschöpft und an ihr Ende gelangt zu sein. Das europäische Einigungswerk ist gefährdet und der Rückzug aus europäischer Gemeinsamkeit offenkundig. Die dreifache Herausforderung durch die militärische Aggression Russlands, durch die Finanz- und Wirtschaftskrise und durch das massive Hereinfluten von Flüchtlingen hat nicht zu verstärkter Zusammenarbeit geführt, sondern zu einer „Rückabwicklung“ der Integration, hin zu einem impotenten, aber emotionalen, offenbar ununterdrückbaren Nationalismus.
Das Wachstum der Wirtschaft verflacht und wurde zusehends anämisch. Europa ist nur unzureichend an der Entwicklung und Anwendung von Informationstechnologie beteiligt, durch welche die Wirtschaft auf eine neue Grundlage gestellt wird. Die Arbeitslosigkeit steigt und in einigen Staaten so sehr, dass sie die politische Stabilität bedroht. Der Zusammenhalt der Gesellschaft wird auch durch wachsende Ungleichheit in der Verteilung von Einkommen und Vermögen unterhöhlt. Die Abwehr dieser Gefahr und Abwärtsentwicklung hätte die Staaten Europas und innerhalb dieser Staaten die einzelnen Gesellschaftsgruppen einen sollen. Das ist nicht geschehen. Sowohl zwischen den Staaten Europas wie auch innerhalb dieser Staaten, haben diese Probleme vielmehr zu wachsender Uneinigkeit und Polarisierung geführt.
Zunächst in Griechenland, dann auch in Spanien und Portugal waren in den letzten Jahrzehnten im westlichen Europa die Diktaturen verschwunden. Mit dem Ende der kommunistischen Zwangsherrschaft folgte dann auch der europäische Osten diesem Siegeszug der Demokratie. Einzig die Diktatur im kleinen Belarus widerstand dem Trend. Außer dem belarussischen Präsidenten konnte es bis vor Kurzem kein anderer Politiker wagen, sich zu anderen als demokratischen Idealen zu bekennen. Auch dieser Konsens beginnt zu bröckeln. Rechtsradikale, anti-europäische Parteien drängen allen Ortens an die Macht. An ihren extremen Rändern siedeln demokratiefeindliche Gruppierungen. Demokratische Ideale dürfen nunmehr ungestraft in Zweifel gezogen, ja verhöhnt werden – und das selbst vom Ministerpräsident des EU-Mitgliedstaates Ungarn.
Nach 1990 wäre es möglich gewesen, Russland als gleichberechtigten Partner in das europäische Einigungswerk einzubinden. Die Chance wurde vertan. Das rächt sich nun dreißig Jahre später. Russland wurde zum Gegner. Es attackiert auf breiter Front, und es nutzt dazu auch sein Militär zur Eroberung von fremdem Staatsgebiet. Der Krieg, der vom Kontinent endgültig verbannt schien, er kehrt nunmehr zurück. Flugzeuge fliegen Scheinangriffe. Manöver simulieren den Einsatz von Atomwaffen. Man rüstete auf.
All das ist eingebettet in breite, weltweite, dramatisch schnelle Entwicklungen, durch die sich die Grundlagen der gesamten bisherigen Weltordnung ändern. In den USA, welche diese Weltordnung bisher abgesicherte hatten, schwinden sowohl die Möglichkeiten wie auch der Wille, das auch weiterhin zu tun. Der amerikanische Anteil an der Weltwirtschaft hat sich auf weniger als 20 Prozent verringert. Das militärische Auftrumpfen der USA hat diesen Machtverlust nicht kompensiert, sondern beschleunigt.
Die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffenen internationalen Organisationen wie die Vereinten Nationen oder der Währungsfonds konnten sich den neuen Entwicklungen nur ungenügend anpassen. Auch sie sind daher kaum in der Lage, weltweit für Vorhersehbarkeit und Sicherheit zu sorgen.
Sowohl international wie auch im Inneren von Staaten scheint Politik zunehmend unfähig, steuernd in jene breitflächige Entwicklung einzugreifen, durch welche sich Gesellschaften grundsätzlich und rasch verändern. Wirtschaft und Technologie entwickeln sich so nach ihren eigenen Gesetzen und unbeeinflusst von Politik. Der Zeitgeist hat dem applaudiert. Staat und Politik wurden als Totgewichte denunziert, welche den Weg zu größerem Wohlstand und größerer Freiheit lediglich verrammeln. Mehr Privat sei besser als mehr Staat. Geiz, Neid und egoistisches Streben nach Status und Konsum würden dem Gemeinwohl letztlich mehr nützen als Solidarität und sozialer Ausgleich.
Dieser Zeitgeist steht zwar in offensichtlichem Widerspruch zu den traditionellen Werten der europäischen Sozialdemokratie. Diese hat sich dem zeitgeistigen Trend dennoch nicht entgegengesetzt. Sie hat sich ihm vielmehr weitgehend angepasst und bloß gelegentlich versucht, ihre engere Klientel vor allzu drastischen Veränderungen zu schützen. Aus progressiven und gestaltungsfreudigen wurden so ihrer Haltung und Wirkung nach konservative Parteien. Sie präsentieren nicht länger die Vision einer anderen als die durch die Automatik der Wirtschaft geformten Zukunft. Auf dem von der europäischen Sozialdemokratie ab den 90er Jahren eingeschlagenen „Dritten Weg“ sind sie zu Allerweltsparteien der „neuen Mitte“ verkommen. Genützt hat ihnen das wenig. Sie verlieren trotzdem – und zwar europaweit – Einfluss, Macht, Mitglieder und Wahlen.
Schwer erklärbar ist diese Abkehr von den traditionellen sozialdemokratischen Werten und Zielvorstellungen deshalb, weil die Politik der einstigen traditionellen Sozialdemokratie recht erfolgreich war. Denn gemessen an objektiven Kriterien menschlicher Wohlfahrt hat sich die traditionelle sozialdemokratische Politik Alternativen gegenüber als überlegen erwiesen. So ist etwa die Lebensqualität der weitgehend durch die Sozialdemokratie geformten skandinavischen Staaten höher als die Lebensqualität in anderen europäischen Staaten. Die Menschen dort leben länger, sind besser ausgebildet, sind zufriedener und toleranter, und sie sind auch wohlhabender, wenn man das an den Durchschnittseinkommen – Median-Einkommen – misst. Jedenfalls liegt die Lebensqualität in den skandinavischen Staaten weit über jener in Staaten, deren Politik vom Glauben an Eigennutz und Markt bestimmt wurden – wie insbesondere Großbritannien und die USA. Auch in Österreich waren die Jahre einer sozialdemokratischen Alleinregierung (bzw. Regierung mit einem sehr schwachen, damals noch liberaleren FPÖ-Partner), das sind die Jahre zwischen 1970 bis 1987, durch überproportional raschen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Fortschritt geprägt.
Warum hat es die Sozialdemokratie verabsäumt, an ihre einstigen Erfolge anzuknüpfen, ihre traditionelle Politik fortzuführen, diese aber gleichzeitig an neue Gegebenheiten anzupassen? Eine der Ursachen mag sein, dass sie, so wie viele andere große Organisationen, allmählich unbeweglich geworden ist und dass sie sich, so wie viele andere große Organisationen, zunehmend mit sich selbst beschäftigt und sich dabei vor ihren eigentlichen Aufgaben entfernt.
Aber das alleine kann wohl nicht eine ausreichende Erklärung sein. Denn einige der politischen Gegner der demokratischen Linken – wie die amerikanischen „Republikaner“ oder die britischen „Tories“ – existieren ebenfalls seit langem. Sie haben es dennoch besser als die Sozialdemokratie verstanden, sich die Gunst der Wähler zu sichern.
Die eigentlichen Probleme der Sozialdemokratie und die Ursachen ihres politischen Abstiegs scheinen vielmehr in ihrer engen Partnerschaft mit dem Industrialismus begründet. Die Sozialdemokratie hat sich gemeinsam mit dem reifen Industrialismus entwickelt. Die Industriearbeiter waren ihre Stammwähler und die Sozialdemokratie hat den gesellschaftlichen Aufstieg dieser ihrer Stammwähler begleitet und gefördert. Erleichtert wurde dies durch eine Art von Seelenverwandtschaft zwischen Industrialismus und Sozialdemokratie. Beide Bewegungen eint der Glaube an die technische Lösbarkeit von Problemen; der Glaube an die Gestaltbarkeit der Zukunft und ein aufklärerisches Vertrauen in menschliche Rationalität.
Das Industriezeitalter geht rasch zu Ende. Nur mehr ein kleiner Teil der Arbeitnehmer ist in der Industrie beschäftigt. Eine auf die Industriearbeit abgestellte innerparteiliche Kultur wird damit unzeitgemäß, ebenso wie die dem Industriezeitalter angepasste Organisationsstruktur der Sozialdemokratie. Liest man das letzte Pateiprogramm der SPÖ aus dem Jahre 1998, so scheint vieles davon wie ein Abgesang auf eine untergehende Ära. Gefordert wird ein bisschen Mehr von diesem und jenem, das ohnehin schon lange auf dem Wunschkatalog gestanden hatte. Den Weg in eine grundsätzlich andere als die industrielle Welt hat das Programm 1998 nicht vorgezeichnet.
Aber wäre die Sozialdemokratie überhaupt in der Lage, sich von den alten Leitbildern zu verabschieden und sich aus der Abhängigkeit von einer schrumpfenden Schicht von Stammwählern zu lösen? Könnte sie mehr tun als Vergangenes fortzuschreiben? Könnte sie wirklich und glaubhaft Antworten auf jene Probleme anbieten, die sich jetzt schon...