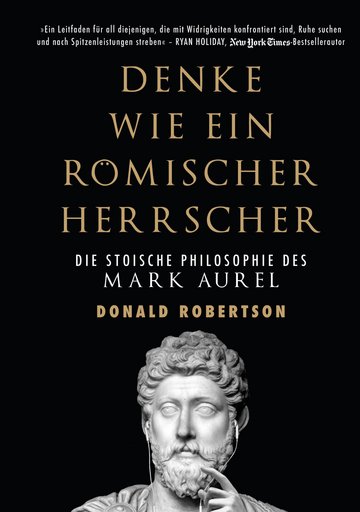EINLEITUNG
Als ich dreizehn war, starb mein Vater. In seinen Fünfzigern erkrankte er an Lungenkrebs und war ein Jahr lang bettlägerig, bevor er schließlich von uns ging. Er war ein anständiger und bescheidener Mensch, der mich dazu angespornt hat, eingehender über das Leben nachzudenken.
Sein Tod traf mich völlig unvorbereitet, ich kam nur schwer über diesen Verlust hinweg. Ich wurde zornig und depressiv, lungerte die ganze Nacht auf der Straße herum und spielte Katz und Maus mit der örtlichen Polizei. Ich verübte Einbrüche und wartete dann, bis die Polizisten kamen, nur um durch die benachbarten Gärten zu flüchten, über Hecken und Zäune zu springen und meine Verfolger abzuhängen. Immer steckte ich in Schwierigkeiten, entweder weil ich die Schule schwänzte, mit meinen Lehrern stritt oder mich mit meinen Klassenkameraden prügelte. Kurz nach meinem sechzehnten Geburtstag wurde ich zum Schuldirektor zitiert, der mich vor die Wahl stellte: Entweder verließ ich die Schule freiwillig oder man würde mich hochkant hinauswerfen. Also ging ich und landete anschließend in einem Spezialprogramm für schwer erziehbare Jugendliche. Ich hatte das Gefühl, mein Leben gerate völlig außer Kontrolle. Die Schule und die Sozialbehörden hatten mich abgeschrieben, und ich konnte keinen Sinn darin erkennen, zu versuchen, sie vom Gegenteil zu überzeugen.
Jeden Abend kam mein Vater dreck- und ölverschmiert von seiner Arbeit als Baggerfahrer nach Hause und sank erschöpft in den Sessel. Die Arbeit war schlecht bezahlt. Doch obwohl das Geld nie reichte, beklagte er sich nicht. In jungen Jahren hatte er seinen besten Freund verloren, der ihm zur Überraschung aller in seinem Testament eine Farm vermachte. Doch mein Vater lehnte das Vermächtnis ab und überließ die Farm der Familie des Verstorbenen. Er sagte immer: »Geld macht nicht glücklich.« Daran glaubte er wirklich. Er zeigte mir, dass es wichtigere Dinge im Leben gibt und wahrer Reichtum darin besteht, zufrieden mit seinem Los zu sein, statt immer noch mehr haben zu wollen.
Nach seiner Beerdigung legte meine Mutter seine alte Lederbrieftasche auf den Esszimmertisch und sagte mir, ich solle sie nehmen. Ich öffnete sie langsam. Ich glaube, dabei zitterten meine Hände, aber ich weiß nicht, warum. In der Brieftasche befand sich nichts außer einem arg zerfledderten Fetzen Papier. Wie sich herausstellte, handelte es sich dabei um eine Seite aus der Bibel, und zwar aus dem zweiten Buch Mose: »Da erwiderte Gott Mose: ICH BIN, DER ICH BIN, und sprach: Also sollst du zu den Söhnen Israels sprechen: Der ›ICH BIN‹ hat mich zu euch gesandt.« Ich wollte unbedingt verstehen, was in aller Welt meinem Vater diese Worte bedeutet haben mochten. Meine eigene philosophische Reise begann genau in diesem Moment, als ich perplex auf das Stück Papier in meiner Hand starrte.
Als ich viele Jahre später erfuhr, dass Marcus Aurelius – auch Mark Aurel genannt – seinen Vater ebenfalls in jungen Jahren verloren hatte, fragte ich mich, ob er anschließend so wie ich nach Orientierung gesucht hatte. Nach dem Tod meines Vaters quälten mich jedenfalls viele religiöse und philosophische Fragen. Ich erinnere mich, dass ich furchtbare Angst davor hatte zu sterben. Nachts lag ich schlaflos im Bett und versuchte, das Rätsel der Existenz zu lösen und Trost zu finden. Es war so, als verspürte ich irgendwo in der hintersten Ecke meines Gehirns einen Juckreiz und wollte mich unbedingt kratzen, käme an diesen Punkt aber nicht heran. Damals war mir das nicht bewusst, aber diese Art von existenzieller Angst ist eine weit verbreitete Erfahrung, die Menschen dazu bewegt, Philosophie zu studieren. Der Philosoph Spinoza schrieb zum Beispiel:
So nahm ich wahr, dass ich mich im Zustand großer Gefahr befand, und ich zwang mich mit aller Kraft nach Abhilfe zu suchen, egal wie ungewiss sie sein mochte – so wie ein kranker Mann, der mit einer tödlichen Erkrankung ringt und sieht, dass er gewiss sterben wird, falls keine Abhilfe gefunden wird, gezwungen ist, mit aller Kraft nach einer solchen zu suchen, da seine ganze Hoffnung darin liegt.1
Ich nahm den Satz »Ich bin, der ich bin« als Verweis auf das reine Bewusstsein für die Existenz, was mir zunächst als etwas zutiefst Mystisches oder Metaphysisches erschien: »Ich bin das Bewusstsein meiner eigenen Existenz.« Das erinnerte mich an die berühmte Inschrift am Apollon-Tempel von Delphi: »Erkenne dich selbst!« Dieser Satz wurde zu einer meiner Maximen. Die Suche nach Selbsterkenntnis mithilfe von Meditation und kontemplativen Übungen wurde zu einer regelrechten Besessenheit. Später fand ich heraus, dass der Bibelauszug, den mein Vater all die Jahre mit sich herumgetragen hatte, eine wichtige Rolle in den Riten eines Kapitels der Freimaurer vom Königlichen Bogen spielt. Während der Initiation wird der Kandidat gefragt: »Bist du ein Maurer des Königlichen Bogens?« Darauf antwortet er: »ICH–BIN–DER–ICH–BIN.« Das Freimaurertum hat in Schottland eine lange Geschichte, die mindestens vier Jahrhunderte zurückreicht, und in meinem Heimatort Ayr ist sie tief verwurzelt. Die meisten Freimaurer sind Christen, aber sie verwenden eine nicht konfessionsgebundene Sprache und sprechen von Gott als »dem Großen Architekten des Universums«.
Der Legende zufolge, die in einigen ihrer Texte auftaucht, brachte der Philosoph Pythagoras von Samos eine Reihe spiritueller Lehren, die auf die Erbauer des Tempels von König Salomon zurückgingen, in den Westen. Diese wurden von Plato und Euklid weiterverbreitet. Das Wissen aus der Antike wurde im Laufe der Jahrhunderte angeblich von den Freimaurerlogen des Mittelalters weitergegeben. Sie verwendeten esoterische Rituale, geometrische Symbole wie das Quadrat und Kompasse zur Vermittlung ihrer spirituellen Doktrinen. Das Freimaurertum zelebriert zudem die vier Meistertugenden, angelehnt an die Kardinaltugenden der griechischen Philosophie, die symbolhaft den vier Ecken der Loge entsprechen: Klugheit, Tapferkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit.
Mein Vater nahm diese ethischen Grundsätze sehr ernst; sie formten seinen Charakter auf eine Weise, die nachhaltigen Eindruck auf mich machte. Das Freimaurertum, war – zumindest für ernsthaft Praktizierende wie meinen Vater – keine theoretische Philosophie, die in den Elfenbeintürmen akademischer Einrichtungen gelehrt wurde, sondern eher so etwas wie ein aus wesentlich älteren Konzepten der westlichen Philosophie abgeleiteter spiritueller Lebensstil.
Ich war nicht alt genug, um Freimaurer zu werden, und bei meinem Ruf im Ort hätte man mich sowieso nicht eingeladen, Mitglied zu werden. Daher begann ich mit meinem äußerst defizitären Bildungshintergrund alles über Philosophie und Religion zu lesen, was ich in die Hände bekam. Ich bin nicht sicher, ob ich damals überhaupt hätte artikulieren können, wonach ich suchte, außer dass es irgendwie mein Interesse für Philosophie, Meditation und Psychotherapie miteinander verbinden musste. Ich brauchte eine rationalere philosophische Lebenshilfe – doch nichts schien dieser Anforderung gerecht zu werden. Doch dann hatte ich das Glück, auf Sokrates zu stoßen.
Sokrates legte einen besonderen Schwerpunkt auf die vier Kardinaltugenden der griechischen Philosophie (Klugheit, Tapferkeit, Mäßigung, Gerechtigkeit), die später von den Freimaurern übernommen wurden. Allerdings verfasste er keine philosophischen Werke. Was wir über ihn wissen, wissen wir nur durch die Werke anderer, hauptsächlich Dialoge, die von zweien seiner berühmtesten Schüler – Platon und Xenophon – geschrieben wurden. Der Legende zufolge war Sokrates die erste Person, die philosophische Methoden auf ethische Fragestellungen anwendete. Insbesondere wollte er anderen helfen, weise und im Einklang mit der Vernunft zu leben. Für Sokrates war Philosophie nicht nur ein moralischer Leitfaden, sondern auch eine Art psychologischer Therapie. Mithilfe der Philosophie, so sagte er, könne der Mensch seine Angst vor dem Tod überwinden, seinen Charakter verbessern und echte Erfüllung finden.
Ich hatte zuvor die Sammlung aus antiken gnostischen Texten studiert, die im ägyptischen Nag Hammadi gefunden worden waren und reichlich griechische Philosophie enthalten. Das führte mich zur Lektüre der Platonischen Dialoge, in denen Platon Sokrates – den Inbegriff des griechischen Philosophen – in Form von teils fiktiven literarischen Dialogen zwischen Vertretern unterschiedlicher philosophischer Positionen porträtiert.
Die sokratischen Dialoge sind bekanntermaßen oft nicht eindeutig. Tatsächlich inspirierte sein berühmter Satz, »Ich weiß, dass ich nichts weiß« – auch als »sokratische Ironie« bezeichnet –, später den griechischen Skeptizismus. Nichtsdestotrotz scheint er seinen Schülern positive Lehren über den besten Lebensstil vermittelt zu haben. Der Eckpfeiler dieser Lehren findet sich in der berühmten Passage aus Platons...