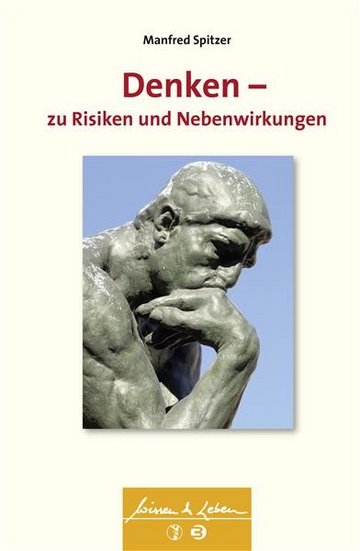Vorwort
Das vorliegende Buch ist das sechzehnte seiner Art und enthält meine Beiträge für die Zeitschrift Nervenheilkunde aus dem Jahr 2014. Mit etwa 240 Seiten und 60 Abbildungen, die ich nach wie vor nahezu alle selber zeichne, fotografiere oder anderweitig erstelle, und einem guten Dutzend Tabellen möge dieses Buch meinen Lesern wie jedes Jahr wieder viel Futter fürs Gehirn1, wie die Engländer sagen, bieten.
Der Titel lautet dieses Jahr Denken – zu Risiken und Nebenwirkungen. Denn hierum geht es ja im Grunde immer auch, wenn wir dieser typisch menschlichen Tätigkeit des Geistes nachgehen. Ob Tiere denken (und wenn ja, was?), weiß ich nicht, aber es könnte durchaus sein. Bei manchen Menschen stellt sich diese Frage zuweilen auch. Man kann hier den englischen Philosophen David Hume zitieren, der gesagt hat: „Sometimes I sit and think, and sometimes I only sit.“ Er macht also hier eine klare Unterscheidung, die impliziert, dass man keineswegs davon ausgehen kann, dass Menschen, die irgendwo herumsitzen (Professoren und Studenten im Hörsaal, Manager oder Verwaltungsleute in Sitzungen, Politiker in Parlamenten etc.), immer auch denken.
Und wenn der oder die eine oder andere dann schon einmal wirklich denkt, dann läuft sie/er natürlich auch Gefahr, dass es daneben geht. Vielleicht ist die Absicht ja lobenswert, aber wie bei jeder Therapie gibt es auch beim Denken unerwünschte Wirkungen. Es kann schief gehen und man kann falsch liegen.
Denkt der Partner beispielsweise unbestimmt und immer wieder anders, ist das für einen selbst langfristig tödlich, wie in Kapitel 1 gezeigt wird. Denn Unklarheit bedeutet Stress, und Stress erhöht die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der häufigsten Krankheiten. Die seelische Verfassung beeinflusst auch unseren Körper, bis hin zur Verkürzung der Enden von Chromosomen (man nennt diese Telomere) durch psychosozialen Stress. Da die Länge der Telomere mit der Länge des Lebens korreliert, zeigt sich hier ein Zusammenhang zwischen negativen Lebenserfahrungen wie beispielsweise einer Ehescheidung der Eltern und kürzerer Lebenserwartung von deren Kindern (Kapitel 2). Dieser ist rein statistisch und wird sicherlich durch sehr viele weitere Faktoren moduliert, nicht zuletzt vor allem durch das Verhältnis der Eltern vor und nach der Scheidung zu ihren Kindern. Denn Stress hat nur negative Folgen durch seine Chronizität. Akuter Stress ist sinnvoll.
„Das Sein prägt das Bewusstsein“, wusste schon Karl Marx, d. h. die Lebensumstände bedingen u. a., was wir denken. Dies ist recht trivial gegenüber der Erkenntnis, dass die Lebensumstände auch einen Einfluss darauf haben können, wie wir denken, wie eine aus meiner Sicht sehr gut gelungene Studie aus China zeigen konnte (Kapitel 3). Anhand eines großen Datensatzes wurde hier gezeigt, dass die Tradition des Weizen- versus Reisanbaus die Art des Denkens in eher westlich oder östlich verschiebt. Die schöne Zusammenstellung der Methoden, dies zu messen, rechtfertigt allein schon die Lektüre dieses Artikels, dessen Ergebnisse jedoch zudem überraschend und erhellend sind.
In Kapitel 4 geht es um die Auswirkungen einer Chemotherapie auf das Denken, also um eine Nebenwirkung im Bereich des Denkens. Schon lange ist klar, dass Moleküle unser Denken beeinflussen (meist im Sinne von „beeinträchtigen“) können, man denke nur an Alkohol oder Schlafmittel. Die negativen Auswirkungen von Substanzen, welche die Zellteilung hemmen, auf den Geist waren lange tabu, nicht zuletzt deswegen, weil man davon ausging, dass im Gehirn kein neuronales Wachstum stattfindet. Nach dem Sturz dieses Dogmas in den vergangenen zwei Jahrzehnten konnte plötzlich wieder sein (d. h. beobachtet und beschrieben werden), was zuvor nicht sein durfte: nämlich dass Zytostatika sich negativ auf die Gehirnfunktion auswirken können – insbesondere in gedächtnisrelevanten Bereichen, weil gerade dort auch beim Erwachsenen noch Nervenzellen nachwachsen, etwa 1 400 pro Tag.
Dieses Nachwachsen von Nervenzellen geschieht auch im Riechhirn, weswegen Beeinträchtigungen des Geruchssinns ein Indikator für verminderte körperliche Regenerationsfähigkeit – und damit für eine geringere Lebenserwartung sind, wie eine große Studie gezeigt hat (Kapitel 5). Man kannte entsprechende Befunde schon bei manchen neurodegenerativen Erkrankungen (Morbus Alzheimer, Morbus Parkinson), die Effekte scheinen jedoch eine größere Allgemeinheit zu besitzen als bislang vermutet.
Glücklicherweise sind nicht alle Nebenwirkungen negativ: es gibt auch positive, unerwartete Nebenwirkungen. In Kapitel 6 werden fünf Studien referiert, die nachweisen konnten, dass eine zweisprachige Person die Symptome einer Demenz volle fünf Jahre später bekommt als eine Person, die nur ihre Muttersprache spricht.
Ganz allgemein zeigen diese Beträge, dass Körper und Geist sind viel enger miteinander verknüpft als die meisten Menschen meinen und vor allem auch auf die unterschiedlichsten Weisen. So ist in Kapitel 7 Thema, dass Laufen (gehen, nicht rennen) die Kreativität fördert, insbesondere das Laufen in der freien Natur.
Gerade weil diese Zusammenhänge so vielfältig sind, wundert es weiterhin nicht, dass Änderungen unseres Lebens, so banal und „äußerlich“ sie erscheinen mögen, auch Änderungen unseres Geistes zur Folge haben. So muss die Tatsache, dass viele jungen Menschen heute sehr viel Zeit mit digitalen Medien verbringen, Folgen haben. Dies ist für die Nutzung des (seit mittlerweile mehr als 60 Jahren verfügbaren) Fernsehers klar gezeigt, zu dessen Risiken und Nebenwirkungen geringere Bildung, Fettleibigkeit, aggressives Verhalten und Aufmerksamkeitsstörungen gehören. Bei den erst wenige Jahre existierenden Smartphones ist dies anders. Dennoch gibt es mittlerweile Daten, sowohl zu den psychischen Nebenwirkungen (Kapitel 8) als auch zu deren Auswirkungen auf die Häufigkeit von Unfällen und anderen körperlichen Folgen (Kapitel 9).
Wenn Ärzte immer mehr Zeit mit dem Computer zubringen, so geht dies von ihrer Zeit mit dem Patienten ab. Diese Entwicklung ist nicht unausweichlich und weder in der Körpermedizin noch in den psychomedizinischen Fächern erwünscht (Kapitel 10). Glücklicherweise ist auch dies mittlerweile gut untersucht, sodass jedem, der die Anwendung von Computern immer und grundsätzlich für positiv erachtet, mit klaren Argumenten begegnet werden kann.
Wie sehr „unsere Brille“ – d.h. die persönliche Art, unsere Wahrnehmung aufgrund von Vorerfahrungen, „subjektiv“ zu überformen, insbesondere, wenn es eine „rosa Brille“ ist – auf die Realität zurückwirkt, wird nirgendwo deutlicher als im alltäglichen Miteinander von Paaren. In Kapitel 11 werden Daten vorgestellt, die zeigen, dass die Idealisierung des Partners langfristig positive Auswirkungen auf die Paarbeziehung hat.
Und wenn wir schon bei Mann und Frau sind, dann schließt sich eine Übersicht zu neueren neurobiologischen Arbeiten zu Differenzen zwischen männlichem und weiblichem Gehirn (Kapitel 12) nahtlos an.
Man möchte meinen, wenigstens die Medizin habe das allfällige Problem der Risiken und Nebenwirkungen ein für alle Mal zumindest professionell aufgegriffen. (Davon ist man in anderen Lebensbereichen, wie beispielsweise Politik oder Ökonomie, weit entfernt, wie die letzten fünf Jahre sehr deutlich gezeigt haben!) Dass dies leider nicht der Fall ist, und große Unsicherheiten über die tatsächlichen Risiken von Medizin bestehen, zeigt Kapitel 13. Es ist schon ein Unterschied, ob die Zahl der Todesfälle durch medizinische Behandlungsfehler jährlich bei gut 120 oder bei knapp 20 000 liegt – aber genau dies ist tatsächlich die Spannbreite der hierzu vorliegenden Angaben!
Zurück zum Miteinander und den Medien: Wussten Sie, dass sich Cybermobbing durch regelmäßiges Abendessen in der Familie wirksam bekämpfen lässt? – Nun, man hätte es durchaus vermuten können, denn das Reden mit verständnisvollen Eltern bei gleichzeitiger – den Stress reduzierender – Nahrungsaufnahme kommt als Puffer gegen heimtückische anonyme Attacken in den Weiten des Internet durchaus in Betracht. Dass man dies aber anhand eines großen Datensatzes empirisch nachweisen konnte, ist für mich klar als Fortschritt zu werten (Kapitel 14).
Selbst vor der Diplomatie macht die Neurowissenschaft nicht halt, wie die Arbeit eines Neurowissenschaftlers und eines Diplomaten zeigt, die mir wiederum von einem Diplomaten zur Kenntnis gebracht wurde, der wissen wollte, was ein Neurowissenschaftler darüber denkt. So bin ich den Quellen nachgegangen und habe zusätzliche Recherchen angestellt, wodurch meine anfängliche Skepsis eines Besseren belehrt wurde (Kapitel 15). Hätte ich damals schon die Arbeit über die Psycho-(patho-)logie der amerikanischen Präsidenten gekannt (Kapitel 16), wäre ich sicher von Anfang an mit weniger Skepsis an die Sache herangegangen. Aber zum Glück reicht heute der Blick der empirischen Forschung weit über den Tellerrand vieler Einzelwissenschaften hinaus, sodass sich gerade aus der Zusammenschau vieler Erkenntnisse und dem Verbinden zunächst unverbundener Daten ganz neue Sichtweisen ergeben.
Dies zeigt auch das letzte Kapitel mit der Nummer 17 zur Schwarmdummheit, die den hier vorgestellten Reigen der Risiken und Nebenwirkungen menschlichen Denkens abschließt: Die wenigsten wissen, was Schwarmintelligenz ist bzw. alles sein kann, und daher fällt vielen auch nicht auf, dass diese auch – und zuweilen systematisch – daneben liegen kann. Wer jedoch die Rahmenbedingungen, die hierzu...