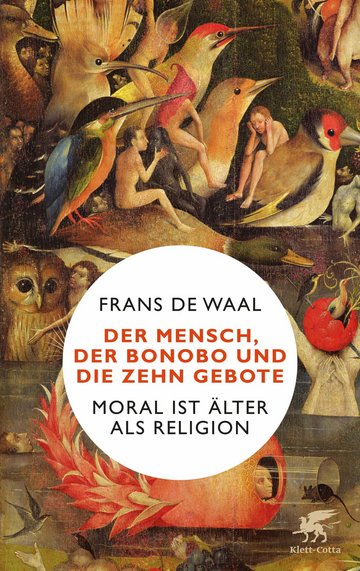Kapitel 1
Irdische Freuden
Wie? ist der Mensch nur ein Fehlgriff Gottes?
Oder Gott nur ein Fehlgriff des Menschen?
– Friedrich Nietzsche1
Ich bin im niederländischen Den Bosch zur Welt gekommen, der Heimatstadt von Hieronymus Bosch, nach der sich der Maler genannt hat.2 Das macht mich noch nicht zu einem Bosch-Experten, aber da ich mit der Statue des Künstlers auf dem Marktplatz aufgewachsen bin, habe ich seine surrealistischen Bildwelten, seinen Symbolismus und die Art und Weise, wie er die Menschheit unter dem schwindenden Einfluss Gottes im Universum verortet, immer gemocht.
Boschs berühmtes Triptychon Der Garten der Lüste, in dem sich unzählige nackte Figuren tummeln, ist eine Hommage an die paradiesische Unschuld. Die Szenerie der Mitteltafel, die dem dreiteiligen Altarbild seinen Namen gibt, ist viel zu fröhlich und entspannt, um der puritanischen Deutung von Kunsthistorikern gerecht zu werden, die darin ein Sinnbild für Verderbtheit und Sündhaftigkeit vermuten. Vielmehr wird die Menschheit hier frei von Schuld und Scham dargestellt – entweder vor dem Sündenfall, oder der Sündenfall ist überhaupt nicht vorgesehen. Für einen Primatologen wie mich sind die Nacktheit, die Anspielungen auf Sex und Fruchtbarkeit, die Fülle an Vögeln und Früchten und das Umherziehen in Gruppen etwas sehr Vertrautes, das eigentlich gar nicht nach einer religiösen oder moralischen Interpretation verlangt. Bosch scheint uns in unserem Naturzustand gemalt zu haben, während er seine moralische Anschauung für den rechten Innenflügel des Triptychons (»Die Hölle«) aufgespart hat, wo aber meines Erachtens nicht die ausgelassenen Gestalten aus dem Mittelbild bestraft werden, sondern Mönche, Nonnen, Gefräßige, Glücksspieler, Trunkenbolde und andere Verdammte, die sich einer Todsünde schuldig gemacht haben. Bosch war kein Freund des Klerus und verurteilte dessen Habgier, was aus einem kleinen Detail im Höllenbild hervorgeht: Ein Mann wird von einem Schwein bedrängt, das den Schleier einer Dominikanernonne trägt. Offenbar versucht das Schwein, dem Mann eine Schenkung abzuluchsen. Wie es heißt, handelt es sich bei dieser armen Figur um ein Selbstbildnis des Künstlers.
Abb. 1: Rechts unten im Höllenbild des Triptychons hat Hieronymus Bosch sich selbst abgebildet, wie er ein als Nonne gekleidetes Schwein abwehrt, das ihn mit Küssen zu verführen sucht. Offenbar will es ihn zu einem Ablasshandel bewegen (daher das Tintenfass, die Feder und ein Schriftstück, das wie eine Urkunde aussieht), indem es ihm als Gegenleistung für sein Vermögen ewiges Seelenheil in Aussicht stellt. Der Garten der Lüste entstand um 1504, also gut ein Jahrzehnt bevor Martin Luther solche Praktiken der Kirche öffentlich anprangerte.
Mehr als fünf Jahrhunderte später liefern wir uns noch immer erbitterte Gefechte darüber, welche Stellung die Religion in der Gesellschaft einnimmt. Wie zu Boschs Zeiten ist das zentrale Thema die Moral. Können wir uns eine Welt ohne Gott vorstellen? Und wäre das eine gute Welt? Glauben Sie bloß nicht, die aktuellen Fronten zwischen dem fundamentalistischen Christentum und der Wissenschaft würden durch unumstößliche Tatsachen abgesteckt. Um an der Evolution zu zweifeln, muss man gegen die vorliegenden Daten schlichtweg immun sein. Daher sind Bücher oder Dokumentarfilme, die Skeptiker überzeugen wollen, reine Zeitverschwendung. Wer sich darauf einlässt, profitiert von solchen Beiträgen, aber ihr Zielpublikum erreichen sie nicht. Wer glaubt, Moralität käme geradewegs von Gott, dem Schöpfer, kann sich mit der Evolution nicht abfinden, weil sich sonst ein moralischer Abgrund auftun würde. Reverend Al Shapton hat es in einem Streitgespräch mit dem inzwischen verstorbenen Polemiker und Atheisten Christopher Hitchens so formuliert: »Wenn dem Universum keine Ordnung innewohnt und es kein Wesen, keine höhere Macht gibt, die diese Ordnung hergestellt hat, wer bestimmt dann, was richtig und was falsch ist? Wenn nichts und niemand dafür zuständig ist, gibt es auch nichts Unmoralisches.«3 Ähnliches habe ich von Leuten gehört, die in Anlehnung an Dostojewskis Iwan Karamasow folgerten: »Wenn es keinen Gott gibt, kann ich getrost hingehen und meine Nachbarin vergewaltigen!«
Vielleicht geht es ja nur mir so, aber mir sind Menschen suspekt, die nur durch ihr Glaubenssystem davon abgehalten werden, eine abscheuliche Tat zu begehen. Warum gehen wir nicht von der Annahme aus, dass unsere Humanität, einschließlich der Selbstkontrolle, die für eine lebenswerte Gesellschaft unerlässlich ist, in uns angelegt ist? Glaubt irgendwer im Ernst, unsere Vorfahren hätten keine sozialen Normen gehabt, bevor sie die Religion entdeckten? Haben sie nie einem Artgenossen geholfen, der in Not war? Haben sie sich nie über eine ungerechte Behandlung beschwert? Die Menschen müssen ein Interesse daran gehabt haben, in funktionierenden Gemeinschaften zu leben, und zwar lange bevor die heutigen Religionen aufgekommen sind, was erst vor ein paar Tausend Jahren der Fall war. Diese Zeitspanne ist für Biologen ein Klacks.
Moral ohne Gott?
Mit dieser Frage begann im Oktober 2010 mein Blogeintrag auf der Webseite der New York Times, wo ich behaupte, Moralität sei schon vor der Religion da gewesen, und dass wir viel über ihre Ursprünge lernen können, wenn wir uns mit anderen Primaten befassen.4 Entgegen der üblichen blutrünstigen Vorstellungen von der Natur verfügen Tiere sehr wohl über Dispositionen, die wir als moralisch bezeichnen. Das deutet meiner Meinung nach darauf hin, dass Moralität keineswegs mit dem Menschen beginnt und, anders als wir vielleicht denken, keine ausschließlich menschliche Errungenschaft ist.
Da dies der Gegenstand des vorliegenden Buches ist, möchte ich auf die einzelnen Themen eingehen, die damit zusammenhängen, indem ich die Woche nach der Veröffentlichung meines Blogeintrags schildere. Kurz bevor ich zu einer Europareise aufbrach, nahm ich an einer Veranstaltung über Wissenschaft und Religion an der Emory University in Atlanta teil, wo ich arbeite. Anlass war ein Forum mit dem Dalai Lama über sein Lieblingsthema: Mitgefühl. Mit anderen mitzufühlen scheint mir eine hervorragende Empfehlung fürs Leben zu sein; daher begrüßte ich die Botschaft unseres ehrenvolles Gastes. In meiner Eigenschaft als erster Korreferent saß ich direkt neben dem Dalai Lama, umgeben von einem Meer aus roten und gelben Chrysanthemen. Man hatte mich instruiert, ihn mit »Eure Heiligkeit« anzureden und »Seine Heiligkeit« zu sagen, wenn ich von ihm in der dritten Person sprach. Das fand ich verwirrend und ich bemühte mich daher, sämtliche Formen der Anrede zu vermeiden. Der Dalai Lama, einer der am meisten bewunderten Menschen auf diesem Planeten, zog als erstes seine Schuhe aus, ließ sich im Schneidersitz auf dem Stuhl nieder und setzte sich eine riesige Baseballkappe auf, die farblich genau auf sein orangerotes Gewand abgestimmt war. Mehr als dreitausend Menschen hingen an seinen Lippen. Was meinen Redebeitrag betraf, so hatten die Organisatoren mir im Vorfeld eingeschärft, dass niemand kommen würde, um mich zu hören, sondern dass alle nur wegen seinen Weisheiten dort sein würden.
Ich begann mit einem kurzen Überblick über die neuesten Erkenntnisse zu Altruismus in der Tierwelt. Zum Beispiel halten Affen einem Artgenossen von sich aus eine Klappe auf, um ihm Zugang zu Futter zu gewähren, selbst dann, wenn ihr eigener Futteranteil dadurch schrumpft. Kapuzineräffchen sind darauf aus, andere zu belohnen. Das wissen wir aus Versuchen, bei denen wir zwei Affen nebeneinandersetzen und einen von ihnen zwischen zwei verschiedenfarbigen Plastikchips (Token) wählen lassen. Für den einen Token bekommt nur der Affe eine Belohnung, der ihn ausgewählt hat, während der andere Token eine Belohnung für beide Affen nach sich zieht. Schon bald entscheiden sich die Affen für den »prosozialen« Token. Das geschieht nicht etwa aus Furcht, denn wie sich herausgestellt hat, sind die dominanten Affen, die am wenigsten zu fürchten haben, die großzügigsten.
Gute Taten kommen auch ganz spontan vor. Eine alte Schimpansendame, Peony, verbringt ihre Zeit zusammen mit anderen Schimpansen im Außengehege der Forschungsstation des Yerkes Primate Center. An schlechten Tagen, wenn ihr die Arthritis zu schaffen macht, fällt ihr das Laufen und Klettern schwer, aber die anderen Schimpansinnen helfen ihr. Peony versucht schnaufend und keuchend auf das Klettergerüst zu gelangen, wo sich mehrere Schimpansen zur Fellpflege (engl. grooming) versammelt haben. Eine andere Schimpansin, die nicht mit Peony verwandt ist, klettert hinter ihr her und schiebt sie unter gehöriger Kraftanstrengung mit beiden Händen an ihrem üppigen Hinterteil nach oben, bis Peony bei der restlichen Gruppe angelangt ist.
Wir haben auch beobachtet, wie Peony sich erhob und langsam auf die Wasserzapfstelle zusteuerte, die in einiger Entfernung liegt. Manchmal wurde sie von jüngeren Schimpansinnen überholt, die etwas Wasser aufnahmen und es dann Peony brachten. Zuerst hatten wir keine Ahnung, was sie da taten. Wir sahen nur, wie eine Schimpansin ihren Mund auf den von Peony presste, aber nach einer Weile wurde uns klar, warum: Peony öffnete weit ihren Mund, und die jüngere Schimpansin spie das Wasser hinein.
Solche Beobachtungen fallen in ein neues Fachgebiet, das sich mit Empathie bei Tieren befasst, und zwar nicht nur bei Primaten, sondern auch bei Hunden, Elefanten und sogar bei Nagetieren. Ein typisches Beispiel ist, wie Schimpansen aufgebrachte Artgenossen beschwichtigen, indem sie sie umarmen und küssen. Dieses Verhalten ist so...