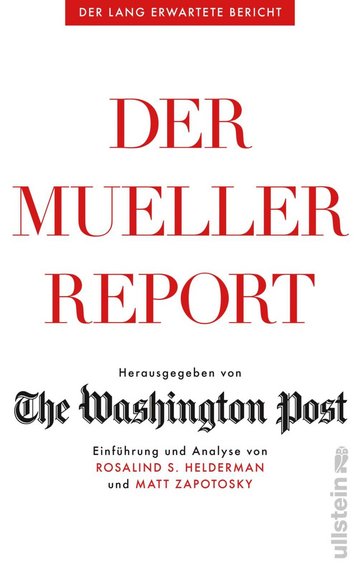Mueller und Trump:
Reich geboren, zum Führen erzogen, und doch Lebenswege, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten
Von Marc Fisher und Sari Horwitz
von The Washington PostII
Beide stammen sie aus reichem Haus und wurden in Familien groß, in denen man an Macht gewöhnt war. Sie wurden dazu erzogen, anderen mit Respekt zu begegnen und diesen auch für sich einzufordern. Und sie wurden früh auf Führungsrollen vorbereitet.
Sie stiegen in hohe Machtpositionen auf, zum Präsidenten der Vereinigten Staaten der eine, zu seinem Sonderermittler der andere. Sie kleiden sich förmlicher als die meisten Menschen in ihrer Umgebung und treten in der Öffentlichkeit nur sorgfältig frisiert auf. Die Menschen, die an sie glauben, bringen ihnen außergewöhnlich hohe Loyalität entgegen. Sie haben beide private Eliteschulen für Jungen besucht, waren in der Highschool ausgezeichnete Sportler und haben an Ivy-League-Colleges studiert. Und beide erlebten in jungen Jahren den Tod eines Menschen, den sie sehr bewunderten, als tiefen Einschnitt.
Und doch möchte man meinen, Robert Swan Mueller III und Donald John Trump, geboren im Abstand von 22 Monaten in New York, kämen von verschiedenen Planeten. Der eine ist höflich, klar und präzise, der andere stürmisch und dreist. Der eine wandte sich vom Streben nach immer mehr Reichtum ab, der andere hingegen brachte ein halbes Jahrhundert damit zu, sein Vermögen auf jede nur erdenkliche Weise zu mehren.
In den Schlüsselmomenten ihres Lebens trafen die beiden völlig unterschiedliche Entscheidungen – als Studenten, als junge Männer im wehrfähigen Alter vor dem Dilemma des Vietnamkrieges und als ehrgeizige Alphamännchen, die entscheiden mussten, worauf sie ihre Energie konzentrieren sollten.
Nun standen sie einander gegenüber in einer schleichenden Dauerkonfrontation, deren Ausgang alles mit sich bringen kann, vom vertieften politischen Zwiespalt bis zum tödlichen Schlag für diese Präsidentschaft. In den Russland-Ermittlungen, die sich über mehr als zwei Jahre hinzogen, haben Trump (72) und Mueller (74) sich verhalten, wie sie dies ihr Leben lang gemacht haben: Der Präsident tobte, sprach empört von »Hexenjagd« und beklagte sich darüber bei seinen Anhängern. Der Sonderermittler äußerte sich nicht ein einziges Mal in der Öffentlichkeit, sondern ließ seine Ermittlungen, Anklageschriften und – endlich – einen Abschlussbericht für sich sprechen.
Die Monate vergingen, der finale Showdown zeichnete sich bedrohlich am Horizont ab: Mueller und Trump, der Kriegsheld und der Drückeberger. Zwei Männer, die früh aufstehen und ihr Leben weitgehend im Büro verbringen. Zwei Männer, die zur Entspannung Golf spielen. Sie umkreisten einander, sprachen jedoch nie dieselbe Sprache. Der eine wütete vehement gegen den Verdacht, es könnten Tatbestände existieren, die der Aufklärung bedürfen. Der andere hielt an seiner lebenslangen Überzeugung fest, dass Fakten ans Tageslicht müssen und nur ihre Offenlegung alle Zweifel ausräumt.
Immer wieder gaben ihre Mitarbeiter Kommentare ab, ob und wann es zu einem Treffen der beiden kommen würde. Am Ende kommunizierten sie dann doch nur schriftlich. Der eine schickte seine Fragen, der andere seine Antworten. Beide taten, was ihre Aufgabe erforderte, der eine laut, der andere schweigsam. Und keiner von beiden wusste, wie dieses dramatische und polarisierende Kapitel amerikanischer Geschichte enden würde.
Von Princeton zu den Marines
Mueller wurde in eine Gesellschaftsschicht hineingeboren, die in dieser Form mittlerweile nahezu ausgestorben ist – die einer weißen angelsächsisch-protestantischen Elite im Nordosten des Landes, die ihre Söhne in die Privatschulen von Neuengland schickt, gebaut von ererbtem Reichtum von Generationen.
Muellers Vater war Manager bei DuPont und Teil einer Familie, die fest in der Plutokratie des Landes verankert war. Mueller wuchs in Princeton und der Philadelphia Main Line auf, dem reicheren Landstrich der Metropolregion Philadelphia, und ging in St. Paul’s in New Hampshire zur Schule, dort, wo die Astors, Vanderbilts und Mellons ihren männlichen Nachwuchs erziehen lassen. In dieser Schule, die sich der Episcopal Church zurechnet, wurde er Kapitän des Fußball-, Eishockey- und Lacrosseteams. Er spielte Eishockey mit seinem Klassenkameraden John F. Kerry, dem späteren Außenminister und einem von drei St. Paul’s-Schülern, die sich später um die Präsidentschaft bewarben.
Mueller war der Inbegriff des »muskelbepackten gläubigen Christen«, wie man sie an der Spitze vieler Prep Schools findet. Der Archetyp des starken, jungen Mannes, der »Werte wie Güte, Respekt und Integrität« verkörperte, wie der 73-jährige Maxwell King meint, der mit Mueller zur Schule ging. »Bob hatte in der Klasse eine starke Stellung … Man wusste, dass er hohe Ansprüche stellte, sich aber auch um jeden in der Gruppe kümmerte.«
King, Ex-Herausgeber des Philadelphia Inquirer und Leiter der Pittsburgh Foundation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Lebensqualität der Menschen in der Metropolregion Pittsburgh zu verbessern, meint, Mueller hätte »Sinn für Humor« und sei »trotzdem kein Klugscheißer«. Und weiter: »Er war ein ernsthafter Typ, aber auf eine Weise, dass jeder ihn mochte und gern mit ihm zusammen war.«
Mueller war von frühester Jugend an anderen ein Vorbild. Einmal, als er und ein paar Mitschüler sich vor dem Imbissstand der Schule versammelt hatten, habe einer der Jungs eine abfällige Bemerkung über einen Nicht-Anwesenden gemacht. »Bob unterbrach ihn und meinte, er wolle so etwas nicht hören«, erzählt King. »Wir sagten uns zwar immer knallhart die Meinung, aber sich über jemanden abfällig zu äußern, der sich nicht wehren konnte, widerstrebte Bob einfach. Das sagte er klar und deutlich und ging dann wieder zur Tagesordnung über.«
In Princeton, wo auch sein Vater studiert hatte, war Mueller Mitglied eines der exklusivsten »Eating Clubs«, in denen sich die Studenten treffen, um gemeinsam zu Abend zu essen und über die unterschiedlichsten Themen zu debattieren. Meist tauchte Mueller schon vor dem Dinner auf und spielte Bridge am Kamin im Salon. Mueller wollte ursprünglich Medizin studieren, aber einer seiner Mitschüler berichtet, dass er sich mit der organischen Chemie nicht recht anfreunden konnte. Irgendwann warf Mueller das Handtuch, weil er einsah, dass er nicht zum Arzt geboren war.
Wenige Wochen nachdem er Princeton 1966 mit einem Abschluss in Politikwissenschaften verlassen hatte, verpflichtete er sich zum Dienst im Marineinfanteriekorps der Vereinigten Staaten, was zu jener Zeit für einen Ivy-League-Absolventen eher ungewöhnlich war. Schließlich versuchten die meisten jungen Männer damals, dem Wehrdienst zu entgehen. Mueller, der ein Interview ablehnte, erzählte häufig, die Idee mit den Marines sei ihm gekommen, als sein Lacrosse-Teamkollege David Hackett, der seinen Abschluss ein Jahr vor Mueller gemacht hatte, als Soldat nach Vietnam gegangen war.
»Als wir uns damals auf die Abschlussprüfungen vorbereiteten, standen wir vor der Frage, wie wir uns zum Vietnamkrieg stellen sollten«, sagte Mueller in einer 2017 gehaltenen Rede. »Eine Reihe von [Hacketts] Freunden und Teamkameraden hatten sich seinem Beispiel folgend zu den Marines gemeldet. Genau wie ich.« Im April 1967 wurde Zugführer Hackett, der mit seinen Kameraden gefallene Soldaten aus der Kampfzone holen sollte, von einem nordvietnamesischen Heckenschützen in den Hinterkopf geschossen. Mueller bezeichnet Hacketts Tod bis heute als Wendepunkt in seinem Leben, als das Erlebnis, das ihn dazu bewog, in den Staatsdienst einzutreten.
Vor Antritt seiner militärischen Ausbildung – Mueller musste zuerst eine Knieverletzung ausheilen lassen –, studierte er Internationale Beziehungen an der New York University. Dem Studium folgte die Ausbildung an der Akademie für Offiziersanwärter beim Marineinfanteriekorps in Quantico, wo er ausgezeichnete Leistungen zeigte – bis auf eine schlechte Note im Delegieren von Aufgaben. Danach durchlief er die berüchtigte Ranger School und die Airborne School – was für einen Marineinfanteristen eine unübliche Fortsetzung seiner Ausbildung war. Schon daran lässt sich ablesen, dass man beabsichtigte, ihn an die Front zu schicken.
Und tatsächlich überantwortete man ihm im November 1968 einen Zug Marineinfanteristen in den Wäldern Vietnams.
Ab zur Militärschule
Wie Mueller wuchs auch Trump in einer Welt voller Annehmlichkeiten auf. Die Trumps hatten einen eigenen Koch und einen Chauffeur, verstanden sich aber nie als Teil der herrschenden Klasse. Sie waren Einwanderer aus Deutschland und Schottland, kühne Unternehmer, die das Land im Eiltempo mit neuen Geschäften überzogen – Restaurants, Hotels und schließlich ein Immobilienunternehmen.
Fred Trump, der Vater des US-Präsidenten, hatte sein Vermögen selbst verdient. Er baute Mittelklassehäuser für die Gewerkschafter und Beamten der Randbezirke von New York. Selbst als er schon zu den größten Bauunternehmern der Stadt gehörte, krempelte Fred Trump noch selbst die Ärmel hoch und nahm den jungen Donald mit, wenn er im Trump Village in Brooklyn von Haus zu Haus ging, um die Miete zu kassieren.
Donald Trump wuchs in einer 23-Zimmer-Villa in Queens auf, in einem den großen Herrenhäusern der Südstaaten nachempfundenen Bauwerk mit einem Cadillac in der Einfahrt. Vom Kindergartenalter an besuchte er Privatschulen. Trump erzählte der Washington Post 2016, in der Schule habe er sein...