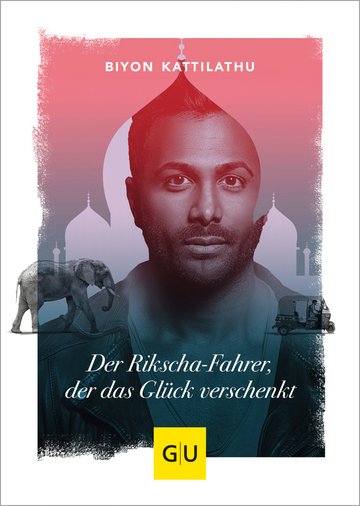Nanni und ich im Großstadtdschungel
Manche sagen, die Stadt sei ein Labyrinth, andere klagen über den Schmutz und die schlechte Luft; doch für mich ist Delhi die schönste Stadt der Welt. Da sind die winkligen Gassen der Altstadt und der Basar von Chandni Chowk, da sind die breiten Straßen des Regierungsviertels und da ist der Yamuna, ein Nebenfluss des Ganges, der sich durch das Stadtgebiet windet. Besonders mag ich das Gewusel in den Straßen: kleine Stände, die köstliche Essensdüfte verbreiten. Menschenmengen, deren bunte Saris wunderschöne Mosaikbilder weben. Hupkonzerte von Fahrern, die keine Zeit oder einfach nur Spaß am Gehupe haben, das lauter ist als der jährliche Militärmarsch zum Nationalmuseum. Schrille Werbeplakate für die neuesten Bleaching-Cremes, die einem weismachen wollen, dass es so viel schöner ist, hellhäutig zu sein. Überall wird gerufen, gestritten, gefeiert und gelacht.
Und mittendrin bin ich mit meiner Rikscha: schwarzes Blech, ein gelbes Dach. Auf den ersten Blick sieht sie aus wie die anderen 80 000 Rikschas, die in Neu-Delhi unterwegs sind. Aber meine Rikscha ist etwas Besonderes. Okay, von außen kann man kaum einen Unterschied zu den anderen „Tuk-Tuk-Taxis“ bemerken, aber innen habe ich meine Rikscha liebevoll eingerichtet. So gibt es eine Lichterkette, die abwechselnd bunt blinkt und bei der ich sogar per Knopfdruck bestimmen kann, wie schnell sich die Farben ändern. Oft frage ich meine Fahrgäste nach ihrer Lieblingsfarbe und überrasche sie dann mit dem Farbenspiel, sodass sie ihre Fahrt in der Nanni noch mehr genießen können.
Ja, meine Rikscha hat einen Namen: Nanni. Das heißt „danke“. In kleinen weißen Buchstaben prankt das Wort über dem linken Hinterrad. Es soll mich immer daran erinnern, dankbar zu sein. Denn das, so habe ich im Laufe der Jahre gelernt, zählt zu den wichtigsten Dingen überhaupt.
Außerdem läuft bei mir immer gute Musik. Also keine klassische Musik oder Heavy Metal oder so, sondern fröhliche Bollywood-Musik. Manche finden die Bollywood-Filme und ihre Musik kitschig. Mag ja sein, dass sie kitschig sind. Aber das heißt nicht, dass sie schlecht sind. Sie sind vor allem eins: übertrieben. Übertrieben romantisch, übertrieben schrill, übertrieben bunt, übertrieben laut, übertrieben traurig, übertrieben fröhlich.
Aber genau deswegen mag ich sie so sehr: Denn über unseren Herzen liegt oft ein Schleier aus Zweifeln, Ängsten, Gedanken und komplizierten Gefühlen. Und um diesen Schleier zu durchdringen und unser Herz zu berühren, muss es eben manchmal etwas mehr sein: mehr Romantik, mehr Farben, mehr Trauer, mehr Freude. Einfach mehr!
Es ist einer dieser heißen Tage, an denen einem bereits morgens der Schweiß auf der Stirn steht. Ich will gerade in meine Rikscha steigen, als mein Nachbar Malik „Guten Morgen, Rahul!“ ruft.
„Ob es ein guter Morgen wird, wird sich noch zeigen“, entgegne ich mit einem Lächeln. Ich schaue kurz in die Ferne und dann wieder zu Malik und rufe ihm zu: „Ich habe mal für uns nachgeschaut: Heute ist ein guter Tag, um ein guter Tag zu werden!“
Optimismus, behaupten meine Freunde, ist mein zweiter Name.
Ich starte den kleinen Motor, gebe mit einem gekonnten Handgriff etwas Gas und fahre los. Die Lichter blinken in Grün, aus den kleinen Boxen schrillen die ersten Töne des bekannten Bollywood-Songs Jai Ho und ich mache mich auf in Richtung Zentrum. Optimismus, behaupten meine Freunde manchmal, ist mein zweiter Name. Warum auch nicht? Klingt doch viel besser als Rahul, der Pessimist, oder?
„Jaaai Hooo. Jaai Hooooo.“ Ich finde, dass ich der am besten singende Rikscha-Fahrer von Delhi bin. Na ja, zumindest im Osten Delhis bis zur Gandhi Street, Ecke Nehru Street. Ich weiß, das behaupten viele von sich. Aber ich bin mir sicher, dass es bei mir stimmt.
Vor mir schlägt die Ampel auf Rot um und ich nähere mich einem alten 1998er TATA, der vor mir zum Stehen gekommen ist. Durchs Heckfenster sehe ich bereits einen Hut, der voller Rhythmusgefühl hin und her wippt. Als ich mich auf die Spur links von ihm stelle, dringt Musik aus dem Radio herüber. Ich schaue in den TATA. Ein Herr um die fünfzig singt so inbrünstig mit, als sei dies seine letzte Nachricht an die Menschheit. Er wendet den Kopf, sieht meinen Blick und hört innerhalb einer tausendstel Sekunde auf zu singen. Plötzlich ist sein Kopf mitsamt Schnäuzer und Hut schnurstracks nach vorne hin ausgerichtet. Der Mann hält sich so starr, als ob ihn eine unsichtbare Halskrause stützt.
Wie schade, denke ich, warum bloß?
Zwei Erklärungen schießen mir durch den Kopf. Die erste: Als er mich sieht, wird dem Fahrer schlagartig bewusst, dass der beste Sänger Delhis gerade neben ihm an der Ampel steht, und aus Respekt hört er auf zu singen. Zweite Möglichkeit: Er schämt sich. Auch wenn ich von meinen Gesangskünsten schwer überzeugt bin, erscheint mir Möglichkeit zwei plausibler.
Er schämt sich also. Doch warum? Und vor wem? Gerade eben war er ganz fröhlich und entspannt. Er musste nichts tun. Er wollte nichts darstellen. Er war einfach. Und nun? Er denkt darüber nach, was ich über ihn denken könnte. Er will mir, einem Unbekannten, gefallen. Und er scheint zu glauben, dass er mir als Wachsfigur mit unsichtbarer Halskrause besser gefällt.
Klar, wir Menschen sind im Grunde Herdentiere und darauf angewiesen, mit anderen zurechtzukommen – nirgendwo bekommt man das täglich so deutlich zu spüren wie in Delhi, wo circa sechstausend Menschen auf einen Quadratkilometer kommen und man sich hin und wieder schon wie eine Ölsardine in der Blechbüchse fühlt. Aber das heißt doch nicht, dass wir uns verbiegen müssen – was im Übrigen oft vollkommen unnötig ist. Denn ich für meinen Teil liebe den Anblick anderer Gesangstalente, die hinter dem Lenkrad kräftig mitschmettern.
Ich nehme eine scharfe Kurve und drehe mein Radio etwas lauter. Selbst nach all den Jahren ist Radiohören für mich immer noch ein Luxus, den ich in vollen Zügen genieße.
Denn aufgewachsen bin ich im Slum. Meine Eltern, meine Großeltern, meine vier Geschwister und ich lebten auf engstem Raum in einer aus Wellblech und sonstigen Fundstücken zusammengezimmerten Hütte. Unsere Habseligkeiten beschränkten sich auf das Nötigste; für mehr wäre in unserer Hütte auch kein Platz gewesen. Durch die dünnen Wände bekamen wir alles von den Nachbarn mit – uns sie von uns.
Meine Mutter war den ganzen Tag damit beschäftigt, irgendetwas zu essen zuzubereiten, während wir Kinder uns nach den unregelmäßigen Schulstunden draußen herumtrieben. Manchmal spielten wir mit Gleichaltrigen, manchmal stöberten wir in der etwas entfernter liegenden Müllkippe nach Brauchbarem in der Hoffnung, dies zu verkaufen oder gegen etwas Essbares einzutauschen.
Mein Vater stellte aus alten Reifen Latschen für die Slumbewohner her. Im Gegenzug erhielt er von den Leuten das, was sie eben hatten: Reis, Nägel, Plastikplanen, Decken, Streichhölzer, Fisch; manchmal sangen sie ihm ein Lied vor, erzählten ihm Geschichten oder gaben ihm selbst geschnitzte Tiere und Gottheiten aus Holz. Als Kind liebte ich dieses wilde Sammelsurium – es waren so viele Überraschungen dabei! –, aber satt wurde man davon natürlich nicht unbedingt. Hunger wird oft als „nagend“ beschrieben, und da ist etwas dran. Zumindest vergisst man dieses Gefühl seinen Lebtag nicht. Erst später ist mir klar geworden, dass auch Geschichten eine Art von Reichtum darstellen.
Wie jeden Morgen fahre ich zu meinem Lieblingsimbiss. Ich nehme die drei Stufen des Delhi Food & Drinks mit einem großen Schritt und stehe an der Theke des kleinen Cafés. Dort wird der Chai zubereitet, also schwarzer Tee mit Milch, eine Tradition der Briten, die sich auch nach deren fast hundertjähriger Kolonialherrschaft gehalten hat. Ganz unbritisch ist hingegen der wunderbare Geruch frisch gebackener Dosas, eine Art Pfannkuchen mit Linsen, Kokosnuss und Kartoffeln, der mir in die Nase steigt.
„Lass mich raten, Rahul: ein Dosa und einen Chai“, höre ich hinter mir eine tiefe Stimme, bevor die Hand, die zu dieser Stimme gehört, auch schon meine Schulter packt.
„Santosh, komm, geh Lotto spielen. So gut wie du heute rätst, hast du große Chancen zu gewinnen!“, antworte ich.
Wir beide lachen, denn das esse ich seit Jahren jeden Morgen zum Frühstück. Tag für Tag, ohne Ausnahme. Santosh drängt mich immer, etwas Neues auszuprobieren, aber ich weigere mich standhaft. Ich mag eben Sachen, die ich kenne. Und Dinge, die man mag, zu wiederholen, ist in meinen Augen ein gutes Rezept für Zufriedenheit. Wenn mich ein Dosa glücklich macht, dann bestelle ich ein Dosa. Wenn es jemanden glücklich macht, den Himmel anzuschauen, dann sollte er das möglichst oft tun. Und wenn jemand Freude verspürt, wenn er seinen Hund abknutscht, dann sollte er sich einen guten Lippenbalm besorgen und loslegen.
In dem Moment bringt mir ein Kellner schon meinen Tee.
„Nanni, Brinti“, sage ich und nicke leicht mit dem Kopf.
Ich mag Brinti. Er arbeitet schon so lange bei Santosh, dass er mittlerweile zur Familie gehört.
Ich weiß noch, wie Santosh mir von ihrer ersten Begegnung erzählte. Brinti war in das kleine Café gekommen und hatte um einen Tee gebeten, ohne jedoch eine Rupie in der Tasche zu haben. Sheila, Santoshs Frau, wollte ihm schon einen Chai bringen, aber Santosh hatte einen anderen Plan. Er gab Brinti einen kochend heißen Tee und stellte ein zweites, leeres...