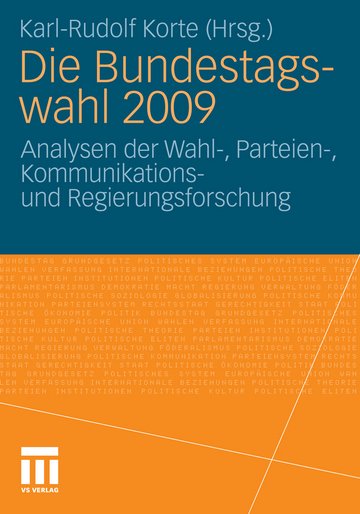| Inhalt | 5 |
| Die Bundestagswahl 2009 – Konturen des NeuenProblemstellungen der Regierungs-, Parteien-, WahlundKommunikationsforschung | 8 |
| 1 Regierungs- und Parteienforschung | 11 |
| 1.1 Koalitions-Lotterie: Neue Formeln zur Macht | 11 |
| 1.2 Weichgespülte Lager: Lähmungswirkungen der Großen Koalition | 12 |
| 1.3 Postmoderne Regierungsbildung: Europäische Formate | 14 |
| 1.4 Regieren in Kleinen Koalitionen | 16 |
| 1.5 Zukünftige Koalitionen | 17 |
| 2 Wahl- und Kommunikationsforschung | 19 |
| 2.1 Mobilisierungs-Paradoxien: Widersprüchliche Signale | 19 |
| 2.2 Wählerische Wähler: Koalitionswähler | 22 |
| 2.3 Ratlose Ruhe: Sicherheitskonservatismus | 23 |
| 3 Konturen des Neuen | 25 |
| Teil I: Wahlforschung | 32 |
| Wählerverhalten und WahlergebnisRegierungswechsel ohne Wechselstimmung1 | 33 |
| 1 Wahlergebnis | 37 |
| 2 Parteien und Sozialstruktur | 39 |
| 3 Ausblick | 44 |
| Der Wähler begegnet den ParteienDirekte Kontakte mit der Kampagnenkommunikationder Parteien und ihr Einfluss auf das Wählerverhaltenbei der Bundestagswahl 2009 | 46 |
| 1 Kontakte der Wähler mit der Kampagnenkommunikationder Parteien | 48 |
| 2 Kampagnenkontakte und Wählerverhalten | 55 |
| 2.1 Effekte auf die Wahlbeteiligung | 56 |
| 2.2 Effekte auf die Parteiwahl | 58 |
| 3 Fazit | 63 |
| Das fast vergessene PhänomenHintergründe der Wahlbeteiligung bei derBundestagswahl 2009 | 67 |
| 1 Hintergründe der Wahlbeteiligung – vier Modelle | 69 |
| 2 Daten und Indikatoren | 72 |
| 3 Empirische Ergebnisse | 75 |
| 3.1 Strukturmodell | 75 |
| 3.2 Bürgermodell | 77 |
| 3.3 Nutzenmodell | 78 |
| 3.4 Kontextmodell | 79 |
| 3.5 Ein integriertes Modell | 81 |
| 4 Fazit | 82 |
| Teil II: Parteienforschung | 85 |
| Was stand zur Wahl 2009?Grundsatzprogramme, Wahlprogramme und derKoalitionsvertrag im Vergleich | 86 |
| 1 Methodik | 87 |
| 2 Ergebnisse | 93 |
| 2.1 Grundsatzprogramme | 93 |
| 2.2 Wahlprogramme | 98 |
| 2.3 Koalitionsvertrag | 104 |
| 3 Fazit | 109 |
| Volksparteien unter DruckKoalitionsoptionen, Integrationsfähigkeitund Kommunikationsstrategien nach derÜbergangswahl 2009 | 114 |
| 1 Die Bundestagswahl 2009 als „Übergangswahl“ | 115 |
| 2 Veränderte Koordinaten des politischen Wettbewerbs | 117 |
| 3 Veränderte Kernwählerschaften und innerparteilicheKonfliktlinien | 119 |
| 4 Kommunikation als Grundlage politischer Führung | 122 |
| Regieren und Parteienwettbewerb in einemnivellierten VielparteiensystemWas erwartet die deutschen Parteien? Eine Antwortaus den Niederlanden.Regieren und Parteienwettbewerb in | 127 |
| 1 Der elektorale Verfall der christdemokratischen undsozialdemokratischen Volksparteien | 127 |
| 2 Zwei neue Parteitypen und die Regierungsbildung in einemMehrparteiensystem | 131 |
| 3 Erschwerte Koalitionsbildung, handlungsunfähigeRegierungen und die Erosion der Mitte | 134 |
| 4 Der unaufhaltbare Aufstieg Geert Wilders | 137 |
| 5 Der Fall des Kabinetts Balkenende und die Neuwahlen.Doch ein Lagerwahlkampf? | 138 |
| 6 Fazit | 141 |
| Lernen von Österreich?Parteienwettbewerb und Regierungsbildung imZerrspiegel der Alpenrepublik | 146 |
| 1 Österreich – Land der Großen Koalitionen? | 147 |
| 2 Vergleich, erster Teil: Die begrenzte Zahl „germanischerGemeinsamkeiten“ | 149 |
| 3 Vergleich, zweiter Teil: Unterschiede deutscher undösterreichischer Parteiendemokratie | 153 |
| 4 Ausblick: Zukunft ungewiss | 159 |
| Wird das deutsche Parteiensystem „europäischer“?Die Entwicklung des deutschen Parteiensystems imeuropäischen Vergleich | 164 |
| 1 „Europäisierung“ des Parteiensystems – begriffliche undkonzeptionelle Probleme | 165 |
| 2 Indikatoren für den Vergleich von Parteiensystemen inWesteuropa | 169 |
| 3 Merkmale der Entwicklung des deutschen Parteiensystemsim Vergleich mit anderen westeuropäischen Ländern | 173 |
| Teil III: Kommunikationsforschung | 181 |
| Zur Modernisierung und Professionalisierung desWahlkampfmanagementsDie Kampagnenorganisationen im Vergleich | 182 |
| 1 Modernisierung, Professionalisierung, Medialisierung | 184 |
| 1.1 Modernisierung | 184 |
| 1.2 Professionalisierung | 186 |
| 1.3 Medialisierung | 188 |
| 2 Wahlkämpfe in der Bundesrepublik:Eine Skizze unter kommunikativen Gesichtspunkten7 | 190 |
| 3 Die Kampagnenorganisationen im Bundestagswahlkampf2009 | 200 |
| 3.1 Allgemeine Anmerkungen | 200 |
| 3.2 Die CDU | 203 |
| 3.3 Die SPD | 205 |
| 3.4 Die FDP | 206 |
| 3.5 Bündnis 90/Die Grünen | 208 |
| 3.6 Die Linke | 210 |
| 4 Synthese und Fazit | 211 |
| Politik im „Social Web“Der Onlinewahlkampf 20091 | 222 |
| 1 Webwahlkampf auf allen Kanälen | 224 |
| 2 Politiker & Parteien im „Social Web“ | 226 |
| 3 Die Piratenpartei entert das Netz | 228 |
| 4 Überparteiliche Wählermobilisierung – Und alle so: Yeaahh! | 229 |
| 5 Direkte Kommunikation, Dialogkommunikation undBürgerpartizipation | 231 |
| Das „Kanzlerduell“ als Multimedia-DebattePolitische Kommunikation und Bürgerbeteiligungzwischen TV und Internet | 234 |
| 1 TV-Debatten als Format der Mediendemokratie | 235 |
| 2 Die Debatte im Fernsehen | 238 |
| 2.1 Duell oder Duett? | 239 |
| 2.2 Die Debatte nach der Debatte | 242 |
| 2.3 Die doppelte Agenda der Kanzlerdebatten | 243 |
| 3 Die Debatte im Netz | 244 |
| 3.1 Digitalisierung der Debattenformate | 244 |
| 3.2 Die Netzdebatte vor der Debatte | 248 |
| 3.3 Die Echtzeit-Debatte zum „Kanzlerduell“ | 249 |
| 3.4 Auf dem Weg zur dreifachen Agenda? | 252 |
| 4 Die nächste Debatte ist immer die schwerste | 253 |
| The Battle for the BallotPursuing the Volatile Voter | 257 |
| 1 The American Exceptions | 258 |
| 2 The Challenges Ahead | 260 |
| 3 Lessons for Germany? | 262 |
| Teil IV: Regierungsforschung | 266 |
| Reduzierter Parteienwettbewerb durch kalkulierteDemobilisierungBestimmungsgründe des Wahlkampfverhaltens imBundestagswahlkampf 2009 | 267 |
| 1 Parteienwettbewerb als Kalkül rationaler Akteure | 269 |
| 2 Eine rationale Rekonstruktion des reduziertenParteienwettbewerbs 2009 | 274 |
| 2.1 Selbstrestriktion durch Kalkül der Koalitionstreue? | 274 |
| 2.2 Reduzierter Parteienwettbewerb durch ein Kalkül derKoalitionsoptionen? | 278 |
| 2.3 Das Kalkül der Demobilisierung | 280 |
| 3 Große Koalitionen – keine Zwangsläufigkeit reduziertenParteienwettbewerbs | 288 |
| Das Ende der Lagerpolarisierung?Lagerübergreifende Koalitionen in den deutschenBundesländern 1949-2009 | 292 |
| 1 Der Begriff des politischen Lagers | 293 |
| 2 Datenbasis und Operationalisierung des Lagerbegriffs | 295 |
| 3 Lagerübergreifende Koalitionen in den deutschenBundesländern | 297 |
| 3.1 Zeitliche und räumliche Struktur lagerübergreifender Koalitionen | 297 |
| 3.2 Koalitionsstruktur der lagerübergreifender Koalitionen | 300 |
| 4 Erklärung lagerübergreifender Koalitionen überEigenschaften des Parteiensystems | 303 |
| 4.1 Hypothesen zum Einfluss von Eigenschaften des Parteiensystems | 303 |
| 4.2 Bivariate Zusammenhänge | 306 |
| 4.3 Multivariate Analyse | 307 |
| 5 Fazit | 309 |
| Unpopulär aber ohne Alternative?Dreier-Bündnisse als Antwort auf dasFünfparteiensystem | 314 |
| 1 Einflussfaktoren für die Koalitionsbildung | 315 |
| 2 Rot-rot-grün: Annäherung in der Opposition? | 321 |
| Inhaltliche Kompatibilität | 321 |
| Vertrautheit | 322 |
| Strategie | 323 |
| 3 Rot-gelb-grün: Dritte Umorientierung der FDP? | 325 |
| Inhaltliche Kompatibilität | 325 |
| Vertrautheit | 325 |
| Strategie | 326 |
| 4 Schwarz-gelb-grün: Langer Marsch der Grünen? | 328 |
| Inhaltliche Kompatibilität | 328 |
| Vertrautheit | 329 |
| Strategie | 330 |
| 5 Fazit | 332 |
| Ein schwarz-gelbes Projekt?Programm und Handlungsspielräume derchristlich-liberalen Koalition | 339 |
| 1 Theoretische Vorüberlegungen: Parteiendifferenztheorieund Parteienwettbewerb | 341 |
| 2 Der Koalitionsvertrag im Lichte der Parteiendifferenztheorie | 344 |
| 2.1 Schlüsselprojekte schwarz-gelber Reformpolitik | 344 |
| 2.2 Programmatische Kontinuitäten und Ansteckungseffekte | 347 |
| 2.3 Zwischenfazit: Steuersenkungen mangels alternativer Reformmasse | 351 |
| 3 Die Handlungsspielräume der Koalition: Vetopunkte,volkswirtschaftliche Restriktionen und Parteienwettbewerb | 352 |
| 3.1 Vetospieler und institutionalisierte Vetopunkte | 353 |
| 3.2 Volkswirtschaftliche Restriktionen und Parteienwettbewerb | 357 |
| 4 Fazit: Eine verspätete Koalition? | 360 |
| Tabellen- und Abbildungsverzeichnis | 365 |
| Literaturverzeichnis | 369 |
| Autorenverzeichnis | 398 |
| Dank | 400 |