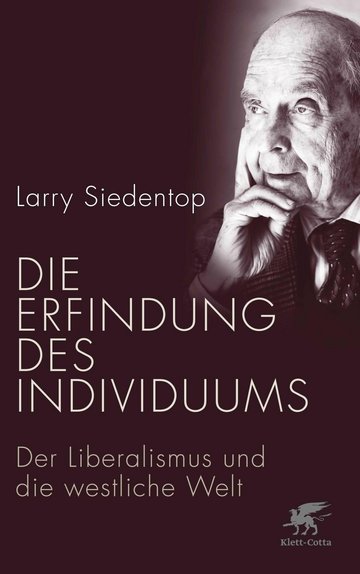1
Die antike Familie
Wenn wir im Westen die Welt verstehen wollen, die wir geschaffen haben, müssen wir zunächst eine ganz andere, uns sehr ferne Welt verstehen – fern nicht im Raum, sondern in der Zeit.
Häufig lebt die ferne Vergangenheit auf überraschende Weise fort. Betrachten wir den Brauch, dass der Ehemann seine Braut über die Schwelle des neuen Heims trägt. Wer würde auf die Idee kommen, dass in dieser liebenswerten Sitte Überzeugungen aus einer Gesellschaft überleben, die sich von der unseren radikal unterschied? Es war eine in vielerlei Hinsicht abstoßende Gesellschaft, in der Ahnenverehrung, Familienkult und Erstgeburtsrecht völlig ungleiche soziale Identitäten schufen, nicht nur zwischen Männern und Frauen, sondern auch zwischen dem Erstgeborenen und den übrigen Söhnen.
Um also eine Sitte zu verstehen, die ursprünglich nicht liebenswert, sondern streng und verpflichtend war, müssen wir uns von unseren vorgefassten Meinungen verabschieden. Wir müssen uns in eine Welt versetzen, in der die Handlungsnormen ausschließlich die Ansprüche der Familie widerspiegelten, ihre Erinnerungen, Rituale und Rollen, und nicht die Ansprüche des individuellen Gewissens. Wir müssen uns eine Welt von Menschen oder Personen vorstellen, die nach unserem heutigen Verständnis keine Individuen waren.
Seit dem 16. Jahrhundert und der Entwicklung des Nationalstaates verstehen die Menschen im Westen unter »Gesellschaft« einen Zusammenschluss von Individuen. Noch vor kurzem kam das Empfinden von einer Andersartigkeit hinzu, die Auffassung, andere Kulturen hätten eine andere Organisationsgrundlage – die Kaste etwa, den Clan oder den Stamm. Doch in den letzten Jahrzehnten hat der westliche Einfluss auf den Rest der Welt durch den Kapitalismus, die Ausbreitung der Demokratie und die Sprache der Menschenrechte dieses Gefühl des Andersseins verringert. Die Globalisierung hat es dem Westen erleichtert, sein individualisiertes Gesellschaftsmodell – eines, das individuelle Präferenzen und rationale Entscheidungen bevorzugt – auf die ganze Welt zu projizieren.
Wir sind Opfer unseres eigenen Erfolgs geworden. Denn wir laufen Gefahr, diesen Primat des Individuums als etwas »Offenkundiges« oder »Unvermeidliches« hinzunehmen, etwas, was durch Dinge außerhalb unserer selbst statt durch historische Überzeugungen und Kämpfe garantiert wird. Natürlich hat jeder Mensch einen Körper und Geist. Aber beweist das, dass die menschliche Gleichheit von der Natur und nicht der Kultur bestimmt wird?
Die Natur in Form der genetischen Ausstattung ist eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung. Die Gleichheit bedarf auch einer rechtlichen Basis in Gestalt der Grundrechte für jede Person. Um das zu erkennen, müssen wir nicht nur verstehen, dass sich die westliche Welt weit von ihren Ursprüngen entfernt hat, sondern auch, wie und warum das geschehen ist. Wir müssen die zwischen damals und heute liegenden Schritte nachvollziehen. Das wird nicht immer leicht sein. Weitverbreitete Selbstgefälligkeit über den Sieg eines individualisierten Gesellschaftsmodells lässt auf einen beunruhigenden Rückgang des historischen Verständnisses schließen. Wenn wir beispielsweise Aristoteles’ Definition des Sklaven als »beseeltes Werkzeug« oder die Annahme, Frauen seien nicht zu vernünftigem Handeln in der Lage, lediglich für »Fehler« halten – für Symptome eines unterentwickelten Rechtsempfindens –, erweisen wir damit dem Verständnis der Vergangenheit einen schlechten Dienst. Schließlich war radikale soziale Ungleichheit in Gesellschaften mit weitverbreitetem Analphabetismus plausibler und leichter aufrechtzuerhalten.
Es ist üblich, die Ursprünge der westlichen Kultur nach Griechenland, Rom und in die jüdisch-christliche Tradition zu verlegen. Welche dieser Quellen sollen wir für die wichtigste halten? Die Frage wurde in verschiedenen Perioden verschieden beantwortet. Im Mittelalter galt das Christentum als entscheidende Quelle, eine Auffassung, die die Reformation im 16. Jahrhundert beibehielt. Im 18. Jahrhundert sah die Aufklärung das jedoch anders. Bei ihrem Angriff auf »Aberglauben« und Kirchenprivilegien versuchten die Aufklärer, den moralischen und geistigen Abstand zwischen dem modernen Europa und der griechisch-römischen Antike zu minimieren. Dazu maximierten sie die Entfernung zwischen dem »dunklen« Mittelalter und der »hellen« Aufklärung ihrer eigenen Zeit. Für sie hatten die Naturwissenschaft und die rationale Methode den christlichen Glauben als Motor des menschlichen Fortschritts abgelöst. Die Befreiung des Individuums von der gesellschaftlichen Hierarchie des Feudalismus und die Befreiung des menschlichen Geistes von den eigennützigen Dogmen der Kirche waren die Geburt der Moderne.
Das Jahrtausend zwischen dem Fall des Weströmischen Reichs und der Renaissance wurde ein unglückliches Zwischenspiel, ein Rückschritt der Menschlichkeit. Gibbons berühmte Geschichte vom Verfall und Untergang Roms verschaffte den modernen Europäern Gelegenheit zu eleganter Trauer um die verlorene Antike und bot ihnen obendrein vergnüglichen Anlass zu antiklerikalem Spott. Dabei kam die moralische Bedeutung der christlichen Glaubensvorstellungen häufig viel zu kurz. Gibbons Bemerkung über eine spätrömische Matrone, die ihre Tochter Christus weihte, weil sie unbedingt Gottes »Schwiegermutter« werden wollte, ist sehr bezeichnend. Für Gibbon und viele seiner Zeitgenossen bedeutete die moderne Epoche der individuellen Emanzipation eine Rückkehr zu dem freieren, weltlicheren Geist der Antike – eine Auffassung, die heute noch weitverbreitet ist, auch wenn sie inzwischen weitgehend vom heftigen Antiklerikalismus gereinigt ist.
Doch wie frei waren das antike Griechenland und Rom? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir uns näher mit den religiösen und moralischen Überzeugungen beschäftigen, aus denen sich die religiösen und moralischen Institutionen des antiken Stadtstaats, der Polis, entwickelt haben. Diese Überzeugungen haben einen ganz bestimmten Gesellschaftsbegriff hervorgebracht, einen Begriff, der bis zum 1. Jahrhundert n. Chr. nicht ernsthaft in Frage gestellt wurde.
Sobald wir uns die Überzeugungen und Bräuche aus der Frühzeit Griechenlands und Roms näher anschauen, die sich großenteils bis in ihre Blütezeit hielten, sehen wir uns in eine völlig fremde Welt versetzt – eine indoeuropäische Welt, die sogar älter ist als der Polytheismus, den wir normalerweise mit Griechenland und Rom verbinden. Wir lernen das Konzept einer Gesellschaft kennen, in der die Gesellschaft alles war. Sie war nicht nur (modern ausgedrückt) eine zivile, sondern auch eine religiöse Institution, in der der pater familias zugleich die Funktion des Richters und die des Hohepriesters innehatte.
Um dieser Welt habhaft zu werden – um zu sehen und zu fühlen, wie es war, in ihr zu sein und zu handeln –, bedarf es eines ganz außergewöhnlichen Sprungs unserer Phantasie. Der Autor, dem dieser Sprung in die Vorstellungswelt jener Menschen am besten gelungen ist, die vor einigen Jahrtausenden Griechenland und die italienische Halbinsel besiedelten, war der französische Historiker Fustel de Coulanges. In seinem Buch Der antike Staat (1864), einem der bemerkenswertesten Bücher des 19. Jahrhunderts, zeigt er, wie prähistorische religiöse Vorstellungen zunächst die familiären und dann die öffentlichen Institutionen Griechenlands und Roms prägten. Zum Wesen der antiken Familie schreibt er: »Das Studium der alten privatrechtlichen Verordnungen ließ uns über die Zeiten hinweg, die man die historischen nennt, eine Reihe von Jahrhunderten vage erkennen, in denen die Familie die einzige Gesellschaftsform war.«1
Beginnend mit den frühesten griechischen und römischen Gesetzestexten, begibt sich Fustel de Coulanges zurück in eine Welt, in der der Ahnenkult zur Entstehung einer Familienreligion führte. Sein Buch bleibt bei...