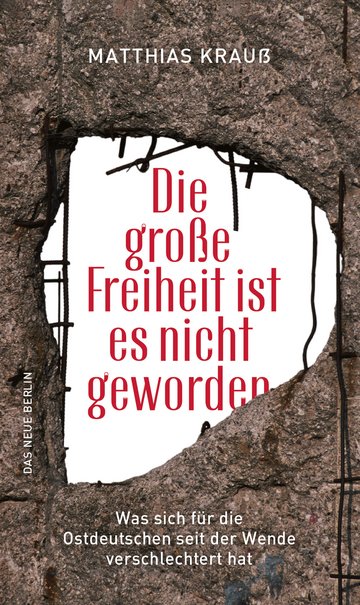Es blühte in der Vergangenheit
So manche schöne Erscheinung
Des Glaubens und der Gemütlichkeit –
Jetzt herrscht nur Zweifel, Verneinung …
Heinrich Heine
Mehr vereinigt – weniger vereint
Dreißig Jahre nach dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des westdeutschen Grundgesetzes bietet Ostdeutschland ein unklares, verworrenes, verstörendes, zum Teil beängstigendes Bild. Das Bild einer Gesellschaft, die nicht mit sich im Reinen ist. Aus einer demokratiebegeisterten Einwohnerschaft, wie es die Ostdeutschen 1990 waren, ist eine geworden, die immer stärker auf Abstand zu einer Demokratie geht, die vor drei Jahrzehnten erkämpft worden ist. In den traditionellen Parteien sind kaum noch politische Kandidaten auf lokaler Ebene aufzutreiben. Rassismus und Ausländerhass haben die Marktplätze wieder erreicht.
Immer weniger Menschen projizieren Hoffnungen in die traditionellen Parteien, das trifft auch für DIE LINKE zu. Wenn der Trend zum Nichtwählertum in den vergangenen Jahren partiell gestoppt und umgedreht werden konnte, so nicht, weil Ostdeutsche LINKE wählen, sondern die von rechts antretende AfD.
Wie konnte es dazu kommen, weshalb dieser Ausbruch im Osten und vor allem – wie kann das wieder korrigiert werden? Warum wählen so viele Unzufriedene und Enttäuschte nicht mehr links, sondern rechts? Für eine Partei wie die LINKE, deren historische Wurzeln in Ostdeutschland liegen, deren Selbstverständnis als Partei der »sozialen Gerechtigkeit« besteht, muss die Antwort auf die Frage zutiefst von Belang sein. Es ist für sie eine Frage der Existenz. Zu stellen hat sie sich auch die Sammlungsbewegung »Aufstehen«, die sich – unklar genug – ebenfalls als »links« versteht und präsentiert.
Dabei sind stabile Umfragewerte und ein partiell steigendes Ansehen der LINKEN in den alten Bundesländern anzuerkennen. Sie spielen aber nur bedingt in die ostdeutschen Gegebenheiten hinein. Es erscheint – vorerst jedenfalls – nicht das politische Projekt der LINKEN als solches gefährdet. Das gilt nicht mehr uneingeschränkt in ihrem Heimatland sozusagen, in den neuen Ländern.
Man kann es drehen und wenden, wie man will. Die PDS, später DIE LINKE, ist das Einzige, was von der DDR politisch übrig geblieben ist. Man mag es gut finden oder schlecht, man mag sich dazu gleichgültig verhalten oder nicht. So und nicht anders ist es. Ihre Herkunft aus der DDR macht sie besonders, auch nach so vielen Jahren.
Inwieweit berührt das eine Analyse der heutigen, bedrohlichen Gegebenheiten?
Ein beliebtes Mittel ist es, die besondere Lage im Osten mit den DDR-Gegebenheiten, mit »Diktaturerfahrung« und ähnlichem zu verbinden und zu begründen. Also quasi der DDR die Schuld daran zu geben, dass viele Menschen sich innerlich vom politischen System verabschiedet haben oder der Demokratie in ihrer herkömmlichen Form sogar ablehnend gegenüberstehen und sich in eine Feindschaft gegenüber Geflüchteten selbst flüchten. Nur eines darf diesen Quellen zufolge der Grund nicht sein: Die zum Teil deprimierenden Erfahrungen mit der Demokratie, welche die Ostdeutschen in den vergangenen dreißig Jahren gesammelt haben. Damit leisten sie ihren Beitrag zur Verworrenheit der Lage und sind, um es klar zu sagen, auf dem Holzweg.
Denn sind es überhaupt Erfahrungen mit »Diktatur« oder »Demokratie«, die hier bestimmend sind? Oder ist den Menschen nicht viel wichtiger, materielle Lebensziele zu erreichen, eine Grundbestätigung des Gerechtigkeitssinns zu erleben, das Gefühl zu haben, gebraucht und anerkannt zu sein und mit ihren Erfahrungen ernst genommen zu werden?
Hier gilt es, in den »Diskurs« einzugreifen. Denn man kann durchaus davon ausgehen, dass die DDR-Erfahrungen in die gegenwärtige Situation hineinspielen – aber in einem ganz anderen Sinne, als die offizielle Politik oder die maßgeblichen Medien dies zugestehen möchten. Wer ehrlich Antworten darauf sucht, warum Ostdeutschland das beschriebene Bild bietet, der wird in diesem Buch fündig werden. Mit der Phrase von der angeblich ersehnten »Anerkennung der Lebensleistung« hat das übrigens nichts zu tun, da gibt es Wichtigeres.
Statt Lohnangleich gibt es den stabilen Lohnabstand (wenn man vom öffentlichen Dienst absieht). Statt wachsender Massenkaufkraft gibt es eine rückläufige. Statt Selbstbestimmung haben wir die wirtschaftliche Fremdbestimmung. Statt gestoppter Abwanderung und Perspektive in der Heimat die schrittweise Entleerung und damit einhergehende sinkende Lebensqualität. Statt ausgeglichener kommunaler Haushalte allein 2010 ein Defizit von 12 Milliarden. Statt verbesserter Umweltbedingungen einen Rückgang bei Tier- und Pflanzenvielfalt. Statt sich zu verringern, sind die deutschen West-Ost-Unterschiede größer als regionale Differenzen in jedem anderen Land Europas.
Die Wende liegt jetzt fast dreißig Jahre zurück, und es steht zu vermuten, dass die Litanei »Es war richtig, richtig, richtig« anlässlich des bevorstehenden Jubiläums immer lauter wird. Hier ist eine sachliche Analyse am Platze, in der die seit der Wende eingetretenen Verbesserungen für die Ostdeutschen nicht erneut breit dargelegt werden, dennoch ihren Platz haben müssen. Aber nichts auf dieser Welt hat nur eine Seite. Und diese Verbesserungen hatten ihren Preis, der von einem zu zahlen war, vom anderen weniger. Damit stand Ostdeutschland nicht allein, der polnische Bürgerrechtler und Historiker Jacek Kuroń sagte einmal, die Entwicklung nach Beseitigung des Sozialismus habe für die Hälfte der Polen eine Verschlechterung gebracht. Kuroń war bis Oktober 1993 Arbeitsminister in den Regierungen von Tadeusz Mazowiecki.
Was wäre der Maßstab einer solchen Analyse aber in Ostdeutschland, was müsste ihr Maßstab sein? Der Einigungsvertrag, wie er 1990 zwischen der DDR und der BRD geschlossen wurde, kann es nur bedingt sein. Denn in ihm werden keine gesellschaftspolitischen Ziele festgelegt beziehungsweise nur in allgemeinster Form. Es handelt sich um ein Regelwerk, das umfassend und detailliert bestimmte, zu welchen Bedingungen Ostdeutschland Teil der Bundesrepublik sein durfte. Wer also aus dem Begriff Einigungsvertrag ableitet, dass damit eine gütliche Einigung, ein Ausgleich bei Streitfragen, ein Interessenausgleich gemeint war, der irrt. In diesem umfangreichen Vertragswerk ist festgehalten, in welcher Form, nach welchen Regeln der Osten sich anzuschließen hatte. Das reale Kräfteverhältnis der Verhandlungspartner, die historische Situation, die keinen anderen Ausweg zuließ, verliehen ihm von Anfang an den Charakter eines Diktats. Zu untersuchen wäre aber, wie selbst wohlmeinende oder gut klingende Vertragsbestimmungen (Anerkennung der DDR-Berufsabschlüsse zum Beispiel) in der Praxis unterlaufen oder entwertet werden.
Also nicht allein, dass die westliche Übermacht des Kapitals, die Geldmacht, ohnehin schon eine enorme Nachteilslage des Ostdeutschen erzeugen und seine Hoffnung, »Herr im Haus« zu bleiben, stark relativieren musste – er war zudem mit der Inkraftsetzung dieses Vertrags über Nacht einer ihm unbekannten, fremden Gesetzlichkeit, einem Rechtssystem unterworfen, das im Osten in bedeutenden Teilen keine Tradition, keine organische Herkunft hatte und einfach übergestülpt wurde. In der nun einziehenden Welt, in der die Reichen, Verbeamteten, Juristen und die Wendigen das Spiel bestimmen, hatte er die schlechtesten Karten.
Vereinheitlicht hat sich das geltende Recht insofern, als sich die Ostdeutschen 1990 in ihrem Rechtssystem dem bundesdeutschen angleichen beziehungsweise unterwerfen mussten. Das daraus resultierende Problem ist alt: Gleiches Recht auf ungleiche Bedingungen angewendet, muss Unrecht erzeugen. Oder um die hier gültige Formel von Anatole France zu zitieren, der von der majestätischen Gleichheit des Gesetzes schrieb, das Reichen wie Armen verbiete, unter Brücken zu schlafen, auf den Straßen zu betteln und Brot zu stehlen.
Was nach Inkraftsetzung des Einigungsvertrages mit Notwendigkeit folgte, war eine Katastrophe für Millionen Ostdeutsche. Auf die wirtschaftliche Verwahrlosung folgte die moralische. Der Osten wurde zum Armenhaus Deutschlands, das bis heute alimentiert werden muss, das als Absatzmarkt und Arbeitskräftereservoir fungierte, hoch verschuldet ist und selbst nach der Konjunktur der vergangenen zehn Jahre wenig mehr als die Hälfte dessen erwirtschaftet, was er verbraucht. In den zehn Jahren vor der Wende wurden in Ostdeutschland mehr als eine Million Kinder mehr geboren als in den zehn Jahren danach. Der Familienzusammenhalt geriet stark unter Druck. Das und der Wegzug der Jugend versetzte der Sozialstruktur Ostdeutschlands Schläge, von denen sie sich bis heute nicht erholt hat. Der Nachteil des »Ossis« vererbt sich auf seine Kinder, sie haben erwiesenermaßen geringere Chancen im Berufsleben als Gleichaltrige aus den alten Ländern. Die ausgezahlte Durchschnittsrente liegt unterhalb der gültigen Armutsgrenze. Die bedeutenden Massenmedien reagieren auf all dies – wenn überhaupt – relativierend, abstrakt oder formelhaft. Zweifelhafte Umfragen, die suggestiv den Optimismus trimmen, tragen zur Verdrossenheit...