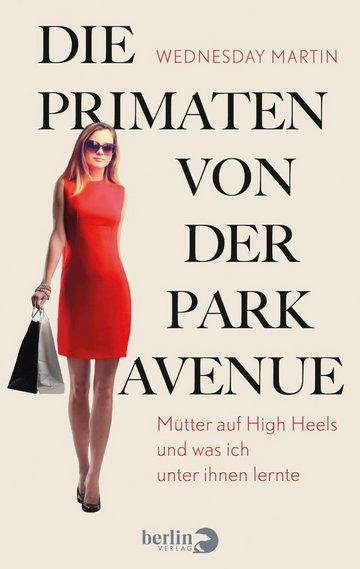EINLEITUNG
Unter den ersten Geschenken zur Geburt meines älteren Sohnes befand sich auch ein Babybuch von einer alten Freundin, selbst Mutter zweier Kinder, die noch immer in dem kleinen Nest in Michigan wohnt, wo wir gemeinsam aufwuchsen. Mit dem Geschenk wurde mein Sohn willkommen geheißen, zugleich aber der Umstand gewürdigt, dass ich mittlerweile an einem Ort lebte, der so ganz anders war als die Stätte unserer Kindheit: New York City. Urban Babies Wear Black ist ein launig illustriertes Pappbilderbuch, das mit der Prägnanz einer fünfminütigen Soziologievorlesung darlegt, inwiefern sich Großstadtbabys von anderen Babys unterscheiden – vom Outfit (schwarz und stylish statt rosa oder blau und auf niedlich getrimmt) über die Ernährung (Sushi und Café Latte statt Hot Dogs und Milch) bis hin zur Freizeitgestaltung (Opern- und Galeriebesuche statt Spielplatzfreuden). Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Buch mir selbst deutlich besser gefiel als meinem Kind. Während unserer ersten gemeinsamen Wochen zu Hause las ich es ihm immer wieder vor. Manchmal ertappte ich mich sogar bei der Lektüre, wenn es gerade schlief.
Irgendwann dämmerte mir, dass der Reiz des Buches darin lag, dass es auch über die Mütter der Babys etwas zu sagen hatte. Wenn diese Wesen ihre Knirpse quer über die Buchseiten schoben, schubsten, schleppten oder chauffierten und ihnen städtischen Schick verpassten – ganz die Mama –, erhaschte man stets nur kleine, verführerische Ausschnitte von ihnen: hier High Heels, dort eine modische Hundeleine. Ob Nageldesign oder pelzbesetzte Babytragen, all das nahm ich, während ich meinem Sohn vorlas, genauestens unter die Lupe. Wer waren sie wirklich, diese glamourösen, mondänen Frauen mit ihren weltgewandten Babys? Was taten sie da eigentlich? Und vor allem: Wie taten sie es?
Ich wollte mehr über diese Großstadtbabymamis in Erfahrung bringen, denn ich wollte mehr über meine eigene Gesellschaftsgruppe wissen: Mütter in Manhattan. Als Frau im industrialisierten Westen bemutterte ich meinen Nachwuchs ganz anders als die Menschen, die ich im Rahmen meiner Arbeit als Sozialforscherin jahrelang studiert und beschrieben hatte (Schwerpunkt unter anderem: evolutionäre Geschichte und Vorgeschichte des Familienlebens). Jäger und Sammler oder Wildbeuter, die heute noch so leben wie einstmals unsere Vorfahren, ziehen ihre Kinder in der Gemeinschaft groß, in einem dichten sozialen Netzwerk von Müttern, Schwestern, Nichten und anderen Geschlechtsgenossinnen, die die Kinder anderer Frauen so zuverlässig versorgen (ja sogar stillen), als wären es ihre eigenen. Als meine Brüder und ich in Michigan aufwuchsen, konnte meine Mutter auf eine Variante dieses Unterstützungssystems zurückgreifen: Wenn sie Besorgungen erledigen oder ein Nickerchen machen wollte oder wenn sie sich schlicht und einfach nach der Gesellschaft von Erwachsenen sehnte, stand ein gutes Dutzend Nachbarinnen, allesamt Vollzeitmütter, als Quasi-Verwandtschaft bereit, um uns zu hüten. Für uns bedeutete es: mit anderen Kindern zusammen zu sein. Die Hinterhöfe, durch die Wohnungen, Mütter und Kinder miteinander verbunden waren, brachten ein Geflecht aus reziprokem Altruismus hervor: Hilfst du mir, so helf ich dir. Heute habe ich vom Küchenfenster aus ein Auge auf die Kinder, morgen bist du an der Reihe. Danke fürs Mehl; wenn der Kuchen gar ist, bring ich dir ein, zwei Stück vorbei.
In krassem Gegensatz dazu lebten mein New Yorker Großstadtbaby und ich trotz unserer Nähe zu so vielen anderen Menschen völlig isoliert. Meine Nachbarn in Downtown Manhattan waren so sehr mit ihrem eigenen Leben beschäftigt, dass ich sie fast nie zu Gesicht bekam. Ihre sämtlichen Aktivitäten spielten sich in geschlossenen Räumlichkeiten ab: in Büros, Apartments und Schulen, abgeschirmt von der Öffentlichkeit. Meine Geburtsgruppe hatte ich verlassen, lebte weit entfernt von meinem Geburtsort und hatte in unmittelbarer Nähe keine Verwandten, an die ich mich wenden konnte. Meine engsten angenommenen Verwandten waren ältliche Schwiegereltern, die zwar stets begeistert waren, uns zu sehen, aber nicht mit anpacken konnten. Und da wir uns »neolokal« angesiedelt, unseren Wohnsitz also unabhängig von unserer jeweiligen Großfamilie gewählt hatten, um nach der Heirat einen eigenen, separaten Haushalt zu gründen, wohnten sie ohnehin eine halbe Stunde Fahrzeit von uns entfernt.
Inzwischen hatte mein Mann nach nur einer Woche Auszeit mit dem Säugling und mir schon wieder zu arbeiten begonnen, genau wie mein eigener Vater und wie so viele andere Väter der westlichen Welt, zumal in Manhattan mit seinen außerordentlich hohen Lebenshaltungskosten und seinem gewaltigen Druck auf Gehaltsempfänger mit Nachwuchs. Eine Zeitlang unterstützte uns eine Säuglingsschwester, ein Muss für jedes Baby in Manhattan, eine dank Mundpropaganda angeheuerte Person, bei der man all die Grundkenntnisse erlernt, die uns früher Mütter und Großmütter beigebracht hatten. Jeden Morgen stand sie gut gelaunt vor der Tür, um mir zur Hand zu gehen und mir in Erinnerung zu rufen, was ich in dem kurzen Säuglingspflegekurs auf der Entbindungsstation des Krankenhauses und vor langer Zeit beim Babysitten gelernt hatte. Abgesehen von ihr und den Freundinnen, die gelegentlich zu Besuch kamen, war ich mit unserem Neugeborenen und meinen mütterlichen Versagensängsten meist allein, und das Tag für Tag.
Außerdem neigte ich zu Einsiedlertum. Hinter dem Haus hatten wir einen winzigen, wunderhübschen Garten; dort saß ich gerne mit dem Baby. Ansonsten war es mir nur selten ein Bedürfnis, das Haus zu verlassen. Die rücksichtslosen Taxifahrer, das Gedränge umherhastender Menschen, Pressluftbohrer und Autohupen ließen mir die Stadt, die ich seit mehr als einem Jahrzehnt so geliebt hatte, plötzlich unwirtlich erscheinen, wenn nicht gar lebensgefährlich für meinen Sohn. Eine gute Freundin, die ihr Kind kurz vor mir zur Welt gebracht hatte, war von ihrem Dasein als Großstadtmutter so ernüchtert, dass sie sich in einen Vorort flüchtete. Und auch im Mutter-und-Kind-Yoga-Studio um die Ecke hatte ich keine Bekanntschaften geschlossen. Obwohl keine von ihnen berufstätig zu sein schien, zerstreuten sich die Jungmütter täglich mit höflichem Nicken gleich nach dem »herabschauenden Hund«, wohl um sich mit ihren individuellen Babys in ihren individuellen Wohnungen einzuschließen und sich ihren individuellen Angelegenheiten zu widmen.
Wer, fragte ich mich häufig, würde mich lehren, wie man die Großstadtmami eines Großstadtbabys wird?
Meine Kindheit im Mittleren Westen der USA war gemächlich und vergleichsweise traditionell verlaufen. Jeden Morgen ging ich gemeinsam mit einer Horde Nachbarkinder aller Altersgruppen zu Fuß zur Schule, und nachmittags spielten wir Fangen, trödelten bis in den frühen Abend hinein in unseren Gärten oder streunten ohne alle Aufsicht in den umliegenden Wäldern herum. An den Wochenenden kurvten wir alle auf unseren Fahrrädern umher oder waren mit den Pfadfindern unterwegs. Als ich älter wurde, arbeitete ich abends oder an den Wochenenden hin und wieder als Babysitterin, ein erstes Beschäftigungsverhältnis, das sich einer zupackenden großen Schwester geradezu aufdrängte und das unter den Präpubertierenden unserer Nachbarschaft einen beliebten Zeitvertreib darstellte.
Vielleicht das einzig Bemerkenswerte an meiner Herkunft, dasjenige, was mir jetzt Halt geben konnte, war die Faszination meiner Mutter für Anthropologie und für das damals noch in den Kinderschuhen steckende Forschungsgebiet der Soziobiologie. Eines ihrer Lieblingsbücher war Margaret Meads Kindheit und Jugend in Samoa. Meads Gedanke, dass die im Westen vorherrschende Form von Kindheit und Jugend nicht die einzige oder die einzig richtige sei und dass die Samoaner im Vergleich möglicherweise besser abschnitten, brachte bei Erscheinen des Buches im Jahre 1928 und dann noch einmal bei seiner Neuauflage 1972 das ganze Land in Aufruhr. Mead, so erklärte mir meine Mutter, war Anthropologin. Sie erforschte Menschen verschiedener Kulturen, die sie kennenlernte, indem sie mitten unter ihnen lebte und Seite an Seite mit ihnen tat, was sie taten. Dann schrieb sie darüber. Anthropologin zu sein schien mir ein unfassbar exotischer, glamouröser und verlockender Beruf, da ich als Heranwachsende von Müttern umgeben war, meistenteils Hausfrauen, während die Väter vor allem als Ärzte oder Anwälte arbeiteten.
Dies war auch die Ära Jane Goodalls, einer betörenden Blondine mit Pferdeschwanz, Khakihosen und Tropenhelm, die das öffentliche Gesicht der Primatologie wurde. Goodall, die im Gombe-Nationalpark in Tansania eine Schimpansensippe beobachtete und beschützte und sie mit Hilfe des National Geographic in aller Welt bekannt machte, war für mich der Rockstar schlechthin. Beim häuslichen Abendessen unterhielten wir uns darüber, was mein Vater und meine Mutter den Tag über getrieben oder was meine Brüder und ich in der Schule gelernt hatten – und über Mary Leakey, eine zigarrenrauchende dreifache Mutter, deren Fossilienfunde in der Olduvai-Schlucht und bei Laetoli in Tansania die hergebrachten Ansichten zur menschlichen Vorgeschichte über den Haufen geworfen hatten.
Gerieten sich meine kleinen Brüder bei Tisch in die Haare, berief sich meine Mutter auf Robert Trivers’ Theorien über Elternaufwand und Geschwisterrivalität. Waren sie brav, dozierte sie über Sippenselektion und Altruismus. Als ich etwa zehn Jahre alt war, sinnierte sie beim Wäschezusammenlegen – offensichtlich mit E. O. Wilson im Hinterkopf –, ob es nicht...