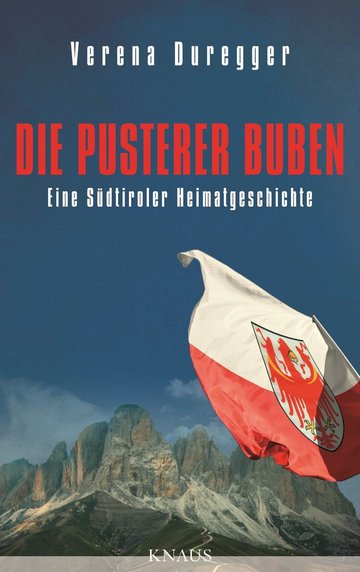Der 11. Juni 1961 war ein Tag wie aus dem Bilderbuch. Die Morgensonne tauchte die Berge rund um Mühlen in zartes Licht. In ein paar Stunden schon würde sie die taunassen Wiesen im Talboden getrocknet haben. Josef Forer stieg die hölzerne Treppe zum Erdgeschoss hinunter. In der Küche dampfte bereits ein Kessel mit Wasser auf dem Herd vor sich hin. Josef musste sich beeilen. Die Kühe waren eingestellt wie ein präzises Uhrwerk, sie kannten weder Sonn- noch Feiertage. Ließ man sie nur eine halbe Stunde warten, wurden sie unruhig. Josef öffnete die Tür, die von der Küche hinüber zum Futterhaus und zum Stall führte.
»Grieß di, Vouto.«
Karl Forer blickte nur kurz auf und brummte seinem Sohn ein knappes »Fong on zi melkn« entgegen. Josef griff sich den Melkschemel, holte den Blecheimer und ging zu der Reihe mit den Kühen. Zehn Milchkühe, drei Schweine und ein Ross teilten sich den Stall, an dessen Außenmauer ein alter Marillenbaum nach oben rankte. Josef befeuchtete die Zitzen mit einem warmen Tuch, umfasste sie mit seinen Händen und richtete den Milchstrahl in den Eimer. Jeder Handgriff saß. Schon als Kind war er bei Tagesanbruch im Stall gewesen, um die Kühe zu melken, sie zu füttern und auszumisten. Und am Abend noch einmal.
Jeden Tag kamen ein paar Leute aus dem Dorf mit kleinen Kannen vorbei, um sich etwas Milch abzuholen. Den Rest verwendeten die Forers für sich. Mit einem Teil wurden die Kälber gemästet, der andere wurde zu Graukäse und Butter verarbeitet.
Während die Männer im Stall waren, bereitete Maria »in Förmass« vor. Für gewöhnlich gab es zum Frühstück eine Brennsuppe, mit einem geschlagenen Ei und einem Löffel Schmalz angereichert, oder ein Mus.
Bevor Josef in seine Tracht schlüpfte, wusch er sich mit warmem Wasser und etwas Seife den Stallgeruch vom Körper. Das Gewand holte er nur zu ganz besonderen Anlässen aus dem Schrank. Ein Schneidermeister aus dem Ort hatte es angefertigt, für alle Mitglieder der Mühlener Musikkapelle. Josef spielte die Trompete, sein jüngerer Bruder Robert die kleine Trommel. In ein paar Stunden würde das ganze Dorf auf den Beinen sein. Es war Herz-Jesu-Sonntag, einer der höchsten Feiertage in Südtirol. Mit Bergfeuern und langen Prozessionen gedachten die Menschen in Mühlen und in ganz Südtirol jedes Jahr am zweiten Sonntag nach Fronleichnam des Widerstands. Bedroht durch die Truppen Napoleons I. waren die Tiroler Landstände 1793 in Bozen zusammengekommen und hatten feierlich gelobt, das Land dem »Heiligsten Herzen Jesu« anzuvertrauen, sollten die Franzosen mit Gottes Hilfe geschlagen werden. Als 1805 ganz Tirol an das Königreich Bayern gefallen war, hatten die neuen Herrscher empfindlich in das religiöse Brauchtum der Region eingegriffen. Das Rosenkranzgebet war verboten worden, die Weihnachtsmette, das Glockenläuten für Verstorbene und das Herz-Jesu-Fest. Die Angst vor weiteren einschneidenden Veränderungen hatte dazu beigetragen, dass sich die Tiroler 1809 erhoben. Vor der Bergisel-Schlacht gegen Franzosen und Bayern hatte Andreas Hofer das Gelöbnis von 1793 erneuert. Als seine Truppen überraschend siegten, erklärte er den Herz-Jesu-Sonntag zu einem Tag, den es in besonders festlicher Weise zu feiern galt. Und daran hat sich seitdem nichts geändert.
Nach dem Hochamt sammelten sich die Einwohner von Mühlen und Sand in Taufers sowie von Kematen vor der Hauptkirche an der Pfarre1, um sich in den Herz-Jesu-Prozessionszug einzureihen. Die unverheirateten Buben und Männer marschierten mit einer großen roten Fahne an der Spitze. Dann folgten die verheirateten Männer mit der grünen Fahne, die Musikkapelle und der Pfarrer. Der Geistliche, der über dem weißen Rauchmantel mit den goldenen Verzierungen das reich geschmückte Segensvelum anhatte, schritt unter einem Baldachin einher, die Monstranz in Händen haltend. Schon Wochen vorher war dieses Allerheiligste auf Hochglanz poliert worden, ebenso wie die Bildnisse der Schutzengel, des heiligen Josef und der Muttergottes mit dem Jesuskind, die von Männern aus dem Dorf getragen wurden. Erst dahinter durften sich die Mädchen mit der weißen Gitschnfahne2 und die Frauen mit der blauen Fahne einreihen.
Jedes Dorf hatte seinen eigenen Prozessionsweg, seine eigenen Statuen und Heiligen, die mitgeführt wurden. Es wurden vier Stationen abgeschritten, an denen jeweils der Anfang eines der vier Evangelien vorgetragen wurde. Dazwischen spielte die Kapelle.
Der Zug führte von der Pfarre zunächst nach Sand in Taufers zum alten Hotel Post. Martha, die Besitzerin, schmückte die Balkone an diesem Tag immer mit gestickten Bildnissen von Herz-Jesu und weiß-roten Tüchern. Vor dem Haus wurde ein Tischchen aufgestellt, ein provisorischer Altar, auf dem der Pfarrer die Monstranz abstellen konnte, um das Evangelium zu verlesen. Vom Hotel Post zog die Prozession über den Feldweg in den breiten Tauferer Boden hinein, vorbei an prachtvollen Kastanienbäumen zum »Hohen Kreuz«, einem großen Wegkreuz an der Straße nach Kematen. Jedes Mal, wenn der Pfarrer seinen Segen erteilt hatte, ertönte vom Melcheranger herüber das Krachen der Böller. War die Prozession dann wieder bei der Pfarrkirche, der letzten Station, angelangt, blieb Zeit für einen ausgiebigen Ratsch. Nach all dem »Gegrüßet seist du Maria« konnte das nicht schaden. Die Alten beklagten die Zeitenwende, tuschelten über die Mädchen, die sich statt mit Kopftuch und Pusterer Dirndl in einem »neumodischen Gwand« und Bubikopf in die Prozession eingereiht hatten. Und die Jungen belächelten manchen Bauern, der sich mit Gamsbart oder Auerhahnfedern am Hut herausgeputzt hatte. Nach der Prozession machten sich die Leute nach und nach auf den Heimweg in die verschiedenen Dörfer. Viele Mühlener kehrten noch in der Unterkohlgrube3 ein. Ein Viertel Rotwein und noch eines, eine Runde Karten spielen und den Herrgott einen guten Mann sein lassen.
Die Unterkohlgrube war eines jener Wirtshäuser, wie man sie heute kaum noch findet. Gleich neben der Kirche gelegen, mit einer holzgetäfelten Stube und schweren Holztischen, deren unzählige Kerben und speckig-glänzende Tischplatten von den vielen Händen erzählten, die im Laufe der Jahrzehnte darübergestrichen hatten. Ein Ort, an dem Zeit relativ ist, an dem die immer selben Leute zusammenkamen, jeder in seinem ganz eigenen Rhythmus. Manche schauten nur am Sonntag vorbei, gleich nach der Messe auf ein Bier oder einen Schnaps, und blieben dann auf demselben Platz sitzen, bis es draußen dämmerte oder die Frau eines der Kinder schickte, um den Vater heimzuholen. Andere kamen mehrmals die Woche, nachdem das Tagwerk verrichtet, die Arbeit im Stall beendet war. Wenn die Wirtsstube voll war, konnte man vom Budel4 aus nicht mehr sehen, wer da beisammenhockte. Dichter Rauch hing über den Tischen, und vor allem im Winter, wenn der Kachelofen eingeheizt war und die Fenster geschlossen blieben, grub sich der Geruch aus Alkohol, Rauch und Essen tief in die Kleider. Und geraucht haben damals viele Gäste der Unterkohlgrube. Wer es sich leisten konnte, griff zu Zigaretten der Marke »Alfa«, sie galten als die besten, oder steckte sich eine »Toscanelli«-Zigarre an. Frieda Steger, die Wirtin, murrte zwar manchmal über den Gestank, aber sie wusste auch, dass die Unterkohlgrube für viele Mühlener eben so etwas wie eine zweite gute Stube war.
Frieda war die Seele des Gasthauses, ohne sie lief nichts. Während aus dem Radio Volksmusik dudelte, eilte sie unermüdlich zwischen der Wirtsstube und der Küche hin und her, wo sie mit Topfen und Schnittlauch gefüllte Krapfen im heißen Fett herausbuk. Jedem, der vorbeischaute, drückte sie einen davon in die Hand. »Solscht amo eppas guits hobm.« Das mochte vielleicht nicht gut für den Geldbeutel sein, aber die Leute waren umso lieber hier.
Die Einheimischen hatten in der Unterkohlgrube ihren festen Platz, man saß immer am selben Tisch. Wenn aber ein reicherer Bauer zur Tür hereinkam, musste ein anderer aufstehen und ihm Platz machen. Reich war nicht nur, wer viel Vieh im Stall hatte, sondern vor allem, wer viel Wald besaß. Und wenn sich jemand zu einer Runde dazugesellte, war es Brauch, ihm aus Höflichkeit einen Schluck aus dem eigenen Glas anzubieten. Die meisten tranken Rotwein, eine Kalterer Auslese vom Fass oder Bier. An guten Tagen mussten Friedas Töchter oft in den Keller hinunter, um den Fünfliterkrug aufzufüllen, aus dem die Mutter dann Achtel und Viertel ausschenkte. Wenn die Mühlwalder, die in Deutschland oder der Schweiz eine Arbeit gefunden hatten, alle heilige Zeiten zu den großen Festtagen in die Unterkohlgrube kamen, bestellten sie sogar einen Liter. Neben dem Wein und Gösser- oder Puntigamer-Bier gab es Mineralwasser in Siphonflaschen und Orangenlimonade, die alle nur als »Kracherle« bezeichneten, wegen des Zischgeräuschs beim Öffnen der Flaschen. Die Kracherle kauften die Stegers in Sand in Taufers bei Fritz Leimegger, der wegen seiner Limonadenproduktion von allen nur der »Kracherle-Macher-Fritz« genannt wurde. Wenn die Vorräte zur Neige gingen, spannte Siegfried, der Älteste der Steger-Buben, das Ross vor den Karren und fuhr hinauf, um ein paar Kisten Limonade zu holen und die leeren Flaschen zurückzubringen. Schnaps gab es in der Unterkohlgrube natürlich auch: einen klaren Treber, Eiercognac und »Millefiori«, einen italienischen Likör. Nur Kaffee wurde nicht oft bestellt, obwohl die Stegers früh eine richtige Espressomaschine angeschafft hatten. Und sie hatten sogar einen Eiskasten. Eine Zeit lang waren die Leute aus dem Dorf nur vorbeigekommen, um sich dieses neumodische Gerät einmal aus der Nähe anzuschauen.
Wenn nach der...