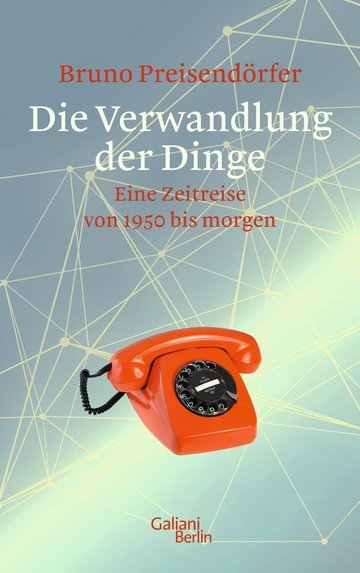Einleitung
Heutzutage unterscheidet sich der Mensch hauptsächlich dadurch vom Affen, dass er mit dem Daumen auf dem Zahlenfeld eines Handys Nummern eingeben oder gleichzeitig mit zwei Daumen auf dem Buchstabenfeld eines Smartphone-Displays Botschaften tippen kann. Sogar im Gehen!
Aber das Entscheidende ist nicht der aufrechte Gang, sondern die Fähigkeit, den Daumen anstrengungslos nach innen zu beugen, und zwar so weit, dass die Daumenkuppen ohne Weiteres die Kuppen der anderen Finger berühren können. Anthropologen bezeichnen diese evolutionäre Errungenschaft der menschlichen Anatomie als ›Opponierbarkeit‹ des Daumens. Sie kommt bei keiner anderen Primatenart vor. Schimpansen, bei denen die Daumen ebenfalls von den übrigen Fingern abgesetzt, aber eben nicht opponierbar sind, können mit den Zeigefingern auf einem Tastentelefon herumdrücken oder sie in die Löcher einer Wählscheibe stecken. Sie sind jedoch nicht in der Lage, doppeldäumig Botschaften ins Smartphone zu tippen.
Unsere unmittelbaren Vorfahren auch nicht. Womit nicht gesagt sein soll, ältere Leute, die nicht beidhändig simsen, stünden den Schimpansen näher als jüngere Leute, obwohl jüngere Leute mitunter den Eindruck erwecken, als käme es ihnen genau so vor. Der Verfasser, der sich vor einem Vierteljahrhundert gegen die Installierung von Windows 95[4] auf seinem Redaktionscomputer sträubte und darauf bestand, vorläufig mit dem DOS-basierten Word 5.0 weiterzuarbeiten, wurde damals vom Verlagstechniker als ›Neandertaler‹ bezeichnet. Heute wirkt Windows 95 mit seiner von Brian Eno komponierten Startmelodie[5] selbst ›prähistorisch‹. Bei einem 2016 durchgeführten Experiment sahen sich etliche nach 1995 geborene ›User‹ außerstande, Windows 95 überhaupt in Gang zu bringen. Sie schalteten den Bildschirm an und warteten und warteten und warteten. Bildschirme waren in den 90ern keine Flatscreens, sondern weit nach hinten ausladende Monitore. Und der Rechnerblock stand unterm Tisch. Dass dieser Apparat ebenfalls anzuschalten war, nicht nur der monströse Monitor, kam einigen der mit Smartphones aufgewachsenen Teens erst gar nicht in den Sinn.
In der Praxis wirft das schnelle Altern jüngster Errungenschaften Probleme der Anpassung auf, in der Philosophie tiefgründige Fragen. Was sollen etwa Großeltern, in deren eigener Kindheit die Telefone Apparate waren, die im Flur an der Wand hingen, auf die Enkelfrage antworten »Wie seid ihr eigentlich ins Internet gekommen, als es noch keine Computer gab?« Ein Philosoph würde diese Frage, die ich von einem Elfjährigen gehört habe, auf die ›Naturalisierung‹ kultureller Erscheinungen zurückführen, auf die Verwandlung von historisch Entstandenem in etwas Natürliches, seinsmäßig Vorgegebenes. Dem Elfjährigen wiederum, dessen eigene Geschichte kürzer ist als die des Internets, geht das Internet tatsächlich voraus, jedenfalls insofern, als für seinen Alltag die ›Historizität‹ der Praktiken, mit denen er ihn bewältigt, nicht von Belang ist. Im Übrigen könnte man die meisten Dinge nicht benutzen, wollte man sich vorher darüber klar werden, wie sie entstanden sind und wie sie funktionieren. Man müsste Experte für alles sein. Wer kann das schon? Wer will das überhaupt? Wir wissen, dass die Dinge funktionieren (jedenfalls wenn und solange sie funktionieren), auch wenn wir nicht wissen, warum. Insofern haben wir ein magisches Verhältnis zu ihnen. Im Unterschied zum magischen Menschen der Vorzeit allerdings wären wir in der Lage, von der Praxis zur Theorie überzugehen, um uns die Dinge einschließlich ihrer kausalen Zusammenhänge wissenschaftlich erklären zu lassen.
Die Dinge und die Kulturtechniken ihrer Benutzung entwickeln sich mit hoher und immer höherer Geschwindigkeit. Das begeistert die Euphoriker und betrübt die Nostalgiker. Die Euphoriker sind hysterisch versessen aufs Neue, immer auf dem ›aktuellen Stand‹ und bereit für den nächsten Trend. Die Nostalgiker sentimentalisieren das Alte und ignorieren die neuesten Errungenschaften von zurückliegender Warte.
Der Autor dieser Erinnerungen an die Gegenstandswelt von gestern zählt sich weder zu den einen noch zu den anderen. Dass früher alles besser war, hält er für ein Märchen, dass früher, als vieles schlechter war, von alten Leuten erzählt wurde. Dass morgen alles noch besser sein wird, hält er für eine Übertreibung junger Leute, die das Leben mit einem Start-up verwechseln. Und so werde ich es keinem recht machen, aber hoffentlich viele amüsieren mit dieser Reise zu Dingen der eigenen Vergangenheit seit den späten 1950ern. Auf einer solchen Reise trifft man ›Objekte‹ wieder, die man völlig vergessen hat, obwohl sie einst ungeheuer wichtig waren. Oder man lacht sich kaputt über Gewohnheiten, die noch vor wenigen Jahren mit unerschütterlichem Alltagsernst gepflegt wurden.
Die einzelnen Dinge sterben, wenn wir aufhören, mit ihnen zu leben. Die ›Population‹ der Dinge indessen wächst im Lauf unseres Lebens. Nicht nur deshalb, weil sich in Wohnungen und Häusern, auf Dachböden und in Kellerräumen mehr und mehr Gegenstände ansammeln, die man ›irgendwann vielleicht noch einmal brauchen kann‹. Sondern auch, weil die Zahl der tatsächlich in Gebrauch befindlichen, wenn auch nicht immer wirklich gebrauchten Dinge zunimmt. »Ein Deutscher nennt im Durchschnitt zehntausend Gegenstände sein Eigen.« Angaben wie diese aus der opulenten »Geschichte des Konsums« von Frank Trentmann sind statistisch konstruiert und nicht beim Wort, genauer: bei der Zahl zu nehmen. Doch immerhin veranschaulichen sie die Dimension der Anhäufung von Gebrauchsgegenständen. Wollte man alles, was eine normale deutsche Familie besitzt, in einer Ausstellung präsentieren, in Vitrinen, auf Sockeln und ordentlich beschriftet, könnte man damit ein eigenes historisches Museum einrichten. Schon wenn ich die Augen vom Computerschirm löse und einen Blick über meinen eigentlich nicht überhäuft wirkenden Schreibtisch werfe, irritiert die Vielfalt des Ensembles an Dingen: ein halbes Dutzend Nachschlagewerke, zwei Buchstützen, sage und schreibe zehn verschiedene Notizhefte, zwei Stapel mit Papierausdrucken, ein Taschenkalender, ein aufrecht stehendes Buch aus Granit, an dem blaue, grüne, rote und gelbe Merkzettelchen kleben, auf dem oberen Schnitt des Steinbuchs ein USB-Stick; neben dem Steinbuch ein kleiner Amboss aus Edelstahl, den mein Vater, ein gelernter Schmied, an seinem Arbeitsplatz in der Fabrik gefräst und mir geschenkt hat, als ich noch bei den Eltern wohnte; außerdem ein Ganesha aus Bronze, der mir irgendwann zugelaufen oder eher zugekrabbelt ist, denn das Figürchen stellt den Hindugott mit dem Elefantenkopf auf allen vieren dar; des Weiteren eine Schreibtischlampe, ein schnurloser Handapparat fürs Festnetztelefon, die Ladeschale für diesen Handapparat, ein Handy, ein Taschenkalender, ein Kugelschreiber, ein Drehbleistift, ein Holzbleistift, ein Bleistiftspitzer, ein Kopfhörer und schließlich meine Brille, die eigentlich beim Schreiben auf der Nase sitzen sollte.
Die zehn parallel geführten Notizhefte übrigens machen mich fassungslos. Das hätte ich – ohne Nachzählen – nicht für möglich gehalten. Offenbar rücken viele Gegenstände um uns herum erst dann in unseren Wahrnehmungshorizont, wenn wir bewusst nach ihnen sehen oder absichtlich nach ihnen greifen. Ein beliebiger Selbstversuch dürfte das bestätigen. Man stelle sich beispielsweise eine Ecke der jeden Tag benutzten Küche vor und notiere alles, was sich dort befindet. Dann gleiche man die Liste mit der Wirklichkeit ab!
Es ist wunderlich, wie viele der Sachen einem nicht einfallen, die man täglich um sich hat. Nur Lissy würde ich nicht vergessen, da bin ich mir sicher. Das kleine Kofferradio, Jahrgang 1970, steht in der Küche und erzählt mir jeden Morgen, was vorgefallen ist in der Welt. Anderswo hat sie bereits Vitrinenreife. In Technikmuseen repräsentiert sie stumm ihre Epoche des Gerätedesigns. Sobald wir den persönlichen Umgang mit unseren Dingen einstellen, werden sie ›historisch‹.
Ohne Körperkontakt mit den Menschen können Alltagsgegenstände nicht funktionieren – und das ist wörtlich zu nehmen, fast: Viele Funktionen werden heute nicht mehr am Apparat ausgelöst, sondern an kleinen Schächtelchen, die wir ›Fernbedienung‹ nennen. Auf Knöpfe allerdings drücken wir immer noch. Einstweilen. Es wird freilich nicht mehr lange dauern, bis wir unsere Befehle nicht mehr mit den Fingern erteilen, sondern mit dem Mund. Stimmerkennungsprogramme ermöglichen es, dass wir den Dingen Anweisungen geben können, als wären sie unseresgleichen. So brachte in der zweiten Jahreshälfte 2016 Amazon seinen in den USA bereits erprobten Spracherkennungslautsprecher Echo auf den deutschen Markt. Der Name ist insofern geschickt gewählt, als der griechischen Mythologie zufolge die Bergnymphe Echo von der Zeus-Gemahlin Hera der eigenen Stimme beraubt und dazu verurteilt wurde, nur die jeweils letzten an sie gerichteten Worte zu wiederholen. Dies war die Strafe dafür, dass Echo die eifersüchtige Hera mit Geschichtenerzählen von den Fremdgängen des Göttergatten abgelenkt hatte. Nun kann man die vernetzte Nymphe bitten, das Licht auszuschalten oder ein Taxi zu rufen.
Aber noch sind die meisten Befehle, die wir unseren Dingen geben, haptischer Natur. Weil unsere alten Reflexe weiterfunktionieren, wenn ein Gerät plötzlich nicht mehr funktioniert, sind wir im allerersten Moment schockiert, wenn auf Knopfdruck nichts passiert. Dabei sollten wir eigentlich wissen, dass nur die Batterien zu erneuern...