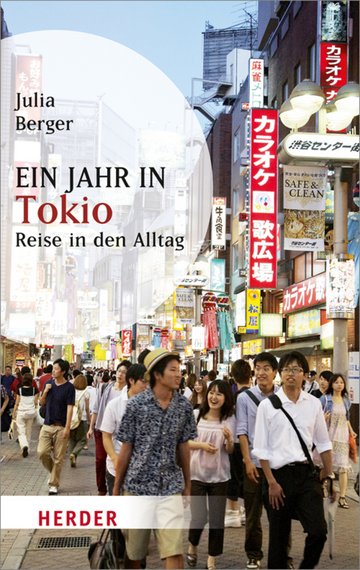Januar
4. Januar 2010
Wieder ein roter. Und nicht meiner. Die Koffer gleiten an mir vorbei, und rings um mich greifen Hände nach ihnen, ziehen sie vom Band, machen sich mit ihnen davon. Ich stehe da und schaue ihnen nach, wie verpassten Chancen.
Knapp fünfundzwanzig Kilo habe ich aus meinem alten Leben mit hierher genommen. Die Auswahl der Dinge, die mich um den halben Erdball begleiten sollten, ist einfacher gewesen, als ich mir das zunächst gedacht hatte. Denn selbst als ich mich nur auf das Nötigste beschränkte, war der Koffer im Nu bis an den Rand gefüllt gewesen. Alles andere musste zurück in mein altes Kinderzimmer – und steht nun zwischen den Ikea-Möbeln meiner Studentenzeit, Klamottenkisten, ausrangierten Tennisschlägern und leicht vergilbten Stofftieren.
Richtig verwundert hatte es meine Eltern nicht, als ich ihnen mitgeteilt hatte, dass ich für ein Jahr nach Japan gehen wollte. Immer wieder hatte ich ihnen von dem Land vorgeschwärmt, versucht, es ihnen ebenfalls nahezubringen. Doch ihre Gesichter, als ich ihnen zu Weihnachten statt der traditionellen Bratwürste selbst gemachtes Sushi servierte, hatten mich schließlich davon überzeugt, dass man Träume nicht teilen konnte. Besonders nicht, wenn sie in Algenpapier gewickelt sind.
„Und deine Wohnung in München?“, hatte meine Mutter gefragt.
„Ist ja eh nur ein WG-Zimmer. Da wollte ich ohnehin schon lange raus.“
„Und du findest da Arbeit?“
Das Architekturbüro, in dem ich arbeitete, hatte mir vor Kurzem gekündigt. Es war das erste Mal gewesen, dass ich länger als ein paar Monate in einem Büro angestellt gewesen war, zuvor hatte ich mich durch verschiedene Praktika gehangelt. Doch obwohl die Chefs und Kollegen dieses Mal nett gewesen waren, hatte mich die Kündigung nicht wirklich schockiert. Das „Pläneschrubben“, also das Zeichnen am Computer, machte mir einfach keinen Spaß. Bäumler, einer der Chefs im Büro „B2 Architekten“ und derjenige, mit dem ich bei meiner Arbeit am meisten zu tun hatte, schien nicht bemerkt zu haben, dass ich nicht besonders an dem Job hing. „Die Aufträge, Julia, die Aufträge fehlen einfach. Tut mir leid. Aber wenn du willst, kann ich mich bei den Kollegen mal umhören, ob sie jemanden brauchen.“ Ich wollte nicht. Das war doch ein Wink des Schicksals. Wie oft hatte ich in den letzten Monaten das Gefühl gehabt, mein Leben an ein Ziel verschenkt zu haben, das nicht das meine war. Jetzt war ich gezwungen, etwas zu ändern, und würde es auch tun.
„Mama, da findet sich schon was. Hat doch bis jetzt auch immer geklappt.“
Sie sagte nichts mehr, doch aus ihrem Blick las ich deutlich, was ihr auf der Zunge lag: „Kind, du bist schon 28. Meinst du nicht, du solltest dir langsam die Flausen aus dem Kopf schlagen?“
Dort hinten, das muss er sein! Ich fixiere den roten Koffer, der nun polternd auf das Band fällt. Gleich werde ich aus dem stickigen Saal verschwinden können. Die Einreiseprozedur hatte ich ja schon hinter mir, samt Fingerabdruck-Scan und Identifizierungsfoto. Das Multifunktionsgerät, das den Neuankömmlingen die persönlichen Merkmale entlockt und für die Ewigkeit speichert, hatte mich ein wenig an ein Hündchen erinnert. Daran waren vor allem die Scanner-Arme schuld, die sich dem Reisenden wie zwei Pfoten entgegenstreckten. Statt eines Gesichts wendet einem der Roboter einen Bildschirm zu, und ein bunter Schriftzug heißt den „Gaikokujin“, also Ausländer, in Japan willkommen. Hat sich der Einreisende dazu bequemt, seine Finger auf die Pfoten zu legen, knipst einen das Gerät mit seiner in die Stirn integrierten Kamera. Schöne neue Welt? Nun ja, ich hatte es jedenfalls hinter mir, ebenso den Temperaturscanner, der nichts an meinen Graden auszusetzen gehabt hatte, auch wenn es mir seit meiner Ankunft gleichzeitig heiß und kalt ist. Denn wenn ich nun endlich mein Gepäck habe, muss ich nur noch durch den Zoll – dann bin ich draußen, in diesem Land, nach dem ich mich so sehr gesehnt habe. Und werde Satoshi treffen. Wenn er gekommen ist, wie er es mir in seiner Mail versprochen hatte. Ich schnappe nach dem roten Koffer und wuchte ihn mit Schwung vom Band. Fast treffe ich dabei den Fuß des japanischen Familienvaters neben mir. Sein erschrockenes „Ah!“ macht mir meinen Fauxpas bewusst. Ich schenke ihm ein entschuldigendes Lächeln. Doch ihm ist seine Reaktion wohl peinlich. Oder aber er will verhindern, dass sie mir peinlich ist – jedenfalls sieht er mich gar nicht an.
Wie wird es sein, Satoshi wiederzusehen? Fast drei Jahre haben wir uns nicht getroffen, und auch schon lange nicht mehr telefoniert. Bei der verzögerten Verbindung über das Internet, den Sprachschwierigkeiten und der Tatsache, dass es wenige Gemeinsamkeiten in unserem Alltag gab, war es immer eine Tortur gewesen. Wer will schon immer über das Vergangene reden? Und dabei Gefühle ausgraben, von denen man nicht weiß, wie man sie einordnen soll?
Wir hatten uns in München kennengelernt. Er studierte dort als Austauschstudent Architektur, im selben Semester wie ich. Wir verstanden uns gut, er brachte mir etwas Japanisch bei, und wir unternahmen öfter etwas zusammen mit ein paar anderen Freunden. Und irgendwann auch ohne sie. Auf dem Weg zum Zoll werden die Erinnerungen immer lebendiger. Sein Akzent, und die Silben, die er an die deutschen Wörter anhängte, sodass sie japanisch klangen: „ich-o auch-o.“ Seine Verwunderung, dass Dallmayr ein Firmenname war, und nicht „Daruma-ya“, Laden für die typischen japanischen Daruma-Figuren, bedeutete. Der Tag, als er mir mit einem Anti-Mitesser-Pflaster auf der Nase die Tür seiner Studentenwohnung öffnete und ich mich beherrschen musste, nicht lauthals loszulachen, da ich noch nie einen Mann getroffen hatte, der sich Anti-Mitesser-Pflaster auf der Nase klebte.
Unter dem Porträt Ludwigs II. küssten wir uns das erste Mal. Den Platz hatten wir uns nicht bewusst ausgesucht. Aber das üppig Bayerische, das das Fraunhofer – eine Gaststätte im Münchner Glockenbachviertel – ausstrahlte, hatte uns einander vielleicht doch näher gebracht. Die Schatten der Hirschgeweihe auf der Wand, die verspielten Ranken der Stuckdecke, die hölzerne Wandverkleidung, die den Raum in eine irdische und eine himmlische Sphäre zu teilen schien. Das alte Parkett mit seinen schwarzen, abgetretenen Stellen, die wirkten, als ob sich die Beine der Holzstühle dort tief eingegraben hätten. Die beiden halb vollen Weißbiergläser vor uns, an denen wir uns bisher festgehalten hatten.
Ob Satoshi sich hier fremder fühlte als anderswo? Oder ob er darin eine zweite, andere Heimat erkannte? Seine Hand lag auf meinem Oberschenkel. Mein Gesicht an seiner Schulter. Dann seine Finger auf meiner Wange. Meine Lippen auf seinem Mund. Und König Ludwig sah über uns hinweg, in die unbestimmte Ferne.
Wenig später war sein Austauschsemester zu Ende und er ging zurück nach Tokio. Ein halbes Jahr später besuchte ich ihn dort – inzwischen mit jeder Menge Halbwissen über dieses Land und grundlegenden Japanischkenntnissen, die sich mein vom plötzlichen Abschied noch stärker entflammtes Herz gierig angeeignet hatte. Die drei Wochen gingen viel zu schnell zu Ende. Es war August, ich wohnte in Satoshis winziger Studentenbude ohne Klimaanlage und zerfloss in der Hitze des japanischen Sommers. Statt trauter Zweisamkeit zog ich oft mit dem Reiseführer alleine los – für Satoshi war es selbstverständlich, trotz Semesterferien jeden zweiten Tag an seinem Lehrstuhl an der Uni anwesend zu sein. Dass ich mich darüber – von Exfreunden anderes gewöhnt – aufregte, war klar. Dass er das – von Exfreundinnen anderes gewöhnt – nicht verstand, ebenfalls.
„Wir haben uns ein halbes Jahr nicht gesehen, und du hast kaum Zeit für mich!“
„Kaum Zeit für dich? Ich tue doch schon mein Bestes! Gestern waren wir in Kamakura, und morgen Abend sehen wir uns das Feuerwerk in Yokohama an. Ist das nichts?“
„Wieso kannst du nicht einfach mal daheim bleiben, nicht zur Uni gehen?“
„Was?“
Wenn wir zusammen unterwegs waren, musste ich ihm meist völlig das Ruder überlassen: etwa, wenn wir zusammen etwas essen gingen. In den kleinen, typischen Lokalen gab es nur japanische Speisekarten, und ich vertraute darauf, dass er etwas Genießbares bestellen würde. Es schien mir wie ein Wunder, dass jemand diese Zeichen lesen konnte, und dass mit dieser Sprache, die hauptsächlich aus „hai“ und „masu“ zu bestehen schien, Verständigung möglich war.
Nicht nur wegen Satoshi fiel mir die Rückkehr nach Deutschland damals schwer. Ich hatte gerade erst damit begonnen, das fremde Land kennenzulernen. Hatte mich daran gewöhnt, die Schuhe auszuziehen, wenn ich die Wohnung betrat, die Stäbchen so zu halten, dass damit Nahrungsaufnahme möglich war. Musste nicht mehr Ewigkeiten in einem der kleinen Supermärkte verbringen, um etwas zu essen zu finden, bei dem ich mir sicher war, dass kein „natt?“ – ein glibbriger, fermentierter Bohnenbrei – oder andere Arten von Bohnen verarbeitet waren. Hatte gelernt, dass volle U-Bahnen nicht bedeuteten, dass nicht noch zehn Leute zusteigen konnten. Und verneigte mich bereits automatisch etwas, wenn ich Leute begrüßte. Noch am Flughafen beschloss ich, irgendwann wiederzukommen, und als ob es dafür ein Pfand bräuchte, versprach ich mir selbst, in Deutschland weiter Japanisch zu lernen. Dieser Blick, den Satoshi mir zuwarf, bevor ich mich umdrehte! In ihm schien alles zu liegen, was ich jemals vermissen konnte.
Ich halte den Atem an, als ich endlich aus dem Zoll in den Warteraum trete. Ich sehe ihn sofort, wie er dort etwas...