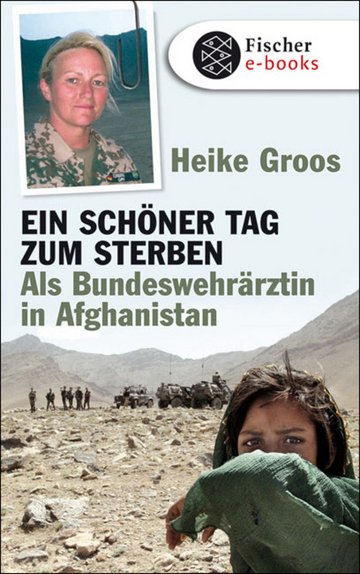Prolog
Die Kinder kamen strahlend von der Bushaltestelle zurück. »Mama, die Schule fällt aus!«
»Warum?«, fragte ich. »Woher wisst ihr das?«
»Der Bus ist nicht gekommen, und die Straße ist gesperrt. Die anderen Kinder sind auch wieder nach Hause gegangen!«
Also wurde erstens nichts aus meinem friedlichen Vormittag, zweitens wollte ich wissen, warum die Straße gesperrt war und wie lange das noch dauern würde, und drittens musste ich herausfinden, ob es einen anderen Weg in die Stadt gab.
Ich zog mich also an und ging auf die Straße. Dort stand ein netter Verkehrspolizist und erklärte jedem, der in die gesperrte Straße einfahren wollte, wie man über einen Umweg von fünfundvierzig Kilometer dennoch in die Stadt kommt. Bei den schmalen kurvigen Straßen hier ist das eine Fahrt von zwei Stunden. Das machte keinen Sinn. Bis wir in der Schule ankämen, wäre die Hälfte des Unterrichts sowieso vorbei.
Neugierig fragte ich nach dem Grund für die Straßensperrung. Der Polizist gab mir freundlich eine lange Erklärung, die ich aufgrund der mir noch fremden und ungewohnten Sprache nur teilweise nachvollziehen konnte. Jedenfalls nahm ich an, ich hätte ihn nicht richtig verstanden, als ich hörte, bewaffnete Streitkräfte hätten die Straße gesperrt und würden einen Zugriff auf ein Haus planen. Wie lange das noch dauern würde, könne er nicht sagen. Ich dachte, meine Phantasie spiele mir einen Streich. Schließlich war ich nicht mehr im Einsatz, und dies war ein friedliches Land. Hier konnte es keine Attentäter geben, und das Militär, so nahm ich an, beschäftigte sich mit Übungen im Busch.
Ich fragte unsere Nachbarin, ob ihre Kinder auch zu Hause bleiben würden, und sie sagte, ja, auch ihr sei der Umweg zu weit. Ich fragte weiter, ob sie wisse, was passiert sei. Sie sagte, sie denke, es sei ein Verkehrsunfall gewesen. Nun erzählte auch mein ältester Sohn, er habe gehört, dass ein Auto in ein Haus gefahren sei. Ich war beruhigt. Ich musste unbedingt die Sprache besser lernen!
Als ich gegen Mittag den Fernseher einschaltete, um die Nachrichten zu sehen, stellte sich heraus, dass ich die Sprache gut genug beherrschte. Ein Großteil der Nachrichten beschäftigte sich mit den dramatischen Ereignissen in unserem kleinen Ort. In einem Haus in der Nachbarschaft habe sich ein bewaffneter Mann verschanzt und mit einem Chemieanschlag gedroht. Das Haus sei von Militär umstellt, die Soldaten hätten bereits Tränengas eingesetzt und zwei Schüsse abgegeben, der Mann habe sich aber noch nicht gestellt. Sobald es Neuigkeiten gäbe, würde sie sich wieder melden, sagte die Reporterin. Ich schaltete den Fernseher aus. Ist es denn zu fassen? Ist es überall auf der Welt das Gleiche? Kann man denn nirgendwo in Ruhe und Frieden leben?
Meine Nachbarin kam zu Besuch. Auch sie war entsetzt. Gewalt und Terror, das war etwas Fremdes in dieser kleinen idyllischen Welt. Sie hatte davon gehört, kannte es aus den Nachrichten, aber nie zuvor hatte es sie persönlich betroffen.
Ich kenne es, nicht nur aus den Nachrichten, und es hat mich persönlich betroffen. Aber das war in einem früheren Leben, und ich dachte, es liege weit hinter mir. Hier habe ich es nicht erwartet. Fast empfinde ich es als persönliche Beleidigung. Ich bin hierhergekommen, um Ruhe und Frieden zu finden. Von früher sind noch so viele Bilder von Elend und Leid in meinem Kopf …
Ich lege meine Tagebuchaufzeichnungen, die ich vor gut einem halben Jahr geschrieben habe, zur Seite. Der Himmel ist ein wenig verhangen, und es ist ein ganz normaler und unscheinbarer Tag. Ich sitze auf meiner Terrasse und sehe aufs Meer hinaus, das heute auch nichts Besonderes zu bieten hat, keine intensive blaue oder grüne, nicht einmal graue Farbe aufweist, nur einfach Wasser ist, das leise auf den Strand plätschert, nicht wild und schäumend wie manchmal, aber auch nicht glatt und spiegelnd und romantisch wie an anderen Tagen. Ich sehe hinaus aufs Meer, rauche eine Zigarette und denke nach, was ich gemeint hatte mit diesen Bildern von Elend und Leid und darüber, warum ich an dieser Stelle nicht weitergeschrieben hatte. Ich denke zurück an die Zeit, die ich »früher« genannt hatte.
Wie stolz ich damals war, als ich das Studium geschafft hatte, mit zwei kleinen Kindern, auch zu jener Zeit in meinem Leben allein, ohne Mann. Ich hatte keine Ahnung, was mich erwarten würde. Vielleicht war das ja auch gut so, vielleicht hätte ich mich sonst vor lauter Angst gar nicht bewegen können. Man wächst mit den Anforderungen, jede Mutter und jeder Vater weiß das und auch jeder Arzt. Ich bin alles in einer Person und lernte Dinge, von denen ich nicht erwartet hatte, dass ich sie je beherrschen würde.
Eigentlich wollte ich Gynäkologin werden, aber ich gehöre zu den geburtenstarken Jahrgängen und fand keine Stelle. Mein Examen war nicht gerade das beste, ich war froh, dass ich überhaupt bestanden hatte. Eine Doktorarbeit hatte ich zwar angefangen, aber dann, statt sie zu beenden, mein zweites Kind bekommen. So nahm ich die erste und einzige Stelle an, die mir angeboten wurde. Es war eine Assistenzarztstelle für Anästhesie, und dass sie in einem Bundeswehrkrankenhaus war, machte für mich keinen Unterschied. Es lag in meiner Heimatstadt, und ich konnte die Kinder vorher zur Kindertagesstätte bringen. Von Auslandseinsätzen war damals noch keine Rede. Die Bundeswehr war dort in den zivilen Rettungsdienst integriert, ich wurde dafür ausgebildet und ging völlig in dieser Arbeit auf. Dass ich dadurch, ganz nebenbei, Soldat geworden war, hatte ich kaum bemerkt. Ich fuhr Notarztwagen für die Bundeswehr, später für das Deutsche Rote Kreuz, die Johanniter-Unfall-Hilfe, die Malteser, den Arbeiter-Samariter-Bund, war Notärztin bei Motocross- und Kickbox-Veranstaltungen, machte Rettungsflüge mit Hubschraubern, Learjets und Rückholtransporte für die Lufthansa.
Mein privates Leben wurde durch zwei weitere Kinder bereichert, doch auch ihr Vater blieb nicht. Ich wollte meine Kinder sehen und an ihrem Alltag teilhaben, also arbeitete ich am Wochenende, wenn sie bei ihrer Oma sein konnten, und nachts, wenn sie schliefen.
Nachts, wenn es dunkel ist und kalt. Wenn die Menschen am deutlichsten merken, dass sie allein sind und von innen heraus frieren. Wenn sie verzweifelt sind, kein Licht in der Dunkelheit sehen im wahrsten Sinne des Wortes. Dann wollen sie nicht mehr leben, legen sich einen Strick um den Hals, springen aus dem vierten Stock, werfen sich vor einen Schnellzug. Nachts, wenn sie müde und abgearbeitet sind, dann streiten sie sich mit ihrem Lebensgefährten oder Geschäftspartner und greifen auch mal zum Messer oder zur Pistole. Nachts entdecken sie, dass sie betrogen werden, betäuben ihre Frustration mit Alkohol und Tabletten. Ungefähr um zwei Uhr morgens haben Menschen auch ihren biologischen Tiefpunkt, wachen auf mit Brustschmerzen und bekommen einen Herzinfarkt. Nachts setzen die Wehen ein, oder die Fruchtblase platzt. Nachts wollen sie nach Hause, auch wenn sie betrunken sind und nicht mehr fahren können, und landen im Straßengraben. Ihnen zu helfen, sie zu retten und am Leben zu erhalten, bis sie im Krankenhaus angekommen waren, das war mein Job als Notärztin, und die Bilder, die ich dabei gesehen hatte, prägten sich tief in mein Gedächtnis ein.
Die vielen schmutzigen, nach Mottenkugeln, kaltem Rauch und billigem Alkohol stinkenden Wohnungen, verwahrloste Alte, vernachlässigte Kinder, misshandelte Frauen, Junkies auf schmutzigen Bahnhofstoiletten. Übelriechende Leichen, die erst nach Tagen gefunden wurden, junge Menschen, alkoholisiert mit Motorrädern oder in kleinen alten Autos aus dünnem Blech verunglückt, querschnittsgelähmt, beinamputiert. Die Verzweifelten, die keine Hoffnung mehr sahen, die mit einem Seil um den Hals von der Zimmerdecke oder dem Ast eines Baumes abgeschnitten werden mussten, mit kalten, starren Gliedmaßen und weißen, verzerrten Gesichtern, die nicht einmal im Tod Frieden gefunden hatten.
All die Schwerkranken, denen ich nicht mehr hatte helfen können, Babys, die morgens tot im Bett lagen, Kinder unter Chemotherapie, die mich mit großen Augen aus ihren haarlosen Köpfen heraus vertrauensvoll anschauten. Wie viele Hinterbliebene habe ich getröstet, an wie vielen Sterbebetten Hände gehalten. So viele Bilder von Schmerz und Trauer, hervorgerufen durch Krankheit, Gewalt und Gleichgültigkeit. Und immer wieder, endgültig und unabwendbar, der Tod. Eine zwanzigjährige Tätigkeit als Notärztin hinterließ mir diese Erinnerungen.
Dann begannen die Auslandseinsätze in Afghanistan. In Bosnien und im Kosovo bin ich nie gewesen, auch nicht in Somalia oder in Kambodscha. Aber nach dem 11.September 2001, da haben sie sich an mich erinnert. In meiner Naivität und weil ich dachte, ich hätte schon alles erlebt, mich könnte nichts mehr erschüttern, ging ich hin.
Ich werde oft gefragt, warum ich mich nach Afghanistan schicken ließ, hatte ich denn nichts Besseres zu tun als alleinerziehende Mutter? Die Antwort ist einfach. Es war mein Job. Es war mein Beruf. Und mittlerweile hatte ich ein fünftes Kind bekommen und einen Mann gefunden, der in meinem Leben zu bleiben schien. Er würde sich um die Kinder kümmern, wenn ich weg war. Außerdem müssen meine Kinder essen und wohnen und zur Schule gehen, sie wollen ein Fahrrad und neue Fußballschuhe und ins Kino, und ich war nicht nur Ärztin, ich war Soldat. Ja, Soldat. Als ich bei der Bundeswehr anfing, gab es den Begriff Soldatin nicht, und man erklärte uns, dass wir als Berufsangabe nun »Soldat« zu schreiben hatten. Den Begriff »Oberstabsärztin« gibt es immer noch nicht, unvorstellbar, man sagte etwa Hauptfeldwebelin oder Unteroffizierin oder gar Hauptmännin. Es heißt »Frau...