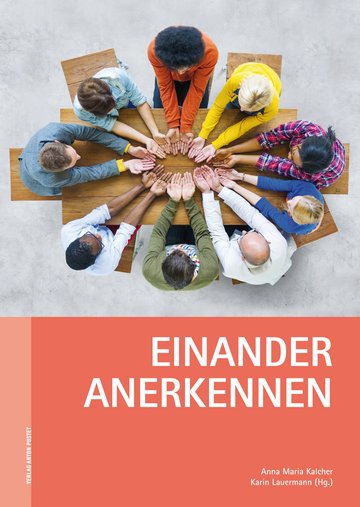Michael Landau
Für eine Kultur der Anerkennung
Zusammenfassung
Anerkennung ist die Basis für ein friedliches Zusammenleben. Es geht um die Akzeptanz der Anderen, des Anderen und eine positive Sichtweise gelebter Vielfalt als Chance für Entwicklungen. Anerkennung bedeutet aber auch Respekt vor dem was anderen heilig ist. Eine Kultur der Anerkennung entsteht nicht beiläufig. Sie ist ein hohes Gut sozialer, politischer und religiöser Weitsicht. Anerkennung braucht den Dialog, aber auch das Wissen um die eigenen Standpunkte.
Es gilt das gesprochene Wort!
Unlängst war ich im Südsudan. Die Caritas Österreich ist seit vielen Jahren in diesem jüngsten Staat der Welt tätig. Die derzeitige Situation dort ist dramatisch, der Hunger ist überall im Land präsent, und die Anzahl jener Menschen, die nicht wissen, wie sie sich und ihre Familie ernähren sollen, hat sich allein in den letzten 18 Monaten verfünffacht. 250 000 Kinder sind vom Hungertod bedroht.
Aufgrund der fortlaufenden ethnischen Gräueltaten spricht Jean Ziegler in seinem jüngsten Buch von der »Hölle im Südsudan« (Ziegler, 2015, S. 198). Gut zwei Millionen Menschen haben aufgrund dieses brutalen Konflikts ihre Heimat verloren. Sie sind auf der Flucht, beraubt ihrer Lebensgrundlagen und auf Nothilfe angewiesen. Etwa eineinhalb Millionen davon sind Flüchtlinge im eigenen Land.
Ich denke an die Kinder im Baby Feeding Center bei Juba. An die kleinen Kinder in den Flüchtlingslagern, mit aufgedunsenen Bäuchen und verfärbten Haaren. Eine Mutter hat dort versucht, Ziegenfüße, die Klauen und das Stück darüber, durch Rösten über offenem Feuer doch noch irgendwie genießbar zu machen; sie waren schon ganz schwarz. Ich denke an die Kinder im Waisenhaus, das wir besucht haben, die bange Frage des Leiters, wovon er sie auch nur halbwegs ernähren soll. Seit 2013 herrscht Bürgerkrieg. Ich denke aber auch an die Zeichen der Hoffnung: Die leuchtenden Augen der Kinder in den Schulen, die Ausbildungszentren, vielfach von Orden getragen, die Projekte im Bereich nachhaltiger Landwirtschaft, wo einer der Bauern im Blick auf das Grün gesagt hat: Es ist ein gesegnetes Land. Beides ist da: Verzweiflung und Hoffnung.
All diese Bilder sind in mir noch sehr präsent, und ich bringe sie auch deshalb zur Sprache, weil ich denke, dass in der globalisierten Welt, in der wir leben, die Frage der Anerkennung auch vor dem Hintergrund einer Weltgemeinschaft betrachtet werden muss, wo einmal mehr die Frage, wer ist mein Bruder, wer ist meine Schwester, auch Menschen in diesen Ländern mit einbeziehen muss.
Nach Karl Rahner hört die christliche Brüderlichkeit, heute würden wir wohl sagen Geschwisterlichkeit, nicht bei der nächsten Nachbarin, beim nächsten Nachbarn und auch nicht beim nächsten Gartenzaun auf, weil die konkrete Situation unserer heutigen Geschwisterlichkeit, ob wir wollen oder nicht, weltweit geworden ist (vgl. Rahner, 1981).
Wer Nächstenliebe an den Grenzen enden lässt, hat nicht verstanden, was Botschaft und Beispiel Jesu meinen!
Die Geschwisterlichkeit mit Blick auf Gotteskindschaft – und zwar geschöpflich aller Menschen – erscheint mir vor einem christlichen Hintergrund ein recht taugliches Bild zu sein, um so manche Dimensionen von Anerkennung anzusprechen.
»Bettler sind Gesprächsthema. Sind sie auch Gesprächspartner?«, so heißt es auf einem Plakat an der Pforte der Erzabtei St. Peter. Armut muss Platz haben. Und ich gratuliere Salzburg zu dieser wichtigen und zeichenhaften gemeinsamen Initiative der Kirchen und Religionsgemeinschaften.
Zur Lebensrealität nicht anerkannter Menschen
An die Caritas wenden sich Menschen in erster Linie, wenn sie sich in einer Notsituation befinden. Sie wissen sich nicht mehr zu helfen. Sie wissen nicht ein noch aus. Viele sind verzweifelt oder ihre Angehörigen sind es.
Und zu einem ganz großen Teil sind das Menschen, die Außenseiterinnen und Außenseiter sind. Wir haben es daher mit dem Gegenteil von Anerkennung zu tun. Die Expertise der Caritas kommt aus der Lebensrealität von nicht oder nicht in ihrer Gesamtheit anerkannten Menschen.
Diese leben an den Rändern der Gesellschaft und des Lebens, sie sehen sich überfordert damit, wie sich unsere Gesellschaft organisiert und darstellt. Sie hatten vielfach schon von Grund auf in ihrem Leben die schlechteren Karten in der Hand. Es sind Menschen, die in ihrer Kindheit oft nie erfahren haben, angenommen zu sein, bedingungslos geliebt zu sein. Menschen, die gedemütigt worden sind, die sich immer als ungenügend wahrnehmen oder es einfach nicht aushalten können, nicht so zu sein, wie die anderen auch.
Und dann gibt es jene, die völlig verarmt sind, nie den Anschluss an das Berufsleben finden konnten oder einfach in einem Land groß geworden sind, das von der Geschichte benachteiligt, ihnen keine Lebensperspektiven gibt. Denken Sie nochmals an die bettelnden Menschen, die zu uns kommen, an die Menschen, die vor Krieg und Gräueltaten nach Europa fliehen und auf diesem Weg alles riskieren.
Oder denken Sie an Menschen, die ihr Obdach verloren haben, zumeist gehen der Verlust von seelischem Obdach und der Wohnung Hand in Hand. Es bleibt ihnen dann nichts übrig, als das harte und erbarmungslose Leben auf der Straße.
Wie begegnen wir ihnen, und wie viele Chancen dürfen sie laut sozialstaatlichem Regelwerk bekommen, wieder im Leben Anschluss zu finden?
Letzthin ist ein Tischler, Herr Hartl aus Oberösterreich, berühmt geworden, weil er einen obdachlosen Menschen einfach als Hilfsarbeiter angestellt hat. Offenbar hatte er den Blick für den Menschen und hat sich von der negativen Erscheinung der Obdachlosigkeit nicht ablenken lassen. Ein tolles Beispiel.
Menschen an den Rändern der Gesellschaft in die Mitte holen
Denken Sie an all jene alt gewordenen Menschen, die merken, wie sehr sie ihr Gedächtnis im Stich lässt, wie sehr sie in eine Welt eintauchen, die von den anderen nicht mehr verstanden wird und die sie auch selbst nicht mehr verstehen.
Wie schaffen wir es als Gesellschaft, demenziell erkrankten Menschen mit Respekt zu begegnen und wertschätzend auf ihre »Verrücktheiten« einzugehen?
Arno Geiger (2011) hat das auf literarische Weise vor dem Hintergrund seines eigenen Engagements für die Pflege des Vaters geschafft. »Der alte König in seinem Exil«, ein wirklich lesenswertes Buch. Und eine Anfrage an unsere Gesellschaft: Wie gehen wir um mit hochbetagten Menschen, mit dem Thema Demenz, mit der Sorge und Entlastung für die pflegenden Angehörigen? Denn kaum eine andere Erkrankung ist so fordernd wie eine Demenz, gerade auch für diese Gruppe der Angehörigen.
Oder ein anderes Beispiel aus der Praxis: Wir haben einen Workshop mit Menschen mit Lernbehinderung durchgeführt. Es ging um das Thema Beschäftigung am regulären Arbeitsmarkt und in der Werkstätte. Ein Teilnehmer meldete sich zu Wort, er sprach davon, dass er grundsätzlich schon sehr gerne draußen, also am regulären Arbeitsmarkt arbeiten würde, aber da bekomme er immer zu hören: »Du bist keiner von uns.« Und man würde ihm immer darlegen, was er alles nicht könne und dass er eben nicht ganz dicht sei.
Er freue sich dann immer, auch in der Werkstätte arbeiten zu können, so setzt er fort, weil dort wisse man, wer er ist, was er kann und »dass er a Mensch ist«. Er fühlt sich angenommen, so wie er ist.
Das ist ein großes Lob für die Mitarbeiterin, es ehrt uns als Caritas. Aber es erschreckt zugleich, weil hier Verletzungen passieren, weil jemand eine Behinderung hat, anders ist. Immer noch geht es um den Abbau von Barrieren – in den Köpfen und ganz handfest in der Gesellschaft. »Behindert ist, wer behindert wird«, so haben wir es einmal versucht in eine Kurzformel zu bringen. »Es ist normal, verschieden zu sein.«
Und Caritasdirektor Johannes Dines (bei dem ich letzthin ganz beeindruckende Projekte etwa für Jugendliche besuchen konnte, die den Einstieg in den Erwerbsarbeitsprozess nicht geschafft haben und jetzt Begleitung und Förderung finden) wird hier noch viele weitere Beispiele aus der Praxis erzählen können.
Achtung und Wertschätzung unabhängig von Leistung und Normalität
Oder in einer anderen Dimension vertieft: In einem Mutter-Kind-Haus der Caritas – neun sind es österreichweit – klopfte vor rund zwei Jahren eine hochschwangere Frau an. Sie wurde aufgenommen. Dem Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stand sie sehr skeptisch gegenüber, hat den Kontakt eher gescheut. Viele Angebote hat sie abgelehnt oder konnte sie einfach nicht annehmen. Einladungen hat sie ausgeschlagen und ein Mitmachen verweigert. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben sich sehr um sie bemüht, waren in Sorge, weil sie stark unter dem Einfluss ihres alkoholkranken Freundes und Vaters des Kindes stand.
Dann hat ihr Freund eine Wohnung organisiert und sie zog aus. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben deutlich ihre Sorge zum Ausdruck gebracht, was dies...