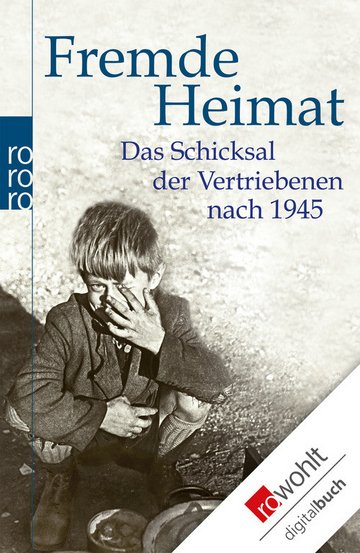Gudrun Wolter
«Flüchtling bleibt man sein Leben lang»: das Schicksal der Vertriebenen nach 1945
Peter Kurzeck hat immer wieder denselben Traum: Mit einem Koffer in der Hand kommt er an einem Bahnhof an. Im selben Moment weiß er nicht mehr, wo er sich befindet. Verzweifelt versucht er, sich wenigstens an das Ziel seiner Reise zu erinnern. Vergeblich. Plötzlich verschwindet sein Gepäck, dann der halbe Bahnhof um ihn herum. Und er steht verloren am Rande eines Niemandslandes …
Peter Kurzeck stammt aus Tachau im Böhmerwald und war drei Jahre alt, als er mit seiner Mutter und seiner Schwester den «Abschub» erlebte, wie die Tschechen die Vertreibung der Sudetendeutschen bis heute nennen. Er wuchs im hessischen Staufenberg auf.
Horst-Dieter Lindner ist, wie er sagt, im Sauerland zu Hause. Dort besuchte er jüngst ein Klassentreffen seiner Realschule. Man sprach über die früheren Zeiten, und er bedankte sich nachträglich bei seinen ehemaligen Mitschülern: «… dafür, dass sie mich nie haben spüren lassen, dass ich aus dem Osten kam.» Als Sechsjähriger ist er mit seiner Familie aus Breslau vertrieben worden, hat Gewalt und Willkür erlebt, die Hilflosigkeit und Todesangst der Erwachsenen, das Gefühl, vollkommen ausgeliefert zu sein. Angekommen im Sauerland, ein evangelisches Stadtkind in einer katholisch-ländlichen Umgebung, hat der Junge seine ganze Kraft darauf verwendet, sich anzupassen. Er ging mit den anderen in die Messe, schaute sich das Bekreuzigen ab, verleugnete seine Herkunft, den sozialen Absturz, die Unterkunft neben dem Flüchtlingslager. Er hat sich, wie viele Kinder von Vertriebenen, mit zähem Fleiß hochgearbeitet – und blieb sein Leben lang darum bemüht, nicht aufzufallen.
Auch Ingrid Berlik hat es geschafft. Sie war zwölf, als sie mit der Mutter und den Geschwistern aus Danzig vertrieben wurde und in Drachensee bei Kiel landete, in einem ehemaligen Lager für Zwangsarbeiter. Das Mädchen aus gutbürgerlichem Hause lebte fortan in einer Baracke, ohne jede Intimsphäre, in hygienischen Verhältnissen, die jeder Beschreibung spotteten, in bitterer Armut. Als «dreckiges Lagermädchen» im Gymnasium ausgegrenzt, verstummte sie – und ging mit zähem Willen ihren Weg. Mit viel Glück errang sie einen Platz in einem katholischen Internat, studierte zwei Jahre in Kiel und konnte 1956, als angehende Lehrerin, mit der Mutter und den kleineren Geschwistern endlich das Lager verlassen und gemeinsam in eine kleine Mietwohnung einziehen. Ingrid Berlik war seitdem viel im Ausland unterwegs, hat nie wieder Wurzeln geschlagen, ein Leben lang auf dem Sprung. Jahrelang hatte sie ausharren müssen in einer unwürdigen Situation, ohne daran etwas ändern zu können. Wenn sie sich künftig irgendwo nicht mehr wohl fühlte, ergriff sie die Flucht.
Peter Kurzeck, Hans-Dieter Lindner und Ingrid Berlik sind drei von zwölf Millionen Deutschen, die als Folge des von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkriegs aus ihrer Heimat vertrieben wurden und in dem Gebiet, das vom Deutschen Reich übrig blieb, ihr Leben ganz von vorn beginnen mussten. Es sind Geschichten wie diese, die heute deutlich machen, dass der Lebensweg dieser Menschen nach 1945 nur unzureichend beschrieben ist, wenn man pauschal von gelungener Integration spricht. Die meisten haben es mit viel Fleiß und Zielstrebigkeit wieder zu materiellem Besitz gebracht und sich darüber hinaus auch die Anerkennung ihrer einheimischen Nachbarn erworben. Doch der Preis dafür war hoch. Sie verstummten, verdrängten, verleugneten, was ohnehin niemand hören wollte.
Schätzungsweise jeder vierte Bundesbürger hat heute Vertriebene in seiner Familie – Großeltern, Eltern oder Schwiegereltern. Die Generation der Enkel weiß häufig genug nur, dass der Opa irgendwo aus Ostpreußen stammt oder die Oma aus dem Sudetenland. Doch wie ihr Lebensweg verlief, welche Kraft der Neuanfang gekostet hat, wie viele Demütigungen sie erlitten, wie viel Zorn und wie viele Tränen sie herunterschluckten, um ihr Ziel, endlich wieder dazuzugehören, nicht aus den Augen zu verlieren – das haben die Alten nicht erzählt und die Enkel nicht gefragt. Und immer wenn in Todesanzeigen ein Geburtsort in Schlesien oder Ostpreußen, in Pommern oder Böhmen auftaucht, ist wieder jemand gegangen, den man hätte fragen können: Wie erträgt man es, wenn einem ohne Vorwarnung jede Sicherheit genommen wird? Wenn man aus allen Bindungen herausgestoßen wird? Wenn man nicht nur Haus und Hof, Hab und Gut verliert, sondern auch Verwandte und Nachbarn und die Gewissheit, in einem vertrauten sozialen Gefüge einen festen Platz zu haben? Wenn man auch die gewohnte kulturelle Umgebung verlassen muss – die Landschaft mit ihrem Licht, ihren Farben und ihrem Geruch, mit Wiesen und Wäldern, mit Dörfern und Städten, mit der typischen Architektur, den traditionellen Festen, mit der Sprache und der Geschichte, in die die eigene Familie eingebunden ist? Was passiert, wenn man Menschen all das nimmt und sie zwingt, als Unbekannte in einer in jeder Hinsicht fremden Umgebung ihr Leben neu zu beginnen? Es sind solche Fragen, die den Anstoß für dieses Buch gegeben haben.
Als sich Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt und Josef Stalin im November 1943 in Teheran trafen, um über eine mögliche Nachkriegsordnung zu beraten, spielten derlei Fragen keine Rolle. Schnell war klar, dass Stalin einen Teil der polnischen Ostgebiete für sich beanspruchte – bis zur sogenannten Curzon-Linie, der 1919 festgelegten polnisch-sowjetischen Grenze, die sich in etwa mit der Grenzziehung des Hitler-Stalin-Paktes von 1939 deckte. Und weil Polen als Opfer des Krieges nicht für Stalins Gebietsansprüche büßen sollte, beschloss man, sein Staatsgebiet auf Kosten Deutschlands nach Westen zu verschieben. Damit waren die Weichen für die Vertreibung von mehreren Millionen in Ostpreußen, Westpreußen, Danzig, Pommern, Posen, Ostbrandenburg und Schlesien beheimateten Deutschen, aber auch von Millionen im zukünftigen sowjetischen Staatsgebiet lebenden Polen gestellt. Was das für die betroffenen Männer und Frauen, Kinder und Alten bedeuten würde, stand nicht zur Debatte.
Zwangsumsiedlungen, Aussiedlungen, Vertreibungen galten seit Ende des Ersten Weltkriegs als probates Mittel, um Nationalitätenkonflikte zu befrieden – Folge der Nationalstaatsidee, die sich im 19. Jahrhundert in Europa auszubreiten begann. Bis dahin definierten sich die Staaten vor allem über die Loyalität ihrer Untertanen gegenüber dem Herrscherhaus. Im Königreich Preußen konnten beispielsweise Hugenotten weiterhin in Schulen und Kirchen französisch sprechen und dennoch preußische Staatsbürger sein. Mit den bürgerlichen Freiheitsidealen und den aufkommenden Nationalbewegungen änderte sich das – jetzt wurde der Staat als Zusammenschluss von Bürgern eines Volkes, einer Sprache und Kultur verstanden. Noch im 19. Jahrhundert lösten sich Griechenland, Serbien, Rumänien und Bulgarien aus dem Osmanischen Reich. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs schließlich gingen aus der Konkursmasse der großen Vielvölkermonarchien – Österreich-Ungarn, russisches Zarenreich und Osmanisches Reich – weitere neue Nationalstaaten hervor: Finnland, Estland, Lettland und Litauen, Polen, die Tschechoslowakei und Ungarn.
Tatsächlich gab es auf der europäischen Landkarte jedoch nur wenige ethnisch einheitlich besiedelte Gebiete. Jeder der neuen Nationalstaaten beherbergte deshalb keinesfalls nur ein einziges Volk, eine einzige Kultur und Sprache. Und so fanden sich plötzlich viele Menschen in ihrer seit Jahrhunderten angestammten Heimat als misstrauisch betrachtete Minderheit eines neuen Staates wieder. Konflikte waren programmiert, und Türken und Griechen waren die Ersten, die sie blutig austrugen – an ihnen wurde vollzogen, was harmlos «Entmischung» hieß. 1923, nach dem griechisch-türkischen Krieg, regelte der Vertrag von Lausanne den «Bevölkerungstransfer» von rund 1,8 Millionen Menschen: 430 000 Türken wurden daraufhin aus Griechenland ausgesiedelt, 1,35 Millionen Griechen mussten die Türkei verlassen – darunter auch die Familie des griechischen Liedermachers Mikis Theodorakis.
Das millionenfache Leid, das diese Vertreibung mit sich brachte, wurde ignoriert. Denn jetzt, als nationale Staaten in Europa Wirklichkeit und nicht mehr wegzudenken waren, galt die «Entmischung» der durcheinander siedelnden Völker als fast zwangsläufige Konsequenz.
«Vertrieben für Frieden» hieß die Formel, und sie galt als Erfolgsmodell zur Vermeidung künftiger Nationalitätenkonflikte. Darauf besann sich zwanzig Jahre später US-Präsident Roosevelt, als er, ein halbes Jahr vor der Konferenz von Teheran 1943, dem britischen Außenminister Anthony Eden erklärte: «Wir wollen Vorkehrungen treffen, um die Preußen aus Ostpreußen auf die gleiche Weise zu entfernen, wie die Griechen nach dem letzten Krieg aus der Türkei entfernt wurden.» Eineinhalb Jahre später verkündete Winston Churchill in einer Rede vor dem britischen Unterhaus: «Die Vertreibung ist – soweit wir es zu überschauen vermögen – das befriedigendste und dauerhafteste Mittel. Es wird keine Mischung der Bevölkerung geben, wodurch endlose Unannehmlichkeiten entstehen wie im Fall von Elsass-Lothringen. Es wird gründlich aufgeräumt.»
Churchill hielt diese Rede am 15. Dezember 1944. Da war der kleine Peter Kurzeck noch in Tachau, Ingrid Berlik noch in Danzig und Horst Dieter Lindner in Breslau. Ein Woche darauf würden sie Weihnachten feiern – ohne zu wissen, dass es das letzte...