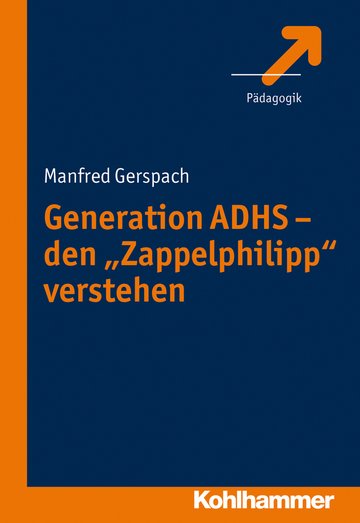2 Zum Verstehen des Phänomens ADHS
2.1 Über den Un-Sinn des Störungsbegriffs
In seiner Minima Moralia schreibt Adorno im Kapitel Die Gesundheit zum Tode: »Unnervosität und Ruhe, bereits zur Voraussetzung dafür geworden, dass Applikanten höher bezahlte Stellungen zugewiesen bekommen, sind das Bild des erstickten Schweigens, das die Auftraggeber der Personalchefs politisch später erst verhängen«. Und er fährt fort: »Keine Forschung reicht bis heute in die Hölle hinab, in der die Deformationen geprägt werden, die später als Fröhlichkeit, Aufgeschlossenheit, Umgänglichkeit, als gelungene Einpassung ins Unvermeidliche und als unvergrübelt praktischer Sinn zutage kommen« (Adorno 1994, S. 68 f.). Diese Sätze wurden vor über 60 Jahren geschrieben und es scheint, als sei die Zeit stehen geblieben. Denn das unnervöse An-sich-halten-Können wird als klaglose Einpassungsleistung noch immer unbesehen abgefordert, und wo dies Probleme bereiten mag, wird nach unbedarfter Fröhlichkeit als innerpsychischer Reaktionsbildung verlangt, das Unwohlsein zu überdecken, heute vielleicht lediglich mit zusätzlichen Stimmungsaufhellern abgestützt.
Die gängige psychologische Klassifikations- und Diagnosepraxis zählt (schul)leistungsbezogene Normverstöße auf und fasst sie unter dem Stichwort »Unaufmerksamkeit« zusammen. Der Unterpunkt »Störungen des Sozialverhaltens« führt im DSM-IV im Zusammenhang mit einer antisozialen Persönlichkeitsstörung die so genannten »Störungen mit oppositionellem Trotzverhalten« an, die sich primär im »Ungehorsam und Widerstand gegen Autoritätspersonen« äußern würden. Der aufgezeigte Symptom- bzw. Syndromkatalog offenbart das Hauptvergehen der betroffenen Kinder. Sie scheinen nicht in der Lage, die Grundvoraussetzungen zur adäquaten Aneignung des institutionell geforderten Lernstoffes zu erfüllen. Im Umkehrschluss wird allerdings auch ein implizites Normalitätsverständnis sichtbar, das auf das spezifische Kompetenz- bzw. Persönlichkeitsprofil des »gesunden Normalschülers« verweist, der sich durch optimale Steuerung des Verhaltens auszeichnet und sich nicht durch unvorhersehbare Affektschwankungen in Lernsituationen irritieren lässt (vgl. Mattner 2006, S. 52 ff.).
Wo die Befindlichkeit eines Kindes als nachrangig behandelt oder in Gänze ausgeschlossen wird, bleibt von ihm nichts als ein ebenso folgwie gelehrsames kleines Etwas, das widerspruchslos bestrebt zu sein hat, seinen Eltern, Erzieher/innen und Lehrer/innen beständig Freude zu bereiten. Alles andere wird schnell pathologisiert und etwa zum oppositionellen Trotzverhalten erklärt.
Dabei ist doch Trotz das altersgemäße Anzeichen aufkommender Autonomiebestrebungen und markiert einen entwicklungspsychologisch wichtigen Schritt, sich von den schutzgewährenden Eltern erstmalig konturiert abzugrenzen. Je angstfreier dieser Konflikt durchlebt werden kann, umso stabiler wird sich die kindliche Persönlichkeit entfalten und umso geringer wird die Neigung ausfallen, manifeste Störungen auszubilden. Kommt es andererseits zu derartigen Verhaltensphänomenen, sind diese nicht isoliert als auszutreibende Kinderfehler zu interpretieren – weil Erwachsene Kinder schon immer gerne ausschließlich negativ wahrnehmen (vgl. Niemeyer 2013, S. 159) –, sondern in ihrem konstruktiven Charakter zu verstehen, ein inneres Dilemma zum Ausdruck zu bringen und gleichzeitig den Versuch zu unternehmen, sich Entlastung zu schaffen.
Trotz will richtig gelesen sein. Offenbar ist uns aber die Fähigkeit abhanden gekommen, ihn noch zu empfinden bzw. zu erinnern oder einen angemessenen Weg zu finden, Kinder mit den dazugehörenden Spitzenaffekten so zu versöhnen, dass sie reifere Formen der Realisierung von Wirklichkeit finden können. Eine aktuelle Studie geht der Frage nach, ob moderne Bildschirmmedien einen Risikofaktor zur Ausbildung von ADHS darstellen (vgl. Maaß u. a. 2010). Abgesehen davon, dass innerfamiliär und soziologisch gesehen ein erhöhter Bildschirmmedienkonsum vielleicht einen Indikator für wenig reife Verkehrsformen in risikobehafteten Umwelten darstellt und somit nicht die Ursache, sondern nur einen Teil der Misere markiert, wird hier statistisch festgehalten, dass das Durchschnittsalter der untersuchten Kinder, die verstärkt oppositionelles Trotzverhalten zeigten, bei 3,9 Jahren lag. Wohlgemerkt: Es geht hier um Kinder im Vorschulalter und eine Altersspanne, die landläufig als Trotzphase bezeichnet wird. Dieses Wissen droht verloren zu gehen, und damit ist die Rückkehr zu einer Zeit der Betrachtung von Kindern als kleinen Erwachsenen, wie sie vor der Aufklärung üblich war, zu befürchten.
Die Einbindung der Erwachsenenwelt in die mehr und mehr rigiden Verkehrsformen neoliberaler Vermarktungsstrategien hinterlässt zunehmend eine kollektive Unterwerfungsgeste. Alles Aufmüpfige erscheint somit politisch suspekt und wird mit dem Stigma des Pathologischen belegt.
Die Distanzierung von Kindheit als Periode einer noch mangelnden Triebbeherrschung und der Auflehnung gegen Autorität steht in diesem Sinne für die Selbstdistanzierung von einer ebenso libidinös eingefärbten wie gefährlichen Erinnerung und repräsentiert einen massiven unbewussten Widerstand. Hernach wäre zu fragen, ob die Fokussierung der empirischen Forschung auf Kindheit unter rein didaktischen Aspekten der optimierten Vermittlung von oftmals sinnentstellt erscheinenden Bildungsinhalten nicht aus Angst vor der eigenen verdrängten Kindheit erfolgt.
Warum also werden solche rigiden normativen Vorgaben gemacht? Gerade die Lehrer/innen sitzen nicht selten einer hohen (neurotischen) Selbstidealisierung auf. »Vorbildhaftigkeit, Universalexpertentum und Anpassungsfähigkeit« sind Anzeichen dieser Einstellung (vgl. Bruns 1991, S. 94). Und immer steht der Erzieher vor zwei Kindern: »dem zu erziehenden vor ihm und dem verdrängten in ihm. Er kann gar nicht anders, als jenes zu behandeln, wie er dieses erlebte« (vgl. Bernfeld 1973, S. 141). Zum einen ist damit ein oft selbstquälerisch erlebter Ambivalenzkonflikt umrissen, inwieweit es statthaft sei, sich in die kindliche Lust an der Nichterfüllung der aufgetragenen Pflichten einzufühlen. Zum andern wird eine narzisstische Abwehrstrategie gegen die kränkende und mit Abwertung gespickte Berufswirklichkeit ausgelöst, die sich als Selbstidealisierung darstellt – »weil ich entwertet werde, muss ich besonders viel von mir halten«. Je mehr diese Selbstthematik überwiegt, umso weniger wird es möglich sein, einen ungetrübten Blick auf die Konflikte und Themen des Kindes zu werfen, die hinter seinem störenden Verhalten in Umrissen aufscheinen. Darf ich mich also mit dem renitenten Kind (in mir) identifizieren oder muss ich mich dem elterlichen Ich-Ideal beugen, nicht gegen die Regeln der Autorität verstoßen zu dürfen? Solange diese handlungsleitende Kraft nicht bewusst wird, lässt sich kein genügender Abstand von der Störung finden, um ihr mit Toleranz, aber auch pädagogischer Klarheit zu begegnen.
Es gibt ein mächtiges Motiv, diesen Anspruch zu verfehlen. Bei Freud heißt es: »Ein Erzieher kann nur sein, wer sich in das kindliche Seelenleben einfühlen kann, und wir Erwachsenen verstehen die Kinder nicht, weil wir unsere eigene Kindheit nicht mehr verstehen« (Freud 1969, S. 128). Leber benennt eine Reihe von inneren Widerständen, die dem Pädagogen die gefühlsmäßige Offenheit gegenüber seinen Klienten erschweren (vgl. Leber 1985, S. 160). Aus leidvollen eigenen Erfahrungen, gemaßregelt worden zu sein, sind ihm beängstigende Phantasien erwachsen, die assoziativ an das verdrängte Kind in ihm erinnern. In der Begegnung mit einem hyperaktiven oder unaufmerksamen Kind werden sie aktualisiert, lösen massive Sperren gegen jede Empathie aus, führen zu einer sinnentleerten, verdinglichten Krankheitszuschreibung mit dementsprechend einengender Praxis.
Hier kann man sich jetzt der Neurobiologie auf geradezu tragische Weise bedienen. Im Zuge der Medizinalisierung menschlichen Handelns konzentriert man sich zusehends auf neurophysiologische und biochemische Wirkmechanismen, die Wechselwirkung mit psychosozialen Faktoren erscheint vollkommen lässlich. Nicht erst seit dem Entstehen einer bis heute sehr erfolgreichen Psychosomatik wissen wir aber, dass lebensgeschichtlichen Hintergründen ein nicht unerhebliches Gewicht bei der Entstehung und für den Verlauf von Krankheiten zukommt (vgl. Loch 1999; Bauer, Kächele 2005). Gesellschaftliche Krankheits- und Störungsmomente werden ausgeblendet, weil das Subjekt auf seine (zu therapierende) Körperlichkeit hin funktionalisiert werden soll. Es erspart uns das...