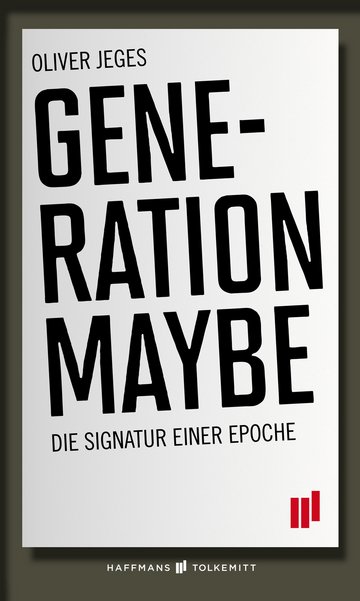EINLEITUNG
»I’m just talkin’ ’bout my g-g-g-generation.«
— The Who
Es stinkt.
Wir sitzen am Maybachufer und schauen der untergehenden Sonne entgegen. Es ist gerade so gegen acht. Eben noch haben wir uns beim Späti mit Bier und Wein eingedeckt. Freunde aus Wien und Hamburg sind da. Das gilt es zu feiern, man hat sich lange nicht gesehen.
Ein angenehmer Wind bläst. Elektro wummert aus einer Box. An uns fließen junge Menschen im Wasser vorbei. Sie recken die Arme in die Luft und winken uns zu. Sie schreien. Die schreienden Gesichter lachen. Wir lachen und winken zurück.
Im Sommer fahren manche Berliner auf kleinen Booten über den Landwehrkanal. Manche feiern Feste, mit Bässen und Bier. Andere rudern gemächlich vor sich hin. Einfach so, um ein wenig zu entspannen. Am Ufer sitzen Leseratten, versunken in ihre Werke der Weltliteratur. Studenten joggen rotbäckig vorbei, Herrchen promenieren mit ihren Hunden. Lesestube, Marathonstrecke, Pissmeile. Jeder kann hier nach seiner Fasson glücklich werden. Ein Ufer als Inbegriff von Freiheit.
Als wir uns mit Bierflaschen zuprosten, zieht wieder dieser üble Gestank vorbei. Riecht irgendwie nach Abwasser. Vielleicht hat es in der Nähe ein Kanalrohr zerrissen, denke ich, und jetzt strömt die ganze Hauptstadtscheiße wie flüssige Lava in den Landwehrkanal. Wir nehmen dennoch alle einen Schluck, den beißenden Geruch ignorierend. Wir tauschen uns aus, es ist viel passiert. Einer hat soeben fertig studiert, eine andere ist jetzt eine junge Mama. Wir sind gut drauf. Und doch zwickt uns was. Wir merken alle, nicht so richtig zu wissen, wo wir hinwollen, wie es im Leben weitergehen soll. Wir leiden nicht darunter. Es ist ein vages, aber doch schneidendes Gefühl, nicht akut, sondern chronisch.
Es geht uns eigentlich gut. Aber es ist dieses schwerelose Gefühl, das uns alle verbindet. Das Gefühl, dass wir auf der Stelle treten. Dass wir uns schwertun mit Entscheidungen. Dass wir nicht wissen, was richtig und was falsch ist. Jenes namenlose Gefühl ist die Urkraft meiner Generation. Es ist unsichtbar. Aber es ist irgendwie anrüchig. Genauso wie der latente Klosett-Mief an diesem Spätsommerabend am Maybachufer.
Ich bin ein Maybe.
Meine Freunde sind Maybes.
Deren Freunde sind es auch, wie sie mir erzählen.
Und deren Freunde – nun gut, lassen wir das.
Ich bin ein Maybe. Ich wäre zwar gern keiner, aber es ist nun mal so. Ich tue mich schwer, Entscheidungen zu treffen. Mich festzulegen. Mich einer Sache intensiv zu widmen. Ich habe kein ADHS. Und dennoch bin ich aufmerksamkeitsgestört, entscheidungsschwach. Ich sehe all die Optionen vor mir, die Verlockungen einer ultramodernen Welt, in der alles möglich ist. Egal, was wir wollen, was ich will, es ist meist nur einen Mausklick entfernt. Seit wann das so ist, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob ich Opfer eines Zeitgeistes oder freiwillig mit vollem Tempo in diese Geisteshaltung hineingedonnert bin. Es spielt im Grunde auch keine Rolle.
Ich würde am liebsten immer ganz genau wissen, wo ich im Leben mit mir hin will. Genauso gerne hätte ich ständig gutes Wetter, nie Erkältungen und immer gute Laune. Aber das gibt es nur in der Werbung. Irgendwann habe ich festgestellt, dass es nicht nur mir so geht, sondern vielen anderen Altersgenossen ebenso. Ja, eigentlich den meisten.
Doch womit ringen wir?
Unsere Probleme sind in der Tat überschaubar: Haben wir unsere Ernährung den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen angepasst? Sollen wir das milde oder das prickelnde Mineralwasser trinken? Und warum ist dieses verdammte Internet schon wieder so langsam, ausgerechnet dann, wenn man gerade den neuesten Kracher von Quentin Tarantino aus dem Netz saugen will!?
Keine Wirtschaftskrise vermag uns in Panik zu versetzen, aber ein verspäteter Billigflieger nach Mallorca oder London. Wenn wir politisch etwas anpacken, ob Occupy-Proteste oder Piratenpartei, geht es fast immer in die Hose – und das dünn und flott.
Wir sind die erste Alterskohorte, die immer öffentlich ist. Die kaum noch Privatsphäre kennt. Wir teilen unser Leben mit unseren digitalen Freunden, wollen von ihnen bewundert oder gebauchpinselt werden. Seht her, was ich kann, was ich habe, wen ich kenne, wo ich überall bin.
Wir sind eine Generation ohne Eigenschaften.
Eigenschaftslos.
Das heißt nicht, dass wir nichts zustande bringen. Es heißt nur, dass wir schlicht keine Ideale oder Werte haben. Wir haben kein Wir-Gefühl. Wir sind Ichlinge, die durch die Zeit geistern. Haben frühere Generationen sich noch gefragt »Was ist der Sinn des Lebens?«, fragen wir uns heute »Wer bin ich, und wenn ja, wie viele?«. Und vor allem sagen wir lieber Jein, als uns auf etwas festzulegen.
Beschrieb Florian Illies seine Generation Golf, also die zwischen 1965 und 1975 Geborenen, noch als harmlose Spießgesellen mit leichter Neigung zum Hedonismus, so ist die heutige Generation der ab 1980 Geborenen beinahe das genaue Gegenteil. Wir leben ökologisch bewusst, neigen zu minimalistischen Lebenskonzepten, haben oft Spiritualität für uns entdeckt. Während es sich die Generation Golf in ihrer Kindheit noch bei »Wetten, dass …?« und später bei Harald Schmidt auf der Couch gemütlich machte, besitzen viele in unserer Generation gar keinen Fernseher mehr. Wenn wir gucken, dann am liebsten Joko & Klaas – und das online in der Mediathek. Wir sind die erste Generation, in deren Jugend bereits das Internet hineinragte. Wir sind die erste kabellose Generation. Wir gucken weder öffentlich-rechtlich noch privat, sondern zeitautonom. Ein Leben in analoger Unschuldigkeit kennen wir zwar, aber lediglich aus unserer frühen und mittleren Kindheit. Waren die Golfer als unsere älteren Geschwister noch ein homogener Schmelztiegel, sind wir Maybes ein heterogenes Mosaik.
Unsere gemeinsame Eigenschaft ist, dass wir keine gemeinsame Eigenschaft haben.
Politisch? Sind wir weder links noch rechts. Wirtschaftlich? Sind wir weder für einen starken Staat, noch glauben wir an die Allmacht der Märkte. Kulturell? Können wir uns sowohl mit Harry Potter als auch mit Lars von Trier anfreunden. In den Urlaub fahren wir ebenso gerne nach Barcelona, Kalifornien oder Vietnam wie auch in die heimatliche Provinz. Das gesamte Wissen der Welt steht uns heute mit Google, Wikipedia und Konsorten kostenlos und rund um die Uhr zur Verfügung. Wer keine Skrupel kennt, kann sich Filme, Musik und Literatur aus dem Netz holen, auch ohne einen einzigen Cent dafür zu bezahlen. Illegal zwar, aber möglich. Wer sich bilden will, ist nicht mehr zwingend auf Herkunft, Eltern, Schule, Umfeld, Arbeit oder Geld angewiesen. Zwischen der kanonischen Bildung und einem selbst steht nur noch die Entscheidung, den ersten Schritt zu tun.
Wir sind die Superangepassten. Die Alleskönner. Die Alleswoller.
Haben oder Sein ist für uns keine Frage. Konsum sehen wir kritisch, schlagen dann und wann aber so richtig zu. Mit uns kommt irgendwann die erste Generation in Chefetagen, die nicht in Chefetagen will. Für uns ist jeder Tag ein Casual Friday. In Schale werfen wir uns maximal fürs Familienfest, aber nicht unbedingt fürs Büro. Falls wir überhaupt noch in ein Büro gehen. Unser Arbeitsplatz ist schließlich da, wo es WLAN gibt. Ob zuhause am Schreibtisch, im Szene-Café oder im »Coworking Space«.
Viele von uns beschleicht das Gefühl, dass sich Leistung nicht mehr lohnt. Man kann rund um die Uhr schuften, in teils mehreren Berufen, kann unzählige Praktika vorweisen, und doch bekommt ein anderer den heiß ersehnten Job. Wir wissen noch nicht genau, wie Arbeit im digitalen, wissensbasierten 21. Jahrhundert aussehen soll. Was wir aber wissen, ist, wie es nicht sein soll: keine 40-Stunden-Woche, mehr Freiheit, um Hobbys zu pflegen oder Zeit mit der Familie zu verbringen.
Wenn wir uns nicht gerade über unsere ausbeutenden Arbeitgeber und unbezahlten Praktika beschweren, sehen wir die Welt durch eine rosarote Brille. Wir meinen, alles im Leben erreichen zu können. Auch die Riesenvilla mit Hauspersonal, Luxusyacht, Geld und Ruhm. Sollte das nicht gelingen, sind wir enttäuscht.
Eigentlich läuft ja alles ganz gut, wäre da nicht diese innere Leere. Denn unsere Generation durchzieht ein Knacks. Ein feinsäuberlicher Riss. Wir wissen nicht, wann und wo wir ihn uns zugezogen haben, aber er breitet sich aus. Wir wissen, dass es uns an nichts fehlt – und doch fehlt uns was. Ist es ein Sinn? Orientierung? Sind es Werte? Wahrscheinlich von allem etwas.
Wir sind die Richtungslosen, die sich nicht entscheiden wollen oder können. Entschlüsse schieben wir so lange auf, bis es schon fast wehtut. Prokrastination heißt der fachchinesische Begriff dafür. Niemand vor uns kannte dieses Wort. Aufgrund so vieler Optionen wie nie zuvor in der Geschichte kämpft unsere Generation mit jenem Überangebot, das ihr potentiell zur Verfügung steht. Als wären wir allesamt von der DDR in den Westen geflohen und fänden uns nun mit dem neugewonnenen Überfluss an der Wursttheke oder im Obstregal nicht zurecht.
Wir stecken fest. Wie in einem Aufzug in einem hundertstöckigen Wolkenkratzer. Auf der Fahrt haben wir auf einmal vergessen, wo wir eigentlich aussteigen und...