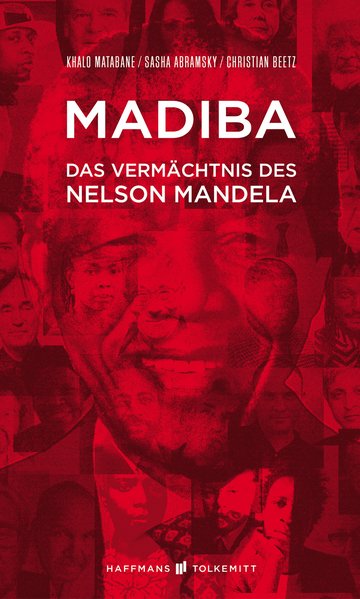Einleitung
von Sasha Abramsky
NELSON MANDELA ist eine der großen Gestalten auf der Weltbühne des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts. Wie kein anderer zeitgenössischer Politiker gewann er nicht nur die Achtung eines breiten Spektrums von Menschen unterschiedlichster politischer Überzeugungen, sondern er wurde geliebt. Die Menschen nahmen Anteil an Mandelas Schicksal – an den Qualen seiner Gefängniszeit, an seinen Taten nach seiner Freilassung, an der Botschaft seines Lebenswegs. Nicht nur sein Einzelschicksal berührte die Menschen, sondern er wurde für sie zum Inbegriff edler Gesinnung und der Unbeugsamkeit des menschlichen Geistes. Mit seinem Lebensweg – vom berüchtigten Gejagten, der »Schwarzen Pimpernell« der weißen Propaganda, zum Gefängnisinsassen aus Gewissensgründen bis hin zum Verwandler und Heiler eines rassisch gespaltenen Südafrika und zum Präsidenten der reichsten afrikanischen Nation – wurde Mandela für viele zum Hoffnungsträger und Heilsbringer.
Wenig überraschend überdeckte das Image, das Symbol Mandela, häufig die Realität, dass auch er nur eine einzelne, sehr menschliche Person war; dass er trotz all seiner hehren Ideale und Träume keine Glückseligkeit bringen konnte, weder seinem eigenen Land noch den vielen anderen auf der ganzen Welt, die unter Konflikten, Spaltungen, Armut und Ungerechtigkeit leiden.
Vom 11. Februar 1990 an, jenem Tag, als Mandela als freier Mann das Gefängnis verließ, bis zum Tag seines Todes im Alter von 95 Jahren in den späten Abendstunden des 5. Dezember 2013 überstrahlte der Mythos den Menschen. Mandela wurde zu einem Aushängeschild, jemandem, den man in öffentlichen Diskussionen kaum kritisieren durfte, einer Gestalt von Weltgeltung, der man auf der internationalen Bühne begegnet sein musste. Die Berühmten rissen sich um ihn wie einst um Gandhi mehr als ein halbes Jahrhundert zuvor, er wurde so geliebt und oft zitiert wie Martin Luther King. Er wurde zum »Madiba« der Welt, ein liebenswerter, beinahe knuddeliger Elder Statesman, der mit seinem ansteckenden Lächeln und seinen herzlichen Umarmungen die hoch geschätzte Fähigkeit besaß, noch den zynischsten Nachrichtenjournalisten zu verzücken. Wer wollte nicht gerne etwas von diesem Zauber abbekommen?
Als sich die Nachricht vom Tod der 95-jährigen Führungsgestalt am frühen Morgen des 6. Dezember verbreitete, brach eine weltweite Welle der Trauer los, die so spontan wie faszinierend war – wobei sich die Faszination ebenso daraus speiste, wer Worte der Trauer fand, wie aus dem, was gesagt wurde: Britische und amerikanische Politiker aus konservativen Parteien, die sich eine Generation zuvor noch überschlagen hatten, Mandela als Terroristen zu brandmarken, priesen den verstorbenen südafrikanischen Politiker nun als Helden des Wandels. Er habe, so bekräftigten sie, allen den Weg nach vorn gewiesen. Mit seiner Großzügigkeit und seiner Weigerung, sich mit einer Politik der Rache zu revanchieren, habe er die besseren Geister der Welt geweckt. In Ländern, die von erbitterten politischen Kämpfen zerrissen sind, bewirkte Mandelas Tod eine vorübergehende Eintracht der gegnerischen Parteien. In den Vereinigten Staaten beteuerte Präsident Obama im bewussten Rückgriff auf die Sprache, die Abraham Lincolns Kriegsminister Edwin Stanton verwendete, als er dem ermordeten Unionsführer 1865 Tribut zollte, dass Mandela »nicht länger uns gehört. Er gehört allen Zeitaltern.« Auf der anderen Seite des politischen Spektrums lobte der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, John Boehner, Mandela als eine »unermüdliche Stimme der Demokratie«. Sein »langer Weg zur Freiheit«, fuhr der Kongressabgeordnete fort, »bewies einen fortdauernden Glauben an Gott und Respekt für die Menschenwürde«.
Und doch, in so vieler Hinsicht ist der Mann selbst eine weit interessantere Person als die mythologische Gestalt, deren Tod weltweit solche außergewöhnlichen Lobreden auslöste.
Für sich allein genommen war Mandela ein außerordentlicher Mensch: ein leidenschaftlicher Revolutionär, der zum bewaffneten Kampf gegen den Apartheidstaat rief; einer der eloquentesten und langlebigsten Freiheitskämpfer Afrikas; ein Mann, der hinter Gittern ein beinahe drei Jahrzehnte währendes Selbstgespräch darüber führte, wie das Land, das ihn eingekerkert hatte, am besten zu verändern wäre, und der dabei zu dem Schluss gekommen war, dass ein Vorankommen allein durch einen friedlichen, auf dem Verhandlungsweg erreichten Wandel möglich wäre; der die Großherzigkeit besaß, jenen zu vergeben, die ihm Unrecht getan und so vielen seiner Kampfgefährten Leid zugefügt hatten – häufig mit tödlichen Folgen. Ein Mann, der mit Mitte siebzig in einer demokratischen Wahl ohne Rassendiskriminierung zum Präsidenten Südafrikas gewählt wurde, was nur wenige Jahre zuvor kaum ein Beobachter für möglich gehalten hätte. Und der dann eine Wahrheits- und Versöhnungskommission einsetzte, um das Unrecht, die Erniedrigung, die alltägliche Gewalt des Apartheidstaates zu dokumentieren, ohne eine Politik staatlich sanktionierter Rache zu entfesseln, die nur zu leicht in einen Bürgerkrieg hätte führen können. »Ich war völlig überwältigt von seiner Großherzigkeit«, sagt der nigerianische Schriftsteller und politische Aktivist Wole Soyinka. »Zu so etwas wäre ich nie in der Lage. Die Wahrheits- und Versöhnungskommission ist in meinen Augen ein Wunder an Menschlichkeit.«
Der Katalog von Mandelas Errungenschaften ist lang. Aber wie er selbst nur allzu gut wusste, war nicht alles eitel Sonnenschein. Seine Ehe mit Winnie Mandela zerbrach unter einer Reihe von Anschuldigungen gegen die Clique brutaler Schläger, mit der sie sich während seiner Gefangenschaft umgab. Die Wirtschaft in Südafrika, entlang von Rassengrenzen gespalten, blieb auch nach dem Ende der Apartheid von furchtbarer Ungleichheit geprägt und bot Abermillionen von schwarzen Südafrikanern und verzweifelten Migranten aus anderen Teilen des Kontinents kaum Chancen. Zahlreiche Shantytowns verschandelten das Land. Südafrika gehörte zu den Ländern mit dem höchsten Anteil an HIV-Infizierten auf der Welt. Und die Rate der Gewaltverbrechen in Südafrika schoss in die Höhe. Es stimmt, Mandelas Politik dürfte wohl einen Bürgerkrieg verhindert haben; doch die Gewalt und Krankheiten, die mit Massenarbeitslosigkeit und einem erschütternden Maß an Ungleichheit einhergingen, waren Warnsignale, dass im neuen Südafrika noch nicht alles zum Besten stand.
Madiba. Das Vermächtnis des Nelson Mandela möchte diesen komplexen Realitäten nachspüren, die Mandela verhüllenden mythologischen Schleier lüften und in einer Serie offener Gespräche die Bedeutung erkunden, die er für die Südafrikaner wie für seine Freunde, Kollegen und Kritiker aus aller Welt hatte. Die Absicht ist nicht, Mandela oder sein Erbe zu schmälern, sondern noch tiefer zu verstehen: Mandela als eine dreidimensionale Gestalt vorzustellen und die Regenbogennation, über deren Gründung er präsidierte, als komplexes, im Werden begriffenes Unterfangen zu erfassen.
Das Buch entstand aus einem Filmprojekt, das in Südafrika mit einer Idee von Regisseur Khalo Matabane seinen Anfang nahm. Matabane, der in mehreren Filmen der Gewalt des Apartheidregimes nachging und die Lebenswege von Menschen nachzeichnete, die gegen das unterdrückerische System kämpften, war seit langem von Mandela und seiner Bedeutung für die Menschen in Südafrika und darüber hinaus fasziniert. »Ich bin unter der Apartheid geboren, in einer konservativen Gemeinde in Limpopo im Norden Südafrikas«, erzählt Matabane. »Nelson Mandela war für mich ein Held, und als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, dachte ich, die Apartheid, der Rassismus und die Ungerechtigkeit würden im Nu verschwinden. Ich war ein Teenager. Ich weiß nicht genau, wie ich mir die Freiheit vorgestellt hatte, aber sie besaß für mich etwas Magisches.« Natürlich war die Wirklichkeit verzwickter und beileibe nicht so schön, und mit der Zeit wuchs bei vielen Südafrikanern ein tiefes Misstrauen gegen den Prozess der Aussöhnung mit den Nutznießern des Apartheidsystems. Inmitten dieser Enttäuschung blieb Mandela für einige beinahe ein Heiliger, andere fingen dagegen an, ihn mit anderen Augen zu betrachten. »Ich glaube, was dann im weiteren Verlauf geschah, war, dass sich die Schwarzen insgesamt als großzügig erwiesen haben, und wir hatten angenommen, dass unsere weißen südafrikanischen Mitbürger – ich meine verallgemeinernd gesprochen – das Geschenk, das wir ihnen mit der Versöhnung gemacht haben, anerkennen, auf uns zugehen und ihrerseits eingestehen würden, was...