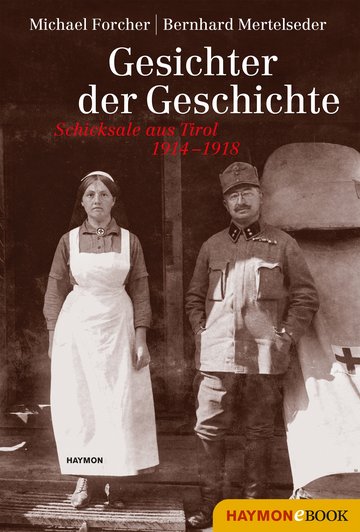»Ich verfluchte Gott und den Teufel ...«
Giovanni Pederzolli und seine aufwühlenden Kriegserinnerungen
Er war nur ein Tischler, allerdings nicht ein ganz gewöhnlicher, denn er war auch »lucidatore di mobili«, also ein Möbelpolierer, ein Kunsttischler könnte man sagen. Giovanni Pederzolli, 1879 in Sacco geboren, heute ein Stadtteil von Rovereto, schrieb auch Gedichte und hinterließ eine der beeindruckendsten Beschreibungen des Krieges in Galizien. Sie ist nicht bruchstückhaft in einem Tagebuch festgehalten, aber auch nicht rückblickend Jahre danach entstanden. Das Erzähltalent Pederzolli brachte den ersten Teil bereits ein Jahr nach seiner schweren Verwundung und Gefangennahme in einem Spital in Nischni Nowgorod noch ganz unter dem Eindruck des Geschehens zu Papier und beendete die Niederschrift im November 1916 im Lazarett der Wiener Stiftskaserne. Eine zentrale Stelle daraus: »Die Russen flohen. Die nicht rechtzeitig davonkamen, nahmen wir gefangen. Es war höchste Zeit. Es fehlte wenig und wir wären zu erschöpft dazu gewesen. Als endlich alles vorbei war, schaute ich über das Schlachtfeld. Mein Gott, welches Blutbad! Die Toten in seltsamen Stellungen übereinandergehäuft, die Verwundeten röchelten um Hilfe, wir alle voller Blut wie die Schlächter, über allem jetzt eine Stille, die nach so viel Lärm umso drückender war. Ich sah die Toten und Verwundeten, hob die Hände und floh wie ein Wahnsinniger, nur weg von diesem verfluchten Bild, die Gedanken bei den vielen unverschuldeten Opfern und bei Gott, der diese Grausamkeit zulässt. Es kam mir wie ein Wunder vor, dass Bennoni und ich heil geblieben waren, ausgerechnet wir beide. Aber warum gerade wir zwei und die anderen zehn von unseren Freunden tot oder schwer verwundet. Ausgerechnet wir zwei! Warum? Ich verfluchte Gott und den Teufel, verfluchte alles, und ich dankte Gott nicht, dass er mich errettet hatte. Ich war zu aufgebracht. Aber warum sollte ich Ihm auch danken, Ihm, der ein solches Gemetzel an armen Unschuldigen zuließ.«
Giovanni Pederzolli hatte sich als Wehrpflichtiger sofort nach Bekanntgabe der Mobilmachung bei seinem Kaiserjägerregiment in Trient gemeldet, war aber nicht unter den ersten, die nach Galizien geschickt wurden. Seinem leichtsinnigen Temperament schreibt er es später zu, dass er sich in angetrunkenem Zustand auf eine Rauferei mit einem Unteroffizier und einem Offizier einließ, die beiden bedrohte und beschimpfte, und das Vaterland gleich noch dazu. Dass ihn deshalb ein Militärgericht im Castello del Buon-consiglio zu vier Monaten schwerem Kerker verurteile, betrachtete Pederzolli »als wahrhaft mildes Urteil in jenen Zeiten des Krieges«. Noch dazu begnadigte ihn der General schon nach neun Tagen und schickte ihn zurück zur Truppe.
Wieder bei seiner Einheit, erkrankte Pederzolli und brauchte Monate, bis er wieder einsatzbereit war. So wurde er erst am 2. Mai 1915 mit einem Marschbataillon nach Galizien einwaggoniert. Dort setzt seine Niederschrift ein. Es sind die Tage nach der siegreich geschlagenen Durchbruchschlacht von Gorlice-Tarnów. Immer wieder kommt es bei der Verfolgung der Russen zu blutigen Kämpfen; einmal Rückzug, dann erneuter Angriff. Nahkampf mit Bajonetten.
Pederzolli erzählt von Hunger und Durst, die sie zu erleiden hatten, weil der Train nicht rasch genug folgen konnte. Schlimmer noch als der Hunger sei der Durst gewesen. Und der wurde ihm schließlich zum Verhängnis. Es war am 7. Juli 1915. Seit drei Uhr morgens war die Hölle los. Artillerieduelle über die Köpfe der Kaiserjäger hinweg, die in ihren für die Nacht gegrabenen Löchern steckten. Ein wolkenloser Tag. »Die Sonne brannte auf unsere Köpfe, der Durst fraß uns auf. […] Der Mund voll Dreck, die Augen vom Staub und Rauch fast blind, und der Magen leer seit drei Tagen. Gegen 8 war es nicht mehr auszuhalten.« Da rief der Kommandant Pederzolli zu sich und befahl ihm nicht, sondern bat ihn (»Wenn Du Dich nicht imstande fühlst dazu, dann bleib«), mit ein paar Freiwilligen im nahen Dorf Wasser zu holen. Dazu mussten sie unter russischem Feuer ungefähr 600 Schritte über freies Gelände laufen, bis ihnen ein kleiner Wald und dann das Dorf Schutz boten. »Wenn ein Offizier bittet, statt zu befehlen, gilt das Leben nichts mehr für mich.« Zu fünft liefen sie um Wasser und um ihr Leben. Zwei schafften es nicht, drei kamen im Wald an und erreichten das Dorf, füllten so viele Flaschen mit Wasser, wie sie tragen konnten, und machten sich auf den Weg zurück. Wieder im Wald angekommen, lag das freie Gelände davor derart unter Feuer, dass an ein Durchkommen nicht zu denken war. Was tun? Da sahen sie die eigene Kompanie in überstürzter Flucht, verfolgt von den Russen. »Wenn wir nicht hinüber zur Kompanie kommen, geht’s in die Gefangenschaft. Ein Hügel lag zwischen uns und nahm uns die Sicht auf einen guten Teil des Schlachtfeldes. Wer weiß, dachte ich, wenn wir da hinauf kommen, müssten wir die Fliehenden erreichen. Vorwärts, schrie ich. In zehn Minuten waren wir auf dem höchsten Punkt. Großer Gott! Was für ein Schauspiel bot sich unseren Augen. Voll Entsetzen sah ich es: Der Hang auf der anderen Seite war bedeckt mit Verwundeten und Leichen. Im Hintergrund sah man die Unseren Hals über Kopf davonrennen, und die Russen, mindestens vierfach überlegen, folgten in Schussweite. Ich sah herum: Russen, überall Russen. Wir waren umzingelt. Was ich jetzt tat, war Wahnsinn. […] Ich nahm alle Munition, die mir noch geblieben war, und schoss wie ein Wahnsinniger. […] Plötzlich, ich kann es mir selbst nicht erklären, verspürte ich einen Schlag gegen den Kopf, der wie von innen kam. Ich fiel wie vom Blitz getroffen. Jetzt bin ich tot, dachte ich. Ich wartete, doch der Sensenmann ließ sich zu lange Zeit. Ich öffnete die Augen. Sah uns. Ich war also weder tot noch blind. Nur der Kopf tat höllisch weh. Ich versuchte, ihn mit der Hand abzutasten. Bis zur Nase herunter war ich unverletzt. Ich suchte den Mund. Großer Gott! Es war ein Klumpen aus Fleisch und Brocken von Knochen; die ganze rechte Kinnlade hing herab, und aus dem schrecklichen Riss quoll das Blut in Wellen. Das Kinn lag auf der rechten Schulter. Gut zwanzig Zähne lagen verstreut über die Wiese, zusammen mit Knochen, Zahnfleisch und Kieferstücken. Ich versuchte aufzustehen, aber auch die rechte Schulter war unbrauchbar. Das verfluchte Schrapnell hat mir nicht nur den halben Mund weggerissen, sondern auch die Schulter zermalmt.« Es war ein hünenhafter russischer Soldat, der Giovanni Pederzolli das Leben rettete, indem er ihn verband und unter dem Feuer der Kanonen vom Hügel hinunter an eine sichere Stelle trug. Danach holte er Pederzollis Kameraden, rief die Sanitäter und verschwand. »Ich sah den guten Russen nie wieder.« Pederzolli war dem Tode näher als dem Leben, als man ihn ins nächste russische Feldspital brachte.
Giovanni Pederzolli (links) als Kaiserjäger zusammen mit einem namentlich nicht bekannten Kameraden
»Hier begann mein wahrer Kreuzweg.« Er bestand aus grässlichen Schmerzen in überfüllten Lazaretten, auf endlos langen Fahrten kreuz und quer durch Russland bis nach Sibirien, während er nur durch ein Röhrchen oder mit kleinen Löffelchen Schluck für Schluck mühsam ernährt werden konnte, und aus mehreren Operationen, deren erste in Minsk ein russischer und ein österreichischer Arzt gemeinsam vornahmen. Im Zuge einer Austauschvereinbarung über verwundete Kriegsgefangene wurde Giovanni Pederzolli im Juni 1916 zusammen mit vielen Leidensgenossen ins neutrale Schweden überstellt und von dort über Deutschland und quer durch Böhmen nach Wien, wo er ins Reservespital der Stiftskaserne eingeliefert wurde. Die Schmerzen, die er 24 Stunden am Tag zu erdulden hatte, waren schier unvorstellbar, schreibt Pederzolli.
Überwältigend aber auch die Freude, seine Mutter im Flüchtlingslager Mitterndorf bei Wien besuchen zu dürfen. Seit der Evakuierung von Rovereto im Mai 1915 musste sie dort in einer der vielen Baracken ihr Leben fristen. Auch seine Frau hatte damals die zum Kriegsgebiet gewordene Heimat verlassen müssen und hatte Budweis in Böhmen als Aufenthaltsort zugewiesen bekommen. Jetzt konnten die Eheleute mehrmals beisammen sein, mehrere Tage in Wien und ganze vier Wochen in Budweis. Maria Pederzolli übersiedelte später zu ihrer Schwiegermutter ins Lager von Mitterndorf, das näher bei Wien lag.
Giovanni Pederzolli im Spital von Rovereto (wahrscheinlich 1924)
Giovanni Pederzolli musste sich in Wien zwei schwierigen Operationen unterziehen. Nach dem Krieg versuchte man in Rovereto noch einmal, durch eine Operation eine Verbesserung seiner eingeschränkten Lebensqualität zu erreichen. Im dortigen Krankenhaus bekam er Besuch von einem Mönch, der ihm die Kommunion spenden und davor die Beichte abnehmen wollte. »Warum? Etwa um Vergebung dafür zu bitten, dass ihn dieser Mördergott dem Wahnsinn der Mächtigen ausgeliefert hat? Der Pater sagte: Denke, denke darüber nach.« Und in einer neuen Zeile lässt Giovanni Pederzolli einen der späteren Nachträge zu den Erinnerungen mit den Worten enden:...