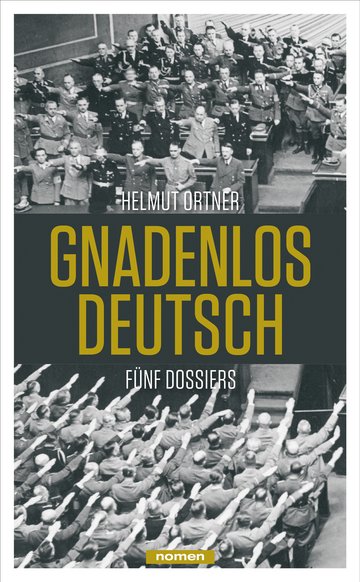Die Gegenwart der Vergangenheit
oder: Herr Hanning steht vor Gericht
Im westfälischen Detmold ging im Juni 2016 ein weltweit beachteter Prozess zu Ende. Vor Gericht stand ein 94-jähriger Greis: der ehemalige Ausschwitz-Wachmann Reinhold Hanning. Obwohl ihm die Richter keine konkrete Tatbeteiligung nachweisen konnten, wurde er wegen Beihilfe zum Mord in mindestens 170 000 Fällen zu fünf Jahren Haft verurteilt. Ein ungewöhnliches Urteil. Während der Verhandlung tat Hanning das, was die meisten seiner Generation seit 70 Jahren getan haben, wenn es um ihr Tun und Nichtstun zwischen 1933 und 1945 ging: er schwieg.
Nicht einmal seiner Familie habe er über Ausschwitz erzählt, berichteten seine Verteidiger. Hannings erwachsener Sohn saß hinten im Gerichtssaal: ratlos, sprachlos, verunsichert. Was wusste er über das Tun seines Vaters? Was hätte er wissen können? Hatte er ihn jemals befragt? Zu Hitler-Deutschland, zu Ausschwitz, zu seiner Zeit als junger Soldat? Zum Schweigen gehören häufig zwei: einer, der nichts sagt, und ein anderer, der nichts fragt. Nach dem Krieg wurde in vielen deutschen Familien geschwiegen.
»Sie waren knapp zweieinhalb Jahre in Auschwitz und haben damit den Massenmord befördert«, sagte Richterin Anke Grudda zu Beginn der Urteilsbegründung. Ursprünglich hatte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von sechs Jahren gefordert. Sie sah es als erwiesen an, dass der frühere Wachmann des Vernichtungslagers mit seinem Einsatz zum Funktionieren der Mordmaschinerie in Auschwitz beigetragen hat. Hanning war von 1943 bis 1944 in Auschwitz eingesetzt. Er hatte im Prozess zugegeben, Mitglied der SS-Wachmannschaft des Vernichtungslagers der Nationalsozialisten gewesen zu sein und vom Massenmord gewusst zu haben.
Die Verteidigung hatte Freispruch gefordert. In der Verhandlung waren nach ihrer Ansicht keine Beweise für die direkte Beteiligung ihres Mandanten an den Morden vorgelegt worden. Er habe zu keinem Zeitpunkt Menschen getötet oder dabei geholfen. Er habe nur seinen Dienst als Wachmann verrichtet.
In einer Erklärung hatte Hanning Reue über seine SS-Mitgliedschaft bekundet. »Ich schäme mich dafür, dass ich das Unrecht sehend geschehen lassen und dem nichts entgegengesetzt habe.« Er wünsche, nie in dem KZ gewesen zu sein.
Man konnte ihm abnehmen, dass er das aufrichtig meinte. Aber das Gericht hatte dennoch Zweifel. Man habe »keine Möglichkeit gehabt, den echten Menschen Reinhold Hanning kennenzulernen«, stellte die Richterin nüchtern fest. Die Nebenkläger waren erst recht nicht von der aufrichtigen Reue des ehemaligen SS-Mannes überzeugt.
Hanning habe einen Beitrag zum »reibungslosen Ablauf der Massenvernichtung« geleistet, das Morden billigend in Kauf genommen. Da spiele es eine untergeordnete Rolle, wie groß dieser Beitrag gewesen sei, so das Gericht. Es gab ihn – und dadurch machte Hanning sich schuldig. Die Richterin Anke Grudda wandte sich direkt an den 94-Jährigen, der im Rollstuhl sitzend ihre Worte äußerlich weitgehend regungslos aufnahm: »Sie haben zweieinhalb Jahre zugesehen, wie Menschen in Gaskammern ermordet wurden. Sie haben zweieinhalb Jahre zugesehen, wie Menschen erschossen wurden. Sie haben zweieinhalb Jahre zugesehen, wie Menschen verhungerten.«
Hanning habe sich mit seiner Tätigkeit arrangiert, sei in Auschwitz zweimal befördert worden und habe sich nicht an die Front versetzen lassen. Dass er keinen Dienst an der Rampe verrichtet haben will, wo Menschen für den Arbeitseinsatz aussortiert und der Rest direkt in die Gaskammer geschickt wurde, sei eine Schutzbehauptung, so die Richterin. Mehr noch – sie äußerte ehebliche Zweifel: »Dass Sie nie an der Rampe gestanden haben, halten wir für völlig abwegig.« Genauso sei »ausgeschlossen, dass Sie nicht ein einziges Mal erlebt haben, wie Menschen in die Gaskammern gingen«. Der Greis blickte zu Boden. Stille im Gerichtsaal.
Eine Stunde lang sprach Grudda. Ihre Worte markierten »einen Meilenstein in der Aufarbeitung des NS-Unrechts in Deutschland«, ließ der Staatsanwalt danach verlauten. Der Nebenklageanwalt sagte, es sei zum ersten Mal von einem deutschen Gericht gesagt worden, dass man als SS-Mann für alle Morde in Auschwitz mitverantwortlich sei. Tatsächlich war der Schuldspruch eine Botschaft: Als SS-Angehöriger in Auschwitz war jeder zum Täter geworden. »Das gesamte Lager glich einer Fabrik, ausgerichtet darauf, Menschen zu töten«, sagte die Richterin. »In Auschwitz durfte man nicht mitmachen.«
Nach dem Prozess blieben viele Fragen offen. Kann die Justiz ein Verbrechen nach mehr als 70 Jahren noch sühnen? Kann ein Gericht jemanden angemessen bestrafen für die Beteiligung am Holocaust? Und was ist mit den Opfern? Kann ihnen überhaupt Gerechtigkeit widerfahren? Und vor allem die eine Frage, die über dem gesamten Verfahren schwebte: Warum hat es mehr als sieben Jahrzehnte gedauert, bis dem Angeklagten der Prozess gemacht wurde?
Die Antwort ist so einfach wie erschreckend. Weil die Gesellschaft, der Staat, die Justiz es nicht wollten. Nicht nach dem Krieg, nicht in der Adenauer-Republik, nicht in der sozialdemokratischen Brandt-Schmidt-Ära, nicht unter Helmut Kohl (der gerne – missverständlich genug – von der »Gnade der späten Geburt« sprach), auch nicht in der rot-grünen Regierungszeit (in der immerhin zahlreiche Kommissionen damit beauftragt wurden, die NS-Verstrickungen und personellen Kontinuitäten in den Ministerien zu untersuchen) noch in den zurückliegenden Jahren der Großen Koalition von CDU und SPD.
Nun möchte man die Regierungen für das mangelnde Interesse der zuständigen Staatsanwaltschaften und Ermittlungsbehörden sowie die Verschleppung der Verfahren nicht unmittelbar verantwortlich machen – aber es fehlte durchweg an gesetzgeberischen Signalen. Es fehlte das Wollen, NS-Täter, als diese noch keine Greise waren, vor Gericht zu bringen.
»Dieses Verfahren ist das mindeste, was eine Gesellschaft tun kann, um den Überlebenden des Holocaust ein wenig Gerechtigkeit widerfahren zu lassen«, sagte Anke Grudda, die Vorsitzende der Schwurgerichtskammer. Und: Der Fall sei eine Warnung vor den Versäumnissen der Justiz an die heutige Generation.
So blieb das Strafverfahren gegen Reinhold Hanning vor allem ein Symbol. Es erinnerte daran, dass eine Beteiligung an staatlichen Massenmorden nicht ungesühnt bleiben darf, selbst wenn dies erst nach vielen Jahrzehnten geschieht.
Der SS-Wachmann Hanning wurde verurteilt – mit 94 Jahren. Ähnliche Verfahren wird es kaum noch geben. Auch das macht Reinhold Hanning zur Symbolfigur: Der Schuldspruch gegen ihn erinnert daran, dass Zigtausende von Mördern, Schreibtischtätern und Mordgehilfen davonkamen.
Man darf festhalten: Die Aufarbeitung des NS-Unrechts durch die deutsche Nachkriegsjustiz ist eine Geschichte der Verspätung und Verzögerung. Diese Justiz hat gründlich versagt. Ein beschämendes Versagen.
Einige Zahlen: In den drei Westzonen und der Bundesrepublik wurde von 1945 bis 2005 insgesamt gegen 172 294 Personen wegen strafbarer Handlungen während der NS-Zeit ermittelt. Das ist angesichts der monströsen Verbrechen und der Zahl der daran beteiligten Menschen nur ein winziger Teil. Das hatte seine Gründe: Im Justizapparat saßen anfangs dieselben Leute wie einst in der NS-Zeit. Viele machten sich nur mit Widerwillen an die Arbeit. Auch politisch wurde auf eine Beendigung der Verfahren gedrängt, dafür sorgten schon zahllose Amnestiegesetze.
Zu Anklagen kam es letztlich gerade einmal in 16 740 Fällen – und nur 14 693 Angeklagte mussten sich tatsächlich vor Gericht verantworten. Verurteilt wurden schließlich gerade einmal 6656 Personen, für 5184 Angeklagte endete das Verfahren mit Freispruch, oft aus Mangel an Beweisen. Die meisten Verurteilungen – rund 60 Prozent – endeten mit geringen Haftstrafen von bis zu einem Jahr. Ganze neun Prozent aller Haftstrafen waren höher als fünf Jahre.
Vor dem Hintergrund eines der größten Verbrechen in der Menschheitsgeschichte eine skandalöse, eine empörende Bilanz.
Von der Justiz hatten die NS-Täter nichts zu befürchten. Und von der Gesellschaft – von Bekannten, Nachbarn, Arbeitgebern? »Herrgott, irgendwann muss doch auch mal Schluss sein«, so lautete das einverständliche Credo, ganz im Sinne des Nachkriegskanzlers Adenauer, der im Oktober 1952 den SPD-Abgeordneten Fritz Erler im Bundestag mahnte, man soll mit der »Nazi-Riecherei« doch endlich Schluss machen, denn »wenn wir damit anfangen, weiß man nicht, wo es aufhört«. Damit artikulierte Adenauer den Zeitgeist der Nachkriegsjahre. Die meisten Deutschen wollten von Kriegsverbrechern, von Verbrechen gegen die Menschlichkeit, von den NS-Verstrickungen, von schuldhaften Täter-Biographien, kurz: vom moralischen und zivilisatorischen Desaster Hitler-Deutschlands nichts mehr wissen.
Tatsache ist: In der Adenauer-Republik standen vom ersten Tag an die Zeichen auf Amnestie und Integration der...