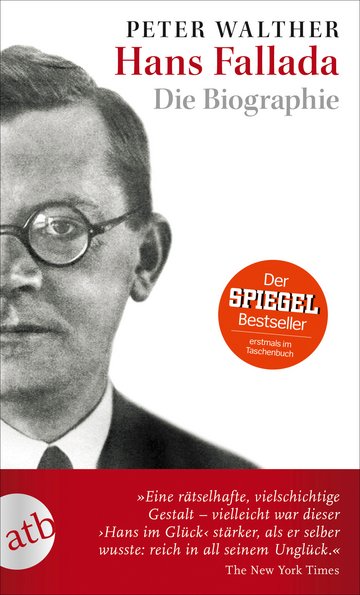Erstes Kapitel
Die Freude war groß – Glied in einer unendlichen Kette – Glückskind und Pechvogel
»Am 21. Juli 1893 früh 8 Uhr wurde unser Rudolf geboren. Er war ein sehr kräftiges Kind, 6¾ Pf. schwer. Die Freude war groß, auch bei den Schwestern. Nur kam«, so fasst die Mutter ihre Sicht auf die Lebensbahn des Sohnes im Abstand eines halben Jahrhunderts zusammen, »leider viel Ungemach hinterher.« Der Greifswalder Landrichter Ditzen und seine Frau zeigen noch am gleichen Tag »ergebenst« die »glückliche Geburt eines gesunden Knaben« an. Getauft wird das Kind zwei Monate später.
Es ist der ersehnte erste Sohn nach zwei Mädchen, zweieinhalb Jahre danach folgt ein Bruder, damit ist die Familie komplett. Bei allen Unfällen, Bedrohungen und Rückschlägen, die er in seiner Kindheit und Jugend erleiden wird – in diese Familie hineingeboren zu sein macht Rudolf Ditzen zum Glückskind. Die Eltern führen eine harmonische Ehe, die berufliche Stellung des Vaters sichert ihnen ein materiell sorgenfreies Dasein.
Wilhelm Ditzen, Rudolfs Vater, ist ein bemerkenswerter Mann: Er vereint Intelligenz, Pflichtgefühl, Sparsamkeit und Genauigkeit bis zur Pedanterie mit Güte, Ironie, Bescheidenheit und einem breiten Interesse für die musischen Seiten des Lebens. Seine Vorfahren stammen aus Ostfriesland, zumeist waren es Verwaltungsbeamte, Juristen, Ärzte, Apotheker oder Geistliche. Bis ins späte 16. Jahrhundert lässt sich die Familie zurückverfolgen.
Auf einem Foto, das den pensionierten Reichsgerichtsrat Wilhelm Ditzen 1936, im Jahr vor seinem Tod, am Flügel in der Leipziger Wohnung zeigt, sieht man ein Gemälde mit dem um 1590 geborenen Ahnen Johann Volrad Kettler. Über die eigene familiäre Herkunft zu reden und die mitunter verwickelten Verwandtschaftsverhältnisse zu erörtern gehört auch bei Ditzens zum bürgerlichen Selbstverständnis. Rudolf Ditzen hat als Hans Fallada eine Szene beschrieben, wie sie sich so oder ähnlich zugetragen haben könnte:
Vater hatte einen starken Familiensinn und erwartete von uns Kindern, daß wir uns genau wie er mit Interesse, Ehrfurcht und Liebe der Kenntnis unserer weitverzweigten Verwandtschaft widmeten […].
Fragte Vater mich: »Hans, wie sind wir mit Tante Wike verwandt?«, so erinnerte ich mich vielleicht dunkel, von Tante Wike gehört zu haben, mußte aber bekennen, ohne jede Ahnung zu sein, wie es mit der Berechtigung ihrer Tanten-Ansprüche aussah.
Dann sagte Vater geduldig: »Hans, paß doch nur einmal auf! Es ist ganz einfach. Deine Urgroßmutter und Tante Wikes Mutter waren rechte Kusinen, es ist also ein Verwandtschaftsverhältnis welchen Grades? Aufsteigend oder absteigend?«
Ich verharrte in muffigem Schweigen. Hätte Vater mich aber gefragt: »Du erinnerst dich doch an die Tante mit den weißen Handschuhen?«, so hätte ich sofort Bescheid gewußt.
Die genealogischen Spitzfindigkeiten des Vaters werden den Sohn in seiner Kindheit wenig berührt haben. Doch Jahrzehnte später schreibt er in einem Brief an seine Eltern: »Jetzt, wo ich selber Kinder habe, empfinde ich sehr, daß ich nur ein Glied in einer unendlichen Kette bin, und daß es gut ist, von dieser Kette zu wissen, Merkmale von ihr zu besitzen und eines Tages weitergeben zu können.« Ein Leben lang wird Rudolf von der Familie profitieren, von der Liebe, Geduld und Großzügigkeit der Eltern, vom Altruismus seiner Tante Ada und dem Verständnis seiner Schwestern. In Zeiten, da es ihm gutgeht, kann er vieles davon zurückgeben, auch materiell. Er wird sich auf Reisen für die Spuren der Ahnen interessieren und widmet ihnen Porträts in seinen Büchern.
Zu den prägenden Vorfahren in der väterlichen Linie gehört Rudolfs Urgroßvater Cirk Stürenburg. Er amtiert in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Präsident der ostfriesischen Anwaltskammer, gründet ein landwirtschaftliches Mustergut, ist mit Robert Schumann und Felix Mendelssohn Bartholdy befreundet, leitet in Aurich den Bach-Verein und veröffentlicht nach über zwanzig Jahren Recherche 1857 ein ostfriesisches Wörterbuch. Für die Verbindung prosaischer Interessen mit künstlerischen Neigungen, wie sie auch im Elternhaus von Rudolf gelebt wird, gibt er das Urbild ab. Als konservativer Jurist hat Cirk Stürenburg gegen viele Widerstände und trotz konträrer politischer Grundhaltungen einen Schriftsteller unterstützt, der sich als Parteigänger der 1848er Revolution hervortat – auch politische Liberalität gehört zum Erbteil der Familie.
Sein Schwiegersohn wird Wilhelm Albert Ditzen, der die Geburt seines Enkels Rudolf noch erlebt. Er stirbt wenige Monate später, im Dezember 1893. Rudolfs ältere Schwester hat noch Erinnerungen an den Großvater, den damals 82-jährigen hannöverschen Kronanwalt im Ruhestand: Er war »ungeheuer rücksichtsvoll und schrecklich höflich, er stand immer auf, wenn ein weibliches Wesen sein Zimmer betrat, das erstreckte sich sogar auf seine vierjährige Enkelin, so daß ihm mein Besuch schließlich sehr anstrengend wurde, da ich immer wieder zu ihm hinein wollte«.
Von der Seite der Mutter stammen Rudolfs Vorfahren aus dem Vorharz, aus Clausthal und Celle. »Im mütterlichen Stamm«, heißt es bei Fallada, überwiegt »das Pastörliche«, aber es gab auch Juristen und Beamte. Sie wirkten in den Städten der weiteren Region, in Hannover, Uelzen und Lüneburg. Es wird Wert auf eine gute Ausbildung der Kinder und auf Familiensinn gelegt. Bei den Frauen, deren Talente und Bildungsinteressen in der Familienüberlieferung bezeugt sind, ist das hohe Alter auffällig: Rudolfs Ururgroßmutter stirbt 1865 im für damalige Verhältnisse biblischen Alter von 93 Jahren, seine Urgroßmutter wird 92, die Großmutter 93, die Mutter Rudolfs, die zwei Weltkriege erlebt, 83 und seine Schwester Elisabeth 90.
Großmutter Charlotte, die sechs Jahre nach Goethes Tod geboren wird – das Aufregendste ist für sie ihre erste Begegnung mit der Eisenbahn – und die im hohen Alter noch die ersten schriftstellerischen Erfolge ihres Enkels erlebt, heiratet 1862 Emil Lorenz. Die Entscheidung für den Geistlichen hat auch Konsequenzen für ihre äußere Erscheinung: »Mit meinem künftigen Beruf als Pastorin fand ich es nicht passend, eine hohe Frisur, à la Wahnsinn, zu tragen; den glatten Scheitel fand ich richtiger, so habe ich ihn behalten bis auf den heutigen Tag.« Zehn Jahre später stirbt Lorenz an Tuberkulose. Er ist zuletzt Gefängnispfarrer in Lüneburg und kümmert sich hier mit großer Hingabe um die Belange der Gefangenen. »Nach seinem Tode baten [die Insassen] einmütig […], von ihren Ersparnissen soviel hergeben zu dürfen, daß ihr lieber Pastor ein schönes Kreuz auf sein Grab bekäme. Diese Bitte, die weitergegeben wurde an die Regierung, ist nicht bewilligt worden. Es hieß, ›Ersparnisse der Sträflinge dürfen nicht in dieser Weise verwendet werden‹.« Fallada hat seinem Großvater in »Jeder stirbt für sich allein« als »Pastor Lorenz« ein literarisches Denkmal gesetzt, mit dem das Andenken an den aufopferungsvollen Pfarrer wohl länger lebendig bleibt, als es das (nie aufgestellte) Kreuz vermocht hätte.
Die Witwe des Pastors, die eine bescheidene Pension bezieht, ist nun, 1872, allein mit fünf Kindern. Elisabeth, Rudolfs spätere Mutter, wird vierjährig in den Haushalt von Verwandten nach Uelzen gegeben, wo sie in materiell gesicherten, aber seelisch bedrückenden Verhältnissen aufwächst. Einmal im Jahr darf sie für 14 Tage ihre Mutter und die Geschwister besuchen. Tante und Onkel haben zwar keine eigenen Kinder, dafür aber eigene Vorstellungen von Erziehung, die auf Strenge, Ordnung und Ruhe hinauslaufen. Andere Kinder im Haus sind nicht erwünscht. Elisabeth fällt es schwer, Freundinnen zu gewinnen, sie sucht Trost in der Literatur: »Kein Buch war sicher vor mir. Meine Pflegeeltern ahnten nicht, wie eifrig ich in all den Klassikern las, die als ältere Bücher auf den Schreibtisch in meinem Zimmer verbannt waren […]. Ich durfte offiziell nur in Jugendbüchern, z.B. Töchteralben lesen. Wenn etwas von Verloben oder Heiraten vorkam, wurde mir das Buch streng verboten.«
Fallada hat es sich nicht entgehen lassen, die wenig freudvolle Kindheit seiner Mutter mit großer Lust an der Übertreibung auszumalen. Er nimmt dabei vor allem an dem Pflegevater, der in dem Buch »Damals bei uns daheim« als skurriler Advokat »Onkel Pfeifer« auftritt, literarisch Rache: »Er war nachtragend auf Jahre hinaus – verachtete aber andere, die nicht sofort bereit waren, zu vergeben und zu vergessen. Er hielt die Italiener für ein entartetes Volk, weil sie Tomaten aßen und noch dazu roh! Er war der Ansicht, daß Stiefeletten mit Gummizug die einzige anständige Fußbekleidung für Herren seien – kurz, er war ein Menschenalter hindurch nicht aus seinem verschollenen Städtchen herausgekommen. Er war der Nabel der Welt, leider ein zur Entzündung neigender Nabel.«
Wie viel auch der Fabulierlust Falladas geschuldet sein mag, einfach wird das Leben seiner Mutter bei den Pflegeeltern nicht gewesen sein, wie aus ihren eigenen Aufzeichnungen hervorgeht: »An zwei besondere Ereignisse an Weihnachtsabenden erinnere ich mich noch. Es wurde mir mitgeteilt, daß die Rute verbrannt werden sollte, da ich ein artiges Kind gewesen wäre. Sie wurde hinter dem Spiegel hervorgeholt, ich mußte mit Onkel und Tante einen Ringelreihen tanzen, wobei irgendetwas Selbstverfaßtes von ihnen gesungen wurde, und dann wurde die Rute in den Ofen gesteckt und verbrannt. Ich weiß, daß ich mich schrecklich schämte.«
Manchmal finden die Zieheltern, Elisabeth ginge die Treppe »zu schnell und geräuschvoll....