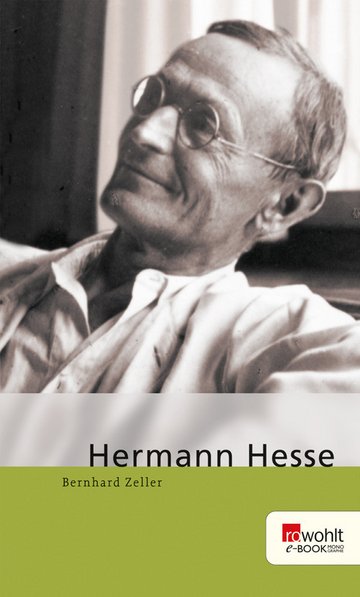Jugendkrisen
Am 1. Februar 1890 brachte Marie Hesse ihren Sohn nach Göppingen. Es geschah dies zum Teil aus erzieherischen Gründen, denn ich war damals ein schwieriger und sehr unartiger Sohn geworden, und die Eltern wurden nicht mehr fertig mit mir. Außerdem aber war es notwendig, daß ich möglichst gut auf das «Landexamen» vorbereitet werde. Diese staatliche Prüfung, die jedes Jahr im Sommer für das ganze Land Württemberg stattfand, war sehr wichtig, denn wer sie bestand, der bekam eine Freistelle in einem der theologischen «Seminare», und konnte als Stipendiat studieren. Diese Laufbahn war auch für mich vorgesehen. Nun gab es einige Schulen im Lande, an denen die Vorbereitung auf diese Prüfung ganz speziell betrieben wurde, und auf eine von diesen Schulen wurde ich also geschickt. Es war die Lateinschule in Göppingen, wo seit Jahren der alte Rektor Bauer als Einpauker fürs Landexamen wirkte, im ganzen Lande berühmt und Jahr für Jahr von einem Rudel strebsamer Schüler umgeben, die ihm aus allen Landesteilen zugesandt wurden.[35]
Bis zum Sommer 1891 gehörte Hermann Hesse zu den Göppinger Landexamenskandidaten. Er wohnte bei einer strengen Pensionsmutter und fand wenig Gefallen an der etwas nüchternen Industriestadt. Fruchtbar und auch menschlich wichtig wurde der Unterricht bei dem alten Rektor Bauer. Mit Anhänglichkeit und Verehrung erinnert er sich seiner noch nach Jahrzehnten. Der sonderbare, beinah abschreckend aussehende, mit zahllosen Originalitäten und Schrulligkeiten ausgestattete alte Mann, der hinter seinen schmalen grünlichen Augengläsern hervor so lauernd und schwermütig blickte, der unsre enge, überfüllte Schulstube beständig aus seiner langen Pfeife vollrauchte, wurde mir für einige Zeit zum Führer, zum Vorbild, zum Richter, zum verehrten Halbgott. – Ich, der ich stets ein empfindlicher und auch kritischer Schüler gewesen war und mich gegen jede Abhängigkeit und Untertanenschaft bis aufs Blut zu wehren pflegte, war von diesem geheimnisvollen Alten eingefangen und völlig bezaubert worden, einfach dadurch, daß er an die höchsten Strebungen und Ideale in mir appellierte, daß er meine Unreife, meine Unarten, meine Minderwertigkeiten scheinbar gar nicht sah, daß er das Höchste in mir voraussetzte und die höchste Leistung als selbstverständlich betrachtete. – Oft sprach er lateinisch mit mir, meinen Namen übersetzte er mit Chattus. – Das Eigene und Seltene an diesem Lehrer aber war seine Fähigkeit, nicht bloß die Geistigeren unter seinen Schülern herauszuspüren und ihrem Idealismus Nahrung und Halt zu geben, sondern auch dem Alter seiner Schüler, ihrer Knabenhaftigkeit, ihrer Spielsucht gerecht zu werden. Denn Bauer war nicht bloß ein verehrter Sokrates, er war außerdem auch ein geschickter und höchst origineller Schulmeister, der es verstand, seinen dreizehnjährigen Buben die Schule immer wieder schmackhaft zu machen.[36]
In seinen Briefen, lebendigen, anschaulichen Jungenbriefen an die Eltern, erzählt er gern von diesem Lehrer, bei dem nicht nur Schillers «Wallenstein» ins Lateinische übersetzt werden musste – was wirklich unsre Klasse stark in Anspruch nimmt[37] –, sondern der auch den großen Zapfenstreich auf die Schulbänke trommeln lehrte und dabei Hesse zum Kapellmeister ernannte. Auch in lustigen Versen schildert Hesse den Eltern seinen Göppinger Schulalltag, und einmal berichtet er von einem kleinen Drama, das er verfasst hat und das zu Hause vielleicht aufgeführt werden könnte. Ein Weihnachtsabend ist der Titel dieses «Trauerspiels in einem Aufzug», einer rührseligen Geschichte, in der ein Bettelkind überraschend am Weihnachtsabend zu einer mutterlosen Familie kommt.
Die kurze Periode der Göppinger Schulzeit, der einzigen, in der Hesse ein guter Schüler war und seine Lehrer verehrte, fand mit dem Landexamen im Juli 1891 den erhofften Erfolg. Hesse bestand die gefürchtete Prüfung und rückte, wie so mancher der Gundert’schen Ahnen vor ihm, zusammen mit rund drei Dutzend Seminaristen im Herbst 1891 in das Seminar in Maulbronn ein.
Die niederen evangelisch-theologischen Seminare sind württembergische Bildungseinrichtungen von besonderer Eigenart und innerhalb Deutschlands fast ohne Vergleich, mögen sich auch mancherlei Parallelen etwa mit Schulpforta, der einstigen Meißner Fürstenschule, oder verschiedenen katholischen Seminaren nachweisen lassen. Ihre Geschichte führt zurück bis in das Zeitalter der Reformation. Unmittelbar nach dem Augsburger Religionsfrieden begann Herzog Christoph, einer der bedeutendsten württembergischen Fürsten, das Kirchen- und Schulwesen seines Landes zu ordnen und neu aufzubauen. Die folgenreichste Neuerung war die Verwandlung der vierzehn württembergischen Mannsklöster in protestantische Klosterschulen, an denen vierzehn- bis achtzehnjährige Knaben des Landes als Stipendiaten zum Studium der evangelischen Theologie vorbereitet werden sollten. Diese Neuordnung, 1565 durch Landtagsbeschluss feierlich bestätigt, trug ungeahnte Früchte, denn der Einfluss der Seminare, deren Zahl zwar im Laufe der Jahrhunderte auf vier Internate in Maulbronn und Schöntal, Blaubeuren und Urach zusammenschmolz, reicht weit über den der anderen Schulen Württembergs hinaus. Die besondere, in manchem zweifellos sehr einseitige Prägung der württembergischen Geistigkeit ist zu einem wesentlichen Teil durch die Seminare und dann durch das evangelisch-theologische Stift an der Universität Tübingen, das die Seminaristen aufnahm, erfolgt. Johannes Kepler wie Hölderlin, Eduard Mörike und Robert Mayer waren gleich so vielen anderen, die als Dichter oder Gelehrte Namen und Ruhm erzielten, durch die Seminare gegangen. Die meisten Theologen, eine Großzahl von Lehrern und Professoren, aber auch von höheren Beamten des Herzogtums und späteren Königreichs Württemberg haben entscheidende Jahre ihrer Schulzeit, die damals wie heute den vier Oberklassen eines humanistischen Gymnasiums entsprach, in der Seminargemeinschaft verbracht. Die streng gesiebte, ausschließlich nach intellektueller Leistung getroffene Auswahl der Schüler, die Stärke der Tradition, die nicht zuletzt in einer einfachen, fast klösterlichen Lebensform zum Ausdruck kam, das humanistisch-protestantische Bildungsideal, getragen von einem sehr gediegenen altsprachlichen Unterricht, gaben den Internaten ihren eigentümlichen Charakter, ihre bildende Kraft und ihre Autorität. Zweifellos war diese Ausbildung in vielen Punkten einseitig und starr, aber im Festhalten am Überlieferten, im Verzicht auf voreilige Experimente lag ein wichtiges Stück ihrer Macht.
Hermann Hesse, der bis zu seinem vierzehnten Lebensjahr das Basler Bürgerrecht besaß und für die Aufnahme ins Seminar erst das württembergische Bürgerrecht erwerben musste, war nicht viel länger als ein halbes Jahr Seminarist in Maulbronn. Aber das Erleben dieser kurzen Zeit genügte, um seinem literarischen Schaffen einen besonders charakteristischen Zug, vielleicht darf man sagen, seine Maulbronner Note zu geben. Eine erste, recht kritische, in manchen Details sehr wahrheitsgetreue Schilderung seines Seminar- und Jugenderlebens enthält die 1906 erschienene Erzählung Unterm Rad. In Begegnungen mit Vergangenem schreibt Hesse darüber sehr viel später einmal: Es war die Zeit, die ich, auch da noch unsicher genug und weit vom wirklichen Verstehen und Überwundenhaben entfernt, zehn Jahre später in der Erzählung «Unterm Rad» zum erstenmal zu beschwören versucht habe. In der Geschichte und Gestalt des kleinen Hans Giebenrath, zu dem als Mit- und Gegenspieler sein Freund Heilner gehört, wollte ich die Krise jener Entwicklungsjahre darstellen und mich von der Erinnerung an sie befreien, und um bei diesem Versuche das, was mir an Überlegenheit und Reife fehlte, zu ersetzen, spielte ich ein wenig den Ankläger und Kritiker jenen Mächten gegenüber, denen Giebenrath erliegt und denen einst ich selber beinahe erlegen wäre: der Schule, der Theologie, der Tradition und Autorität. Wie gesagt, es war ein verfrühtes Unternehmen, auf das ich mich mit meinem Schülerroman einließ, und es ist dann auch nur sehr teilweise geglückt. – Aber […] das Buch enthielt doch ein Stück wirklich erlebten und erlittenen Lebens […].[38]
Schönheit und Zauber des alten Zisterzienserklosters Maulbronn, einer der herrlichsten und besterhaltenen Klosteranlagen Deutschlands, werden in manchen Skizzen und Erzählungen der späteren Jahre beschworen. Als Mariabronn lebt das Kloster in Narziß und Goldmund wieder auf, und ohne das Urbild Maulbronn ist das Kastalien des Glasperlenspiels nicht denkbar. Es ist mir manchmal ein sympathischer Gedanke, daß inmitten des zerrütteten Deutschland und Europa da und dort solche Zellen des Aufbaus bestehen wie die Klosterschulen, schreibt Hesse nach dem Zweiten Weltkrieg an den Maulbronner Ephorus, den Leiter des Seminars.
Wer das Kloster besuchen will, tritt durch ein malerisches, die hohe Mauer öffnendes Tor auf einen weiten und sehr stillen Platz. Ein Brunnen läuft dort, und es stehen alte ernste Bäume da und zu beiden Seiten alte steinerne und feste Häuser und im Hintergrunde die Stirnseite der Hauptkirche mit einer spätromanischen Vorhalle, Paradies genannt, von einer graziösen, entzückenden Schönheit ohnegleichen. Auf dem mächtigen Dach der Kirche reitet ein nadelspitzes, humoristisches Türmchen, von dem man nicht begreift, wie es eine Glocke tragen soll. Der unversehrte Kreuzgang, selber ein schönes Werk, enthält...