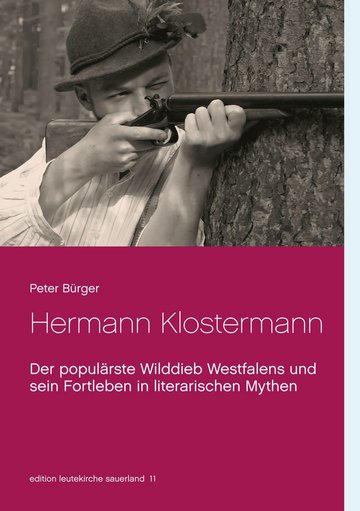1.
DER BIOGRAPHISCHE RAHMEN
UND GRUNDZÜGE DER ÜBERLIEFERUNG
Der Polizeibeamte Hans-Dieter Hibbeln aus Detmold hat schon vor zweieinhalb Jahrzehnten in einem heimatgeschichtlichen Beitrag die „Legende Klostermann“ auf haltbare Fakten hin abgeklopft und dann begleitend zu seinen Forschungen über den Wilddieb eine Internetseite www.wildschuetz-klostermann.de ins Netz gestellt. Sein Klostermann-Archiv12 birgt den wohl umfangreichsten Materialfundus zum Thema. Die hier vorgelegte Untersuchung hat Hans-Dieter Hibbeln hinsichtlich der herangezogenen Quellen kritisch durchgesehen und durch zahlreiche ergänzende Forschungshinweise gefördert.
Schon die zeitgenössischen Texte, insbesondere Zeitungsmeldungen der 1860er Jahre, enthalten stellenweise grobe Falschangaben und reine Spekulationen. Eigentlich bis in die Gegenwart hinein werden in Veröffentlichungen mündlich überlieferte Erzählvarianten wie historische Forschungserkenntnisse vermittelt. Die Zahl der selbstbewusst präsentierten „Wahrheiten“, bei denen das „Hörensagen“ schon als hinreichender Beleg gilt, ist Legion. Gleichwohl lässt sich anhand von Archivbeständen ein biographischer Rahmen rekonstruieren, der nach menschlichem Ermessen als zuverlässig gelten kann13:
Der Wildschütz, mit vollem Namen hieß er Friedrich Heinrich Hermann Klostermann, wurde am 28. März 1839 in Retzin (Regierungsbezirk Potsdam) geboren und am 17. April getauft.14 Seine Eltern waren Caroline geb. Gebert (1815-1858) und der Müller Johannes Joachim Heinrich Klostermann (1807-1843), beide seit 1833 verheiratet. Die protestantischen Eheleute hatten noch eine Tochter und einen weiteren Sohn. Hermann war keine fünf Jahre alt, als sein Vater am 28.11.1843 in Retzin starb.
Die verwitwete Mutter heiratet schon im Folgejahr den Förstersohn Ernst Friedrich Wilhelm Dalchow (geb. 1822), mit dem zusammen sie noch einem Sohn und einer Tochter das Leben schenken wird. Stiefvater Dalchow steht zunächst in preußischem Militärdienst, bewirbt sich aber ein Jahrzehnt später dringlich von „Pritzwalk b. Kuhbier“ aus als Stellungsloser beim Regierungspräsidenten in Minden. Im November 1855 kann er vorläufig eine Forstaufseherstelle in Hakenberg (Lichtenau) antreten.15 Hermann ist beim Familienumzug aus dem Brandenburgischen ins Eggegebirge 16 Jahre alt. Von 1857 bis 1859 muss er zwei Jahre darauf in Minden beim 15. Infanterieregiment seiner Militärpflicht nachkommen. Hier treffen den jungen Rekruten zahllose Strafmaßnahmen, weil er der militärisch geforderten Unterordnung nicht Folge zu leisten vermag. Während dieser Militärzeit stirbt am 26.7.1858 Hermanns leibliche Mutter in Hakenberg und wird auf dem „Hackenberger Friedhof genannt Kaetorf“ beerdigt.16 Nur sechs Monate darauf heiratet der Stiefvater am 30.1.1859 die Förstertochter Friederica Dorothea Regina Gossow aus Dahl (Kreis Paderborn). Am 1. April desselben Jahres tritt er eine neue Försterstelle in der Försterei Mittelwald (Scherfede) unweit von Hardehausen an17, die er bis zur Versetzung nach Rimbeck im Juli 1866 beibehält. Ob Hermann nach seiner Militärentlassung im Jahr 1859 noch einmal Familienanschluss bei Stiefvater und „Stiefmutter“ gefunden hat, bleibt offen. – Im „Westfälischen Volksblatt“ vom 21.11.1868 wird später mitgeteilt, der ungelernte Förster-Stiefsohn habe nach seiner Dienstzeit eine Weile versucht, im Bergischen mit seiner Hände Arbeit den Lebensunterhalt zu verdienen.18 – Seine „Jugendzeit“ hat Klostermann ganz sicher nicht im Forsthaus Mittelwald verlebt, wie in manchen Quellen behauptet wird!
Mit Blick auf das Folgende ist eine Mitteilung über die Hardehauser Jagd interessant, der zufolge diese schon um 1856 „auch von Wilddieben aus Kleinenberg, Westheim und Willebadessen stark heimgesucht“ worden ist.19 Später heißt es in einer Zeitungsmeldung: „Die Landleute sehen es übrigens gern, dass die wilden Schweine, Rehe und Hirsche, die ihre Felder arg heimsuchen, weggeschossen werden, gleichviel durch wen.“20
Ohne große Spekulationen kann man schon aus den äußeren Daten der Familiengeschichte auf eine schwierige Kindheit und Jugendzeit Hermann Klostermanns schließen. Drei Jahre nach seiner Militärzeit wird dieser am 14.7.1862 erstmalig wegen Wilderei im Forstbezirk Wünnenberg aktenkundig.21 Die amtliche Personenbeschreibung dazu lautet: „Klostermann hat eine Größe von 6-7 Fuß [1 Fuß = 30,48 cm!], ist schmächtig, hat eine feine Stimme, einen tänzelnden Gang, längliches Gesicht ohne Bart, hat eine doppelte Bekleidung: Kittel und grauen Rock. [...]. Führt ein Gewehr bei sich, dessen Kolben zum Abschrauben ist und den er gewöhnlich unterm Kittel, dagegen den Gewehrlauf offen trägt.“ (Ein späterer Steckbrief, der dem Amtsblatt im Regierungsbezirk Minden vom 14.2.1868 beigelegt war, enthält folgende Angaben zur Person: „Größe: 5 Fuß 6 Zoll; Statur: schlank; Haare: blond; Stirn: frei; Augen: blau; Nase: lang; Kinn: rund; Gesicht: oval; Gesichtsfarbe: gesund. Besondere Kennzeichen: Schußwunde am linken Arme.“22)
Im Oktober 1862 wird der Stiefsohn des Ex-Militärs und Försters Dalchow beim Gericht in Büren in Untersuchungshaft genommen.23 In einem Schreiben vom Juli 1865 an die Regierung in Minden heißt es drei Jahre darauf: „Ferner treibt eine Bande Wilddiebe, an deren Spitze der eben aus dem Zuchthause entlassene Klostermann steht, sein [sic!] Unwesen in den hiesigen Forsten. [...] Diesen in Banden ausgeführten Wildereien kann aber durch die vorhandenen etatmäßigen Schutzbeamten nicht in genügender Weise entgegengetreten werden.“ (Text: →III.5) Am 29.11.1865 meldet der Waldecksche Anzeiger: „Klostermann hat in dem Briloner Revier und auch in anderen Jagdbezirken schon manche [s]chikanöse Wilddieberei ausgeführt, und den preußischen Behörden, die denselben schon lange (aber vergeblich) verfolgen ließen, würde sehr damit gedient sein, diesen sauberen Herrn [...] überbracht zu sehen.“24 Man schreibt dem Wildschützen, der scheinbar unentwegt seine Aufenthaltsorte wechselt, schließlich gar ein „Jagdrevier“ in der Größe von 80 bis 90 Tausend Morgen zu.25
Zwischen dem 1. Oktober 1867 bis zu seiner Gefangennahme in der Nacht vom 13. auf den 14. Juni 1868 in Brilon hält Klostermann die ganze Region in Atem. Erst in diesen Zeitraum, den wir uns im nächsten Abschnitt noch genauer anschauen werden, fallen drei Ereignisse, bei denen Menschenblut fließt und ein Wilderergenosse sogar stirbt. Zuletzt hatte Klostermann noch einen Wohnsitz in Westheim gehabt, doch jetzt ist er wirklich ein Gejagter, der mit der bürgerlichen Gesellschaft ganz gebrochen hat und sich ständig verstecken muss. Zur Ergreifung des „Staatsfeindes“ – ‚tot oder lebend‘ – wird eine hohe Prämie ausgeschrieben und später sogar Militär26 eingesetzt: „Es war zur Ehrensache für die Behörden geworden, den Wilderer, der ihrer so frech spottete, festzunehmen. Die Telegramme flogen hin und her, die Gendarmerie war Tag und Nacht auf den Beinen, die Wälder wurden unermüdlich durchstreift und die Leitung der Verfolgung einem besonders gewandten Polizeiinspector Namens Schnepel übergeben, der eigens zu diesem Zwecke nach Westheim gesendet wurde.“27 Die Paderborner Schwurgerichtsverhandlung vom 12.-14. November 1868 endet dann für den angeklagten Wilddieb, der noch keine 30 Jahre alt ist, mit einer Verurteilung zu acht Jahren Zuchthaus. Der adelige Gegenspieler, Oberförster Joseph Freiherr von Wrede, beklagt sich am 19.11.1868 gegenüber der Königlichen Regierung in Minden über den Ausgang des Verfahrens: Klostermann „hat sich ein geneigtes Ansehen und Respect durch sein Treiben und Leben bei der hiesigen Bevölkerung zu verschaffen gewußt, und umsomehr ist zu beklagen, daß in Anbetracht seiner vielen Vergehen u. groben Verbrechen, ihm nur eine so milde Strafe zuerkannt ist, die er bei der Publication des Urtheils nur mit einem Lächeln aufnahm. Ich habe der ganzen Verhandlung als Zeuge beiwohnen müssen und nur die Genugtung mitgenommen, daß meine vielen Bemühungen zur Entdeckung des Thäters nicht erfolglos geblieben sind.“28
Die Prozessberichterstattung des Paderborner „Westfälischen Volksblattes“ vom 21.11.1868 lässt erkennen, dass der „Mythos Klostermann“ zu diesem Zeitpunkt schon längst ausgereift war: „Einige Jahre hielt er sich theils in Westheim theils in der Umgegend auf, bis er im Jahre 1864 einem festen Domicil gänzlich entsagte, sich fast ausschließlich in Bergen und Wäldern umhertrieb und nur selten in die menschliche Gesellschaft zurückkehrte. Seinen Unterhalt erwarb er sich leicht, zumal er die Sympathien der ländlichen Bevölkerung der ganzen Gegend besaß. Eine Menge von Geschichten waren über ihn im Umlauf,...