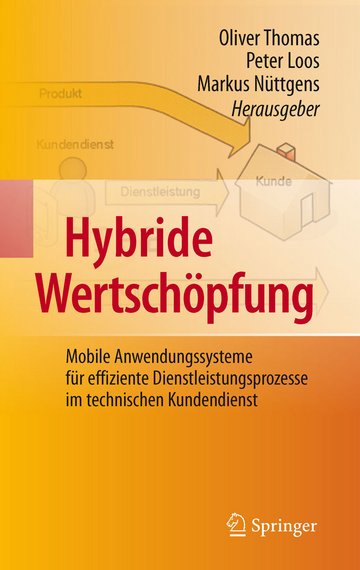| Geleitwort | 5 |
| Vorwort | 7 |
| Inhaltsübersicht | 11 |
| Inhaltsverzeichnis | 13 |
| Teil I: Grundlagen und Anwendungsszenarien | 20 |
| PIPE – Hybride Wertschöpfung im MaschinenundAnlagenbau | 21 |
| 1 Einleitung | 21 |
| 1.1 Problemstellung | 21 |
| 1.2 Zielsetzung und Lösungsansatz | 22 |
| 1.3 Konkretisierung der Anwendungsdomäne | 23 |
| 2 Kundendienstprozesse der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik | 23 |
| 2.1 Herausforderungen aus Sicht der Hersteller | 23 |
| 2.2 Herausforderungen aus Sicht der SHK-Betriebe | 24 |
| 2.3 Herausforderungen aus Sicht der SHK- Kundendiensttechnike | 24 |
| 3 Hybride Wertschöpfung als Innovationsmotor | 25 |
| 3.1 Strategischer Lösungsansatz | 25 |
| 3.2 Struktur des hybriden Produkts | 27 |
| 3.3 Informationstechnische Konzeption | 28 |
| 3.4 Implementierung und Umsetzung | 30 |
| 3.4.1 Funktionen | 31 |
| 3.4.2 Baugruppen | 31 |
| 3.4.3 Serviceprozesse | 32 |
| 4 Anwendungsszenario „Warmwasser wird nicht warm“ | 33 |
| 4.1 Generelle Beschreibung | 33 |
| 4.2 Vorbereitung der Störungsbehebung | 34 |
| 4.3 Durchführung der Störungsbehebung | 37 |
| 4.3.1 Identifikation des defekten Geräts | 38 |
| 4.3.2 Diagnose und Behebung der Störung | 38 |
| 4.4 Nachbereitung der Störungsbehebung | 39 |
| 5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick | 39 |
| 6 Literatur | 40 |
| Technische Kundendienstleistungen: Einordnung, Charakterisierung und Klassifikation | 42 |
| 1 Entwicklung des Begriffsfeldes um den technischen Kundendienst | 42 |
| 2 Merkmale des Kundendienstes | 45 |
| 2.1 Wesensmerkmale des Kundendienstes | 46 |
| 2.1.1 Eigenständigkeit | 47 |
| 2.1.2 Absatzform | 47 |
| 2.1.3 Güterarten | 47 |
| 2.1.4 Immaterialität im Leistungsvollzug | 48 |
| 2.1.5 Interaktionsintensität | 48 |
| 2.1.6 Bedeutung für den Kunden | 48 |
| 2.1.7 Freiwilligkeit | 49 |
| 2.1.8 Abrechnung | 49 |
| 2.2 Leistungsinhalt des Kundendienstes | 50 |
| 2.2.1 Leistungstyp | 50 |
| 2.2.2 Funktionen | 50 |
| 2.2.3 Notwendige Einsatzfaktoren | 51 |
| 2.2.4 Leistungsbezug | 51 |
| 2.2.5 Standardisierung | 51 |
| 2.3 Leistungsumfeld des Kundendienstes | 51 |
| 2.3.1 Zeitpunkt | 51 |
| 2.3.2 Mobilität und Ort | 52 |
| 2.3.3 Ausführende | 52 |
| 2.3.4 Nachfrageart | 53 |
| 2.3.5 Planung | 53 |
| 2.4 Zusammenfassende Definition | 53 |
| 3 Der TKD im Spektrum produktbegleitender Dienstleistungen | 54 |
| 4 Terminologie der Instandhaltung | 56 |
| 5 Literatur | 57 |
| Arbeitsformen und IT-Unterstützung im technischen Kundendienst: eine empirische Untersuchung am Beispiel der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnikbranche | 60 |
| 1 Eingrenzung der Untersuchungsdomäne | 60 |
| 1.1 Der Wirtschaftszweig Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik als idealtypischer Vertreter der technischen Gebrauchsgüterbranche | 61 |
| 1.2 Der TKD als zentraler Integrationspunkt in der Wertschöpfungskette | 61 |
| 2 Empirische Untersuchung im technischen Kundendienst der SHK-Branche | 63 |
| 2.1 Untersuchungsplanung und -ablauf | 64 |
| 2.2 Zusammensetzung der Stichprobe und Bedarf nach einer Lösung zur hybriden Wertschöpfung | 65 |
| 2.3 Demografische Faktoren | 66 |
| 2.4 Hilfsmittel im TKD | 67 |
| 2.4.1 Nutzungshäufigkeit von und Zufriedenheit mit bestehenden Hilfsmitteln als Einflussfaktoren auf die Nutzungsabsicht | 69 |
| 2.4.2 Identifizierung charakteristischer Nutzerprofile | 70 |
| 2.5 IT-Affinität | 71 |
| 2.5.1 Persönliche IT-Nutzung | 71 |
| 2.5.2 Betriebliche IT-Nutzung | 72 |
| 2.6 Ökonomische TKD-Aspekte | 74 |
| 3 Zusammenfassung | 75 |
| 4 Literatur | 75 |
| Teil II: Methoden und Modelle | 77 |
| Konstruktion und Anwendung einer Entwicklungsmethodik für Product-Service Systems | 78 |
| 1 Einleitung | 78 |
| 2 Stand der Forschung | 80 |
| 2.1 Produktentwicklung | 80 |
| 2.2 Dienstleistungsentwicklung | 80 |
| 2.3 Integrierte Entwicklung von Sach- und Dienstleistungen | 81 |
| 3 Konstruktion einer Entwicklungsmethodik für Product-Service Systems | 82 |
| 3.1 Ordnungsrahmen der PSS-Entwicklungsmethodik | 82 |
| 3.2 Bestimmung der Kundenanforderungen | 84 |
| 3.3 Definition der PSS-Soll-Eigenschaften | 85 |
| 3.4 Synthese der Sach- und Dienstleistungsmerkmale | 86 |
| 3.5 Analyse der PSS-Ist-Eigenschaften | 87 |
| 3.6 Produktion des PSS | 87 |
| 4 Anwendung der Entwicklungsmethodik für Product-Service Systems | 88 |
| 4.1 Einführung in die Anwendungssituation | 88 |
| 4.2 Bestimmung der Kundenanforderungen | 89 |
| 4.3 Definition der PSS-Soll-Eigenschaften | 90 |
| 4.4 Synthese der Sach- und Dienstleistungsmerkmale | 91 |
| 4.5 Analyse der PSS-Ist-Eigenschaften | 93 |
| 4.6 Produktion des PSS | 93 |
| 5 Konklusion und Ausblick | 94 |
| 6 Literatur | 95 |
| Vorgehensmodelle des Product-Service Systems Engineering | 99 |
| 1 Einleitung | 99 |
| 2 Neue Anforderungen an Vorgehensmodelle durch Product-Service Systems | 101 |
| 3 Vorgehen zum Vergleich von Product-Service-Systems-Engineering-Vorgehensmodellen | 103 |
| 4 Selektion von Vorgehensmodellen des Product-Service Systems Engineering | 104 |
| 4.1 Vorgehensmodell nach Abdalla | 104 |
| 4.2 Vorgehensmodell nach Aurich et al. | 106 |
| 4.3 Vorgehensmodell nach Botta, Steinbach und Weber | 108 |
| 4.4 Vorgehensmodell nach Lindahl et al. | 109 |
| 4.5 Vorgehensmodell nach McAloone et al. | 111 |
| 4.6 Vorgehensmodell nach Mont | 113 |
| 4.7 Vorgehensmodell nach Müller und Schmidt-Kretschmer | 116 |
| 4.8 Vorgehensmodell nach Rexfelt und Af Ornäs | 118 |
| 4.9 Vorgehensmodell nach Schenk, Ryll und Schady | 120 |
| 4.10 Vorgehensmodell nach Spath und Demuß | 122 |
| 4.11 Vorgehensmodell nach Thomas, Walter und Loos | 123 |
| 5 Vergleich und Bewertung der Vorgehensmodelle des Product-Service Systems Engineering | 125 |
| 5.1 Konstruktionsprozess | 125 |
| 5.1.1 Herkunft | 125 |
| 5.1.2 Erkenntnisweg | 125 |
| 5.1.3 Interaktionsgrad | 126 |
| 5.1.4 Bewertung | 126 |
| 5.2 Konstruktionsergebnis | 127 |
| 5.2.1 Repräsentation | 127 |
| 5.2.2 Hierarchisierung | 127 |
| 5.2.3 Realisierungsgrad | 127 |
| 5.2.4 Bewertung | 128 |
| 5.3 PSS-Entwicklungsziel | 129 |
| 5.3.1 Kundennutzen | 129 |
| 5.3.2 Leistungsangebot | 130 |
| 5.3.3 Komplexitätsgrad | 131 |
| 5.3.4 Intensitätsgrad | 131 |
| 5.3.5 Individualitätsgrad | 132 |
| 5.3.6 Realisierungsform | 132 |
| 5.3.7 Erbringungsdauer | 133 |
| 5.3.8 Lebenszyklus | 133 |
| 5.3.9 Bewertung | 133 |
| 5.4 PSSE-unspezifische Vorgehensmerkmale | 135 |
| 5.4.1 Anwendungsdomäne | 135 |
| 5.4.2 Prozesssteuerung | 135 |
| 5.4.3 Phasenablauf | 135 |
| 5.4.4 Phasenanordnung | 136 |
| 5.4.5 Methodenempfehlung | 136 |
| 5.4.6 Sprachempfehlung | 137 |
| 5.4.7 Ergebnisdokumentation | 137 |
| 5.4.8 Bewertung | 138 |
| 5.5 PSSE-spezifische Vorgehensmerkmale | 139 |
| 5.5.1 Leistungserstellungsprozess | 139 |
| 5.5.2 Kundenintegration | 139 |
| 5.5.3 Zeitliche Dynamik | 139 |
| 5.5.4 Bewertung | 140 |
| 6 Zusammenfassung und Ausblick | 141 |
| 7 Literatur | 141 |
| Lebenszyklusmodelle hybrider Wertschöpfung: Modellimplikationen und Fallstudie | 147 |
| 1 Einleitung | 147 |
| 2 Klassische Produktlebenszyklusmodelle | 148 |
| 3 Produktlebenszyklusmodelle und hybride Wertschöpfung | 151 |
| 3.1 Anwendungsfall und Modellimplikationen | 151 |
| 3.2 Erweitertes Produktlebenszyklusmodell zur hybriden Wertschöpfung | 152 |
| 3.3 Prototypische Implementierung | 156 |
| 4 Ausblick | 157 |
| 5 Literatur | 158 |
| Modellierung technischer Serviceprozesse im Kontext hybrider Wertschöpfung | 161 |
| 1 Einleitung | 161 |
| 2 Grundlagen der Dienstleistungsmodellierung | 162 |
| 2.1 State-of-the-Art der Dienstleistungsmodellierung | 162 |
| 2.1.1 Prozessdimension | 163 |
| 2.1.2 Potenzialdimension | 164 |
| 2.1.3 Ergebnisdimension | 164 |
| 2.1.4 Zusammenfassung | 165 |
| 2.2 Anforderungen an Modellierungsmethoden zur hybridenWertschöpfung | 165 |
| 2.2.1 Notwendige Anforderungen | 165 |
| 2.2.2 Hinreichende Anforderungen | 166 |
| 2.2.3 Untersuchung der Eignung der gängigen Modellierungssprachen für die Serviceprozessmodellierung | 167 |
| 2.2.4 Auswertung der Ergebnisse der theoretischen Untersuchung | 167 |
| 2.2.5 Zusammenfassung der Ergebnisse der Untersuchung | 169 |
| 3 Serviceprozessmodellierung – Anwendungsfall | 170 |
| 3.1 Identifikation der Serviceprozesse im TKD – Inhaltliche Dimension | 170 |
| 3.2 Identifikation der Serviceprozesse im TKD – Komplexitätsdimension | 171 |
| 3.3 Identifikation der Serviceprozesse im TKD – Bearbeitungsdimension | 172 |
| 3.4 Vorgehensmodell – Serviceprozessmodellierung | 173 |
| 3.5 Modelle als Bestandteile von technischenServiceinformationen | 174 |
| 3.6 Modellierungsbeispiel Fehlerbild F.0 | 180 |
| 3.7 Fazit | 187 |
| 4 Literatur | 187 |
| Teil III: Werkzeuge und IT-Unterstützung | 193 |
| Integrierte Informationssysteme zur Unterstützung technischer Kundendienstleistungen | 194 |
| 1 Einleitung | 194 |
| 2 Informationssysteme zur Unterstützung des TKD | 195 |
| 2.1 Anwendungsgebiete | 195 |
| 2.1.1 Wissensmanagementsysteme | 196 |
| 2.1.2 Instandhaltungsplanungs- und -steuerungssysteme | 197 |
| 2.1.3 Condition-Monitoring-Systeme/Überwachungssysteme | 199 |
| 2.1.4 Diagnosesysteme | 200 |
| 2.1.5 Parametrisierungssysteme | 200 |
| 2.2 Architektur | 201 |
| 2.3 Klassifikation | 202 |
| 2.3.1 Aufgabenunterstützung | 202 |
| 2.3.2 Organisation | 203 |
| 2.3.3 Eigenschaften und Funktionen | 204 |
| 2.3.4 Technologie | 207 |
| 3 Evaluation der Klassifikation | 211 |
| 3.1 Sanitär- Heizungs- und Klimatechnik | 212 |
| 3.1.1 Bosch Thermotechnik GmbH | 212 |
| 3.1.2 Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG | 213 |
| 3.1.3 Viessmann Werke GmbH & Co. KG | 214 |
| 3.1.4 PIPE-Projekt | 216 |
| 3.2 Windkraftanlagen | 217 |
| 3.2.1 Enercon GmbH | 218 |
| 3.2.2 General Electric Wind Energy | 219 |
| 3.2.3 REpower Systems AG | 220 |
| 3.2.4 Nordex AG | 220 |
| 3.2.5 Winergy AG | 221 |
| 3.2.6 softEnergy GmbH | 221 |
| 3.2.7 SSB-Antriebstechnik GmbH & Co. KG | 222 |
| 3.2.8 DMT GmbH | 223 |
| 3.2.9 Ingenieurbüro Bernd Höring | 223 |
| 3.2.10 Wind 7 AG | 224 |
| 3.3 Automobilbau | 224 |
| 3.3.1 BMW AG (OSS) | 225 |
| 3.3.2 BMW AG (Teleservice) | 226 |
| 3.3.3 Daimler AG | 226 |
| 3.3.4 Continental Automotive GmbH | 227 |
| 3.3.5 Softing AG | 228 |
| 3.4 Branchenübergreifend | 229 |
| 3.4.1 EMPRISE Consulting Düsseldorf GmbH | 229 |
| 3.4.2 ARROW Engineering Oy | 230 |
| 3.4.3 Paradigma Software GmbH | 231 |
| 3.4.4 sLAB Gesellschaft für Informationssysteme mbH & Co. KG | 231 |
| 3.4.5 FAG Industrial Services GmbH | 232 |
| 3.4.6 PRÜFTECHNIK Dieter Busch AG | 233 |
| 3.4.7 ACIDA GmbH | 233 |
| 4 Auswertung und Ergebnisse der Evaluation | 234 |
| 4.1 Systeme der Sanitär-, Heizungs- und Klimabranche | 234 |
| 4.2 Systeme der Windkraftbranche | 236 |
| 4.3 Systeme der Automobilbranche | 237 |
| 4.4 Branchenübergreifende Systeme | 239 |
| 4.5 Zusammenfassung der eingesetzten Systeme | 239 |
| 5 Fazit und Ausblick | 244 |
| 6 Literatur | 245 |
| Das INTERACTIVE-Serviceportal | 251 |
| 1 Wissen als strategische Unternehmensressource | 251 |
| 2 Begriffsdefinition Portal | 253 |
| 3 Gesamtarchitektur des INTERACTIVE-Serviceportals | 255 |
| 4 Softwarekomponenten des Serviceportals | 259 |
| 4.1 Serviceinformation Modeler | 259 |
| 4.2 Serviceportal Server | 263 |
| 4.3 Mobiler Service Client | 264 |
| 4.4 Fallstudie | 267 |
| 5 Nutzenpotenziale | 269 |
| 6 Ausblick | 270 |
| 7 Literatur | 271 |
| Teil IV: Evaluation und Entwicklungsbegleitende Normung | 274 |
| Evaluation des PIPE-Informationssystems | 275 |
| 1 Einleitung | 275 |
| 2 Untersuchungskonzept | 276 |
| 2.1 Grundlagen zu Experimenten als Evaluationsmethode | 276 |
| 2.2 Evaluationskonzept | 278 |
| 3 Durchführung | 280 |
| 4 Auswertung | 281 |
| 4.1 Auswertung statistischer Angaben | 281 |
| 4.1.1 EDV-Qualifikation | 281 |
| 4.1.2 Tätigkeitsfelder und Ausbildung | 282 |
| 4.1.3 Produkterfahrung Vaillant | 282 |
| 4.2 Auswertung Prozesserhebungsbogen | 283 |
| 4.2.1 Auswertung F.0 | 284 |
| 4.2.2 Auswertung F.28 | 284 |
| 4.3 Auswertung der Bewertungsangaben nach Bearbeitungsarten | 285 |
| 4.3.1 Auswertung Bewertungsangaben Bearbeitungsart 1 | 285 |
| 4.3.2 Auswertung Bewertungsangaben Bearbeitungsart 2 | 286 |
| 4.3.3 Auswertung Bewertungsangaben Bearbeitungsart 3 | 289 |
| 4.4 Hypothesentest | 296 |
| 5 Zusammenfassung und Ausblick | 298 |
| 6 Literatur | 298 |
| Entwicklungsbegleitende Normung im Kontext hybrider Wertschöpfung | 299 |
| 1 Entwicklungsbegleitende Normung des DIN e.V. | 299 |
| 1.1 Dienstleistung der Entwicklungsbegleitenden Normung | 299 |
| 1.2 Methodik der Entwicklungsbegleitenden Normung | 301 |
| 1.3 Normen und Spezifikationen | 301 |
| 1.4 Zusammenspiel von Normung und Innovation | 302 |
| 2 Hybride Wertschöpfung | 303 |
| 3 Standardisierungsvorhaben im Umfeld der hybriden Wertschöpfung | 305 |
| 3.1 Projektübergreifende Standardisierung zur hybriden Wertschöpfung | 305 |
| 3.2 Standardisierung zur hybriden Wertschöpfung in PIPE | 306 |
| 4 Ausblick | 309 |
| 5 Literatur | 309 |
| Teil V: Kooperationen und Geschäftsmodelle | 311 |
| IT-gestützte Wertschöpfungspartnerschaften zur Integration von Produktion und Dienstleistung im Maschinen- und Anlagenbau | 312 |
| 1 Einleitung | 312 |
| 2 Stand der Forschung | 313 |
| 3 Integrierte Wertschöpfungspartnerschaften im Maschinen- und Anlagenbau | 314 |
| 3.1 Status Quo von Wertschöpfungspartnerschaften in mehrstufigen Vertriebswegen | 314 |
| 3.2 Herausforderung: mangelnde Integration von Produzenten und Kundendiensten | 316 |
| 3.3 Strategischer Lösungsansatz | 317 |
| 3.4 Architektur des Informationssystems | 319 |
| 4 Anwendungsszenario | 321 |
| 5 Evaluation des Anwendungsszenarios | 322 |
| 6 Zusammenfassung und Ausblick | 325 |
| 7 Literatur | 325 |
| Geschäftsmodelle hybrider Wertschöpfung im Maschinen- und Anlagenbau mit PIPE | 327 |
| 1 Ausgangslage | 327 |
| 2 Präzisierung des Begriffsverständnisses | 331 |
| 2.1 Grundlegende Charakterisierung | 331 |
| 2.2 Kooperations- und Geschäftsmodelle | 332 |
| 2.3 Akteure in den Kooperationsszenarien und Geschäftsmodelle in PIPE | 334 |
| 2.3.1 Hersteller | 334 |
| 2.3.2 Werkskundendienst Hersteller | 335 |
| 2.3.3 Kunde | 335 |
| 2.3.4 PIPE-Serviceportal | 335 |
| 2.3.5 SHK-Betrieb Büro | 336 |
| 2.3.6 Servicetechniker SHK-Betrieb | 336 |
| 2.3.7 Großhandel | 336 |
| 2.3.8 PIPE-Dienstleister | 337 |
| 3 Kooperationsszenarien in PIPE | 337 |
| 3.1 Werkskundendienst | 337 |
| 3.2 Keine Partnerschaft mit Hersteller | 338 |
| 3.3 Lose Partnerschaft mit Hersteller | 339 |
| 3.4 Schwache Partnerschaft mit Hersteller | 340 |
| 3.5 Mittelstarke Partnerschaft mit Hersteller | 341 |
| 3.6 Starke Partnerschaft mit Hersteller | 342 |
| 3.7 Intensive Partnerschaft mit Hersteller | 343 |
| 4 Differenzierte Geschäftsmodelle in PIPE | 344 |
| 5 Zusammenfassung und Ausblick | 349 |
| 6 Literatur | 350 |
| IT-Unterstützung von Instandhaltungs-, Wartungs- und Reparaturprozessen: die Perspektive der SHK-Betriebe | 352 |
| 1 Die Position des Fachverbands Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik Hessen | 352 |
| 2 Situationen des SHK-Kundendienstes | 353 |
| 2.1 Aus der Sicht der Unternehmensführung | 353 |
| 2.2 Aus der Sicht des Kundendienstmonteurs | 355 |
| 3 Anforderungen an IT-Lösungen | 355 |
| 3.1 Korrelationen durch die Geschäftstätigkeit | 356 |
| 3.2 Praxistauglichkeit | 357 |
| 3.3 Eignung der Kundendienstmonteure für IT-Lösungen | 359 |
| 4 Fazit | 359 |
| Autorenverzeichnis | 361 |