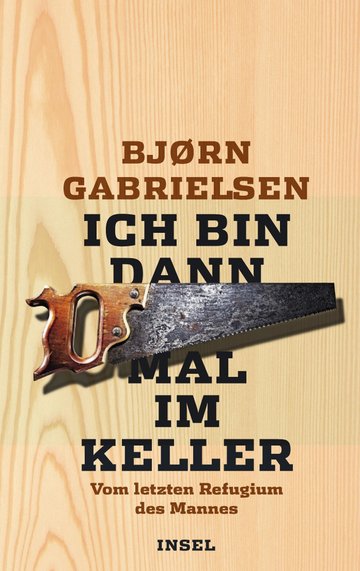EINE WELT AUS KELLERN
Manchmal kommt es mir so vor, als glichen sich die Architektur und der Wohnungsbau weltweit an. Die Welt wird sich überall ähnlicher, und man hat das Gefühl, dass die kleinen, noch immer bestehenden kulturellen Unterschiede zwischen einzelnen Ländern nur noch da sind, um uns Unannehmlichkeiten zu bereiten. Und doch können Touristen überall auf der Welt CNN empfangen und Heineken kaufen.Dass die ärmsten Menschen jetzt überall auf der Welt in identischen Klamotten herumlaufen, ist nur ein Beispiel dafür, wie gleich alles geworden ist. Die Armen in Peru, Tibet und auf den Philippinen tragen T-Shirts aus Baumwolle, Shorts und in China produzierte Sandalen.
Die Uniformierung ist weit fortgeschritten. In Europa gibt es mit dem Euro eine gemeinsame Währungseinheit. Die Lebensmittelauswahl wird von Land zu Land ähnlicher, sogar die Ausstattung der Spielplätze scheint normiert zu sein – geliefert von denselben Produzenten, die die gleichen standardisierten Anforderungen erfüllen.
Einige Dinge zeigen jedoch eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit gegenüber globalisierten Trends. Auch nach bald einhundert Jahren präsumtiver popkultureller Dominanz aus den USA sehen die meisten Menschen im Bruchteil einer Sekunde, dass der Eurovision Song Contest nicht aus Amerika kommt. Niemand würde einen französischen Film für eine Hollywood-Produktion halten. Komiker werden so gut wie nie außerhalb ihrer eigenen Landesgrenzen berühmt – verständlicherweise, da Humor sehr abhängig ist von Sprache und lokalen Referenzen. Merkwürdiger ist schon, dass der Ruhm von Weltumseglern oder Bergsteigern meist exakt an den Grenzen des Landes endet, in denen diese Heroen geboren wurden. Welcher Norweger kennt schwedische oder finnische Weltrekordhalter?
Beim Keller hat die Globalisierung haltgemacht. Kein Keller gleicht dem anderen. Sie unterscheiden sich entsprechend lokaler Bedingungen. Es ist schwer, vorherzusagen, welche lokalen Besonderheiten überleben werden und welche nicht. Kaffeegewohnheiten waren bis vor zwanzig Jahren regional sehr unterschiedlich und so eng mit den jeweiligen sozialen Gegebenheiten verbunden, dass sie unveränderlich schienen. Dennoch hat eine spezielle amerikanische Version der italienischen Kaffeetradition sich inzwischen weltweit als enorm durchsetzungsfähig erwiesen, erst insbesondere in den Großstädten.
Kaffeebars geben ihren Kunden ein Gefühl von schneller Belohnung und Erfrischung, und die Barbesitzer machen ordentlich Umsatz. Diese kleinen Läden konnten sich deshalb durchsetzen, weil viele kleine Geschäfte leer standen, nachdem am Stadtrand die Einkaufszentren errichtet wurden.
Mit den Kellern verhält es sich weniger stromlinienförmig. Vorläufig sind Keller häufig nicht einfach nur unaufgeräumt, durcheinander und chaotisch – sondern auch noch sehr von den lokalen Bedingungen abhängig, weltweit.
KELLERUNORDNUNG ODER WIE DIE WOHNUNGEN DER JAPANER AUFGERÄUMT BLEIBEN
Das traditionelle japanische Heim entwickelte sich über Jahrhunderte in extremer Isolation und Fremdenangst, vermittelte aber dennoch ein beinahe universelles Signal. So hell und leicht! So hübsch und geschmackvoll!
Japanisches Interieur ist in dem Sinn einzigartig, dass es sogar Männer anspricht, die sonst auf Dekor und Möblierung pfeifen. Wer will nicht so wohnen wie ein Samurai?
Die Frage ist eigentlich, wie eine derartige Ordnung bei den Japanern möglich ist. Dabei ist es ganz einfach: Wie die meisten anderen ordentlichen Menschen bewahren die Japaner ihre Unordnung im Keller auf.
Traditionelle japanische Häuser haben einen ›Keller‹ für Betten und Bettzeug – Oshiire. Einen Schrank mit Schiebetüren, der in dem Raum steht, in dem man nachts schläft und tagsüber wohnt. Morgens werden die Futon-Matratzen zusammengerollt und verstaut, abends werden sie wieder ausgerollt. In traditionellen japanischen Gasthäusern erlebt man, wie die Betten auf magische Weise aus dem Raum verschwinden, während man frühstückt, entfernt von unsichtbaren Angestellten oder Elfen, die noch nie jemand auf frischer Tat ertappt hat.
Auf den ersten Blick sieht es aus, als sei die Oshiire-Lösung die Antwort auf jede Krise am Wohnungsmarkt. Auf diese Weise lässt sich die Anzahl der Räume verdoppeln, und auf den Futons liegt es sich mindestens ebenso angenehm wie auf den schweren und platzfordernden Varianten. Aber auf eine Kultur, die relativ großen Wert auf Individualismus legt, und in der der Tagesrhythmus der einzelnen Familienmitglieder sehr unterschiedlich ist, ist diese Methode des Aufräumens kaum zu übertragen.
Es gab eine Zeit, in der alle Personen eines Haushalts ungefähr gleichzeitig aufstanden und zu Bett gingen und niemand daran zweifelte, wer der Herr im Haus war. Damals ließen sich Wohnraum und Schlafzimmer kombinieren. Bis in die achtziger Jahre des 20. Jahrhunderts wurden in Oslo in so mancher Wohnung am Abend im Wohnzimmer die Schlafsofas ausgezogen, weil es nicht genug Zimmer zum Schlafen gab. Heute tun das nur noch frisch angekommene Migranten und der ein oder andere Student.
12 Lokale Materialien Eine traditionelle japanische Hütte mit Strohdach als Außenkeller. Iya-Tal, Shikoku, Japan. Innen sieht es genauso aus wie in den Kellern der restlichen Welt, mit Benzinkanistern und Werkzeug, das an den Wänden hängt.
In dem Buch Japanese Homes and Their Surroundings, das 1886 in den USA erschien – wenige Jahre nachdem Japan sich dem Rest der Welt geöffnet hatte –, beschreibt der Autor, dass wohlhabendere Japaner neben dem Oshiire auf ihrem Grundstück eine Art freistehenden Keller besaßen, in dem alles Überflüssige verstaut wurde. Vermutlich orientierten sich viele Japaner an der herrschenden Ästhetik und dem internalisierten, kulturbedingten Wunsch nach leeren Flächen und Ordnung.
Regelmäßig lesen wir Reportagen über die Häuser und Wohnungen von Familien, die eine von Architekten entworfene »japanische Lösung« gefunden haben – mit einer unendlichen Zahl von eingebauten Schränken und maßgeschneiderten Aufbewahrungsmöglichkeiten unter den Treppen. Allerdings ist dies – wie so häufig – gleichermaßen eine Parodie wie eine Weiterführung des japanischen Baustils.
Vielleicht tröstet es ja, wenn wir uns sagen, es sei eine gute japanische Tradition, geerbte alte Möbel und andere Erinnerungsstücke in der Garage zu lagern.
DER BOOTSSCHUPPEN ODER DER NORWEGISCHE KELLER, DER ABSOLUT KEINE HÜTTE IST. UND DARÜBER WIRD NICHT DISKUTIERT!
Sie stehen vor jedem Haus an der norwegischen Küste, sie sind klein und nicht immer gut erhalten. Die Rede ist von Bootsschuppen. So mancher ausländische Besucher wird vermuten, dass es sich hier um Unterkünfte für die Armen der Gemeinde handelt.
Die Norweger haben viele Begriffe für ein »Haus am Wasser«. Als »Naust«, also »Bootsschuppen« oder »Bootshaus«, wird traditionell der Ort bezeichnet, an dem ein Boot samt dazugehöriger Ausrüstung gelagert wird, es handelt sich um einen Schuppen ohne gezimmerten Boden, bei dem ein Giebel zum Meer weist. In Kongerikerne Danmarks og Norges samt hertugdømmerne Slesvigs og Holsteins Historie indtil vore Tider (›Die Geschichte der Königreiche Dänemark und Norwegen sowie der Herzogtümer Schleswig und Holstein bis in unsere Zeit‹) aus dem Jahr 1777 wird ein »Bootsschuppen« von Ludvig Albrecht Gebhardi und Wilhelm Ernst Christiani beschrieben:
»König Eystein I. errichtete bei Trondheim ein Bootshaus, in dem alle königlichen Schiffe untergebracht werden konnten, aber im Jahr 1156 wurde es in Schutt und Asche gelegt und kein neues gebaut. Bei diesem Bootshaus oder wie man es jetzt nennt, diesem Nøste, handelte es sich um ein umschlossenes Dach auf dem Land, unter welchem man bei Beginn des Frostes die aus dem Meer gezogenen Schiffe unterstellte und so vor Schnee und Regen bewahrte.«
13 Dies könnte eine Hütte sein Man könnte sie renovieren und hübsch herrichten. Man könnte. Ich sage nicht, dass es nicht getan wurde. Ich sage nur, dass es getan werden könnte. Heuschober und Bootsschuppen mit herbstlicher Birke am Ufer des Sandvinsvatnet, Jordal, Odda, Hardanger, Hordaland.
Als »rorbu« oder Fischerhütte wird die Saisonwohnung der Fischer bezeichnet, die an der Møre-Küste und weiter nördlich arbeiten. Das »fjæremannshus«, also das sogenannte »Haus der Ebbe-Männer« war die Wohnstatt der Bauern aus Nordhorrland, die in der Fischsaison zur Küste zogen.
Diese Unterschiede sind nicht ganz unwesentlich, da es in Norwegen immer wieder zu enormer Frustration und wütenden schriftlichen Auseinandersetzungen über die Frage kommt, ob diese Gebäude zum Übernachten geeignet sind oder nicht.
Die Fischerhütte – das bisher eine Art maritime Arbeitsbaracke ohne nennenswerten Komfort war – avanciert derzeit zur Übernachtungsalternative für exklusive Urlaube. Der »Bootsschuppen« hingegen wurde traditionell nicht als Unterkunft für Menschen genutzt, und sein Besitzer bekommt selten die Erlaubnis, daran etwas zu ändern. Es war ein gefundenes Fressen für die norwegische Presse, als die damalige Fischereiministerin Helga Pedersen 2009 Freunde in ihrem Bootshaus übernachten ließ und damit einen Skandal auslöste. Nur wenige norwegische Häuser liegen so nah am Meer und dem Wasser wie Bootshäuser. Und in dem Maße, wie in Norwegen die...