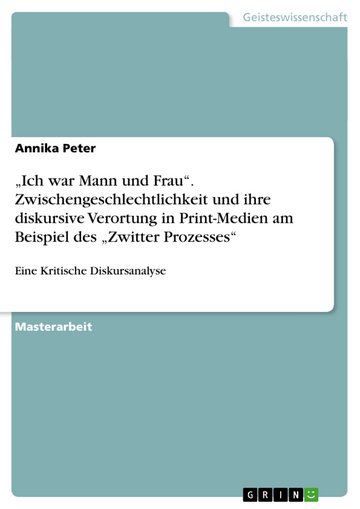„Ich war Mann und Frau“. Der Buchtitel von Christiane Völlings 2010 erschienener Erzählung ihrer Version einer intersexuellen Lebensrealität mag in manchen gesellschaftlichen und auch akademischen Kontexten Verwirrung stiften. Mann und Frau zugleich? In einem System, dass auf der Trennung von Geschlechtern in genau zwei Kategorien, nämlich weiblich und männlich, beruht, scheint weder die Vorstellungsmöglichkeit noch der Platz für Menschen zu sein, die eine Position als weder das eine oder das andere, ein sowohl als auch oder ein „dazwischen“ beziehen. Die unmittelbare Frage, die sich daran anschließen lässt ist diese: Wie kommt es, dass, obwohl uns in Gesellschaft und häufig auch der in Wissenschaft vermittelt wird, dass es nur zwei streng voneinander getrennte Geschlechter gibt, es dennoch einen (nicht geringen) Teil von Menschen gibt, die sich in dieses Schema nicht einordnen können oder wollen?
Es ist genau diese Uneindeutigkeit, die verwischte Grenze zwischen den Geschlechtern, die eine kritische Hinterfragung dessen provozieren, was Menschen für „natürlich“ und „normal“ halten; eine Hinterfragung der Schemata, an denen sich Individuen in ihrem Leben orientieren. Menschen, die sich nicht eindeutig in das Schema weiblich/männlich einpassen lassen, erzeugen nicht nur Verwirrung, Unsicherheit, sondern auch wissenschaftliches Interesse, indem sie eine herrschende Geschlechterordnung stören. Die Einteilung in ein System, dass nur Mann und Frau kennt, hat eine lange und gewaltsame Geschichte, die von Ab- und Ausgrenzungen gekennzeichnet ist und lässt sich, weder in Wissenschaft noch in Gesellschaft, einfach erklären und aufbrechen. Die Trennung der Geschlechter zwischen Mann und Frau beruht dabei oftmals auf biologisch beweisbaren „Tatsachen“, die in den Genen, Chromosomen, in den Hormonen oder etwa im Gehirn auf eine deutliche Unterscheidung der zwei Geschlechter belegen. Auch wenn einige biologische Diskurse durchaus auch auf die Gleichheit bzw. Ähnlichkeit zwischen den beiden Geschlechtern hinweisen[1], dominieren Diskurse, die die Unterschiede zwischen Männern und Frauen herausstellen. Das Interesse an der Erforschung von belegbaren Unterschieden zwischen Männern und Frauen ist dabei nicht nur rein wissenschaftlich begründet, sondern zeigt sich auch in der derzeitigen Konjunktur von „Wissensmagazinen“, die sich genau dieser Unterscheidung widmen, wie auch T. Maier in einer Studie zu Geschlecht in Wissensmagazinen herausstellt. Das „Wissen“ aus unterschiedlichen Forschungsfeldern, zumeist der Biologie und der Medizin, wird so einem breiten Publikum zugänglich gemacht. „Somit kommt den populärwissenschaftlichen Medien eine wichtige Rolle bei der Transformation von natur-, sozial-, und geisteswissenschaftlichem Wissen zu. Das betrifft auch das Wissen über Geschlecht“ (Maier 128). Die Rolle der Medien im Fokus von Geschlecht lässt sich also auch kritisch dahingehend hinterfragen, welches Wissen von Geschlecht jenseits zugänglich gemacht wird, welche Theorien und Ansätze Eingang in einen öffentlichen Diskurs finden, die zusammen mit wissenschaftlichen Forschungen das prägen, was wir uns unter Geschlecht vorstellen. Vorstellungen von Geschlecht beziehen sich dabei häufig auf eine Vorstellung dessen, was „natürlich“ ist- und in welchem Bereich könnte das Wissen über die „Natur des Menschen“ besser vermittelt werden als in den Wissenschaften?
Die sozialwissenschaftlich geprägten Gender Studies[2] etwa widmen sich aber genau jener Hinterfragung dessen, was als „normal“ und „natürlich“ angesehen wird und grenzen sich damit von einer essentialistischen und naturalisierenden Auffassung ab, die von einem faktischen Wissen ausgeht. In den Gender Studies steht ein konstruktivistischer Ansatz im Vordergrund, der vielmehr danach fragt wie und warum Formen von definitivem Wissen über Geschlecht entstehen konnten und wie sich diese Auffassungen in einem bestimmten Kulturkreis verorten lassen. U. Beers konzipiert Geschlecht beispielsweise als „Strukturkategorie“: Geschlecht gilt bei ihr als eine Ursache für soziale Ungleichheit, das heißt, die Kategorie Geschlecht fungiert in Gesellschaften als eine Art „Platzverweiser“, die sich über eine asymmetrische Machtverteilung äußert. Geschlecht ist dabei allerdings kontextabhängig zu betrachten und muss in Relation zu anderen Ungleichheitskategorien gesetzt werden, wie es beispielsweise auch beim Konzept der Intersektionalität[3] der Fall ist, um die strukturierenden Effekte soziale konstruierter Kategorien analysieren zu können. Die theoretische Basis dieses Konzept interpretiert nicht nur Geschlecht, sondern auch (konstruierte) Kategorien wie Ethnizität, Sexualität, Klasse, Religion, Alter usw., als strukturierende gesellschaftliche Elemente, die mit einer Zuweisung und Organisation spezifischer sozialer Ressourcen und Positionen verbunden sind. Eine solche Perspektive ermöglicht es, „[…] die historische Konstitution geschlechtsbezogener Herrschaftsverhältnisse zu analysieren“ (Kahlert 38). Neben der Fassung von Geschlecht als Strukturkategorie lässt sich im Diskurs der Geschlechterforschung auch eine Perspektive auf Geschlecht als „Prozesskategorie“ finden (vgl. Carol Hagemann-White z.B. 1988), die Geschlecht als soziale Konstruktion betrachtet und „[…] die in alltäglichen Interaktionen des doing gender[4] immer wieder als unreflektierter Zuschreibungsprozess reproduziert wird“ (ebd.). Gemein ist diesen Konzepten, dass sich sowohl die „Natürlichkeit“ als auch die „Wahrheit“ gesellschaftlicher Auffassungen über Geschlecht (und deren Verknüpfung mit anderen Ungleichheitskategorien) kritisch hinterfragen und somit auch Raum für eine Offenlegung der Herstellung von Zweigeschlechtlichkeit geben, der vor allem im Rahmen dieser Arbeit durch den Fokus auf Zwischengeschlechtlichkeit bedeutsam ist. Das Interesse einer Aufrechterhaltung eines Zwei-Geschlechter-Systems sowie die Fortführung eines Geschlechterdiskurses, der sich auf die Natürlichkeit der Kategorien Mann und Frau beruft, ist in diesem Kontext vor allem durch die Beibehaltung existierender Machtstrukturen begründet und geht mit der Negierung von anderen möglichen identitätsstiftenden Kategorien einher. Macht kann in diesem Kontext allerdings nicht losgelöst von Wissen betrachtet werden, sie sind, in Anknüpfung an Foucault, untrennbar miteinander verbunden. Interessant ist für diese Arbeit durch den spezifischen Fokus auf print-mediale Wissensdiskurse um Zwischengeschlechtlichkeit also, welches Wissen innerhalb des Diskurses der Zwischengeschlechtlichkeit vermittelt wird sowie die Art und Weise, in der Macht- und Hierarchieverhältnisse verifiziert oder aber auch durchbrochen werden.
Methodische Vorgehensweise und Gegenstand
Gegenstand dieser Arbeit sind sowohl soziale als auch wissenschaftliche Diskurse über Zwischengeschlechtlichkeit und ihr Aufgriff durch massenmediale Texte am Beispiel der Berichterstattung zu Christiane Völlings Schmerzensgeldprozess, der im Jahr 2007[5] begann. Basis für die Analyse der in der Presse aufgegriffenen Diskurse bildet Siegfried Jägers Kritische Diskursanalyse, die aufgrund ihrer praxisorientierten Vorgehensweise und der starken Betonung einer gesellschaftlichen Vermittlung von Diskursen und den in ihnen enthaltenen Positionen als geeignetes Werkzeug gesehen wird, um Zugang zu der öffentliche Verhandlung von Zwischengeschlechtlichkeit zu erlangen. Der Begriff „Zwischengeschlechtlichkeit“ wurde in dieser Arbeit bewusst gewählt, um ihn von dem medizinisch geprägten Begriff „Intersexualität“ abzugrenzen und somit gleichzeitig auf die starke gesellschaftliche Komponente des Begriffs zu verweisen, die geschlechtliche Uneindeutigkeit aus dem Zugriff der Medizin löst. Laut medizinischer Definition bezeichnet Zwischengeschlechtlichkeit, oder in diesem Fall konkret Intersexualität „ […] diejenigen Erscheinungsformen, bei denen biologische Geschlechtsmerkmale (v.a. Chromosomen, Gonaden, äußere und innere Geschlechtsmerkmale) voneinander abweichen“ (Richter-Appelt 241), also nicht als eindeutig männlich oder weiblich benannt werden können. Die Geschlechtszuweisung nach der Geburt eines zwischengeschlechtlichen Kindes erfolgt allerdings vornehmlich durch Beurteilung und Klassifizierung der äußeren, sprich: der unmittelbar sichtbaren Genitalien. Da jedoch nicht nur biologische „Tatsachen“, sondern vielmehr auch soziale Komponenten in die Betrachtung von Zwischengeschlechtlichkeit mit einfließen, wird hier von einer rein medizinisch-biologischen Betrachtung und die mit ihr einhergehenden Begrifflichkeiten abgesehen.
Die Erklärungsansätze für Zweigeschlechtlichkeit und Zwischengeschlechtlichkeit, welche dieser Arbeit zugrunde liegen, beziehen sich auf einen westlich-industriellen Kulturkreis. Dass sich in anderen Kulturräumen Geschlechtszugehörigkeit und Systeme geschlechtlicher Einordnung durchaus anders darstellen lassen, haben bereits ethnologische und anthropologische Forschungen[6] aufgezeigt. Die Möglichkeit divergierender kultureller Betrachtungsweisen soll in dieser Arbeit aber nicht von vorrangigem Interesse sein, da vor allem die Hinwendung zu einem deutschen Kulturraum (unter Rückbezug auf Forschungen aus dem U.S. amerikanischen Kontext) als zentraler (Wissens-) Rahmen für diese Arbeit ausschlaggebend ist. Zentral für die Betrachtung von Zwischengeschlechtlichkeit als auch für ein dimorphes Geschlechtersystem aus einer akademischen Perspektive heraus...