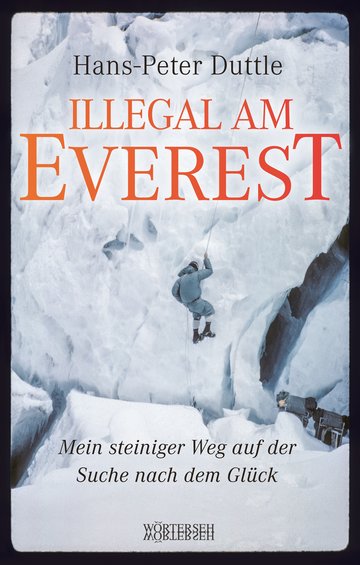Waren es glückliche Jahre, meine ersten Lebensjahre in Beirut? Sicher ist, dass sie die Weichen für ein Leben stellten, das mit einer großen Folgerichtigkeit verlief. Oft schien es mir, als ob es mich immer weiter abwärts, zumindest immer weiter ins Abseits führte. Doch jetzt, im Alter, kann ich sagen, dass ich mich nicht nur trotz, sondern auch wegen all der harten Zeiten glücklicher und gesünder fühle als je zuvor.
Kindheit in Beirut also.
Ich sehe mich auf meinem kleinen Dreirad sitzen; allein im Zimmer drehe ich meine Kreise. Es ist Abend. Gedämpfte Stimmen dringen an mein Ohr, das Klirren von Gläsern. Der große Leuchter im Salon wirft seinen Schein auf den Flur hinaus.
Vater empfängt wieder wichtige Gäste. Mutter wie immer an seiner Seite, die vollendete Gastgeberin. Und bald hat auch Rudi, mein kleiner Bruder, seinen glanzvollen Auftritt. Schon schlängelt er sich vergnügt zwischen den Beinen der Erwachsenen hindurch. Die fremden Menschen beginnen zu lachen. Alle sind entzückt über den charmanten Schlingel. Im Handumdrehen hebt sich die Stimmung in der steifen Gesellschaft. Ein Kinderspiel. Rudi kann das.
Ich stoße mein Dreirad auf den Balkon. Ruhe. Die reine Luft vom nahen Meer. Über mir ein Sternenhimmel, wie man ihn sich schöner nicht denken kann. In seiner geheimnisvollen Weite kann ich mich verlieren. Hier ist mir wohl.
Weißt du, wie viel Sternlein stehen
an dem blauen Himmelszelt?
Weißt du, wie viel Wolken gehen
weithin über alle Welt?
Gott der Herr hat sie gezählet,
dass ihm auch nicht eines fehlet
an der ganzen großen Zahl.
Vater und Mutter sind vor dem Krieg, 1937, nach Beirut gekommen. Er als Schweizer Vizekonsul, sie als seine Gattin.
Ich vermute, ihre Ehe war unglücklich von Anfang an. Für meinen Vater war es bereits die zweite. Als er in Buenos Aires für das Eidgenössische Departement des Äußeren tätig war, heiratete er eine ältere Schweizerin. Nach einem Jahr wurde die Ehe geschieden. In der Schweiz im Urlaub, lernte er meine Mutter kennen. Schnell wurde geheiratet, schnell wurde sie schwanger. Kein Diplomat ohne Diplomatengattin.
Meine Mutter war abenteuer- und reiselustig, eine Individualistin, intellektuell interessiert, feinfühlig. Sie hätte gern studiert, erzählte sie mir später oft, ihre Lehrer hätten sich dafür eingesetzt, aber ihr Vater, ein konservativer Bauernsohn und Postbeamter, war dagegen. Seine Tochter sollte heiraten und einen Haushalt führen. Sie besuchte dann die Handelsschule und arbeitete als Sekretärin. Daneben spielte sie Klavier, ging reiten und war im Schachklub. In meinem Vater sah sie wohl vor allem die Chance auf ein spannenderes Leben. Für ihn, den Konsul Duttle, war diese Frau ein Glücksfall. Sie kam gut an bei den Menschen und erfüllte ihre repräsentativen Pflichten tadellos.
Mein Vater war ein autoritärer Mann, streng konservativ, ehrgeizig. Er ging auf in seinem Amt und liebte es, seine Macht zu demonstrieren. Die Rolle des Familienoberhauptes verkörperte er klassisch, typisch für die damalige Zeit. Vater wusste und sagte, wo es langging – Widerreden wurden nicht geduldet. Er war keine Autorität, die man um Rat fragen konnte, sondern eine, der man gehorchte. Für uns Kinder interessierte er sich wenig. Kinder gehörten einfach dazu. Keine Familie ohne Kinder. Kein Mann ohne Kind.
Auf einer Fotografie aus meiner frühen Kindheit ist die Familie Duttle noch zu dritt, ich stecke noch in Windeln. Vater und Mutter in Badekleidern am Strand. Vater hält mich, er greift mich kleinen Wurm mit einer Hand um die Mitte des Leibes. In seinem Schwimmanzug mit Trägern und mit seinem muskulösen Oberkörper sieht er für heutige Augen aus wie ein Ringer. Ein Ringer, der stolz seinen Pokal in die Kamera hält. Stolz machte ich meinen Vater allerdings nie. Schon äußerlich war er eine Autoritätsperson, mit der nicht zu scherzen war. Groß und breitschultrig, etwas Herbes und Derbes auch im Gesicht. Definitiv kein Feingeist, kein Intellektueller.
Meine Mutter steht zufrieden lächelnd neben Mann und Kind. Ich hätte sie gern mehr lachen sehen. Ich hätte sie gern mehr zum Lachen gebracht.
Wir wohnten in einem Villenquartier im Westen der Stadt. In einem oberen Stockwerk eines stattlichen Hauses, mit großem Balkon und Sicht aufs Meer. Eine standesgemäße Residenz war unabdingbar. Aber mein Vater war ganz besonders stolz auf seinen Besitz. Das gesamte Inventar musste penibel dokumentiert werden, jedes Stück der vornehmen Wohnungseinrichtung wurde einzeln fotografiert.
Zu unserem Haushalt gehörten auch mehrere Dienstmädchen aus verschiedenen Bevölkerungsgruppen, Araberinnen, Armenierinnen, Türkinnen, Drusinnen. Vielleicht hat mein Vater sie ebenfalls inventarisiert. Ich erinnere mich besonders gern an sie. Genauer: an ihren Geruch. Den Duft ihrer Haut, ihrer Haare, ihrer Kleidung. Jede dieser Frauen trug ihre eigene Tracht. Sie rochen alle auf ihre Weise gut, vertraut, natürlich. Den Geruch von Menschen und Landschaften habe ich auch später immer stark empfunden – besonders bei naturverbundenen Menschen, den Inuit, den Indianern, den Völkern in Asien. Aber natürlich liebte ich diese Naturgerüche auch in der Schweiz. Ich erinnere mich an ein Bauernmädchen, das ich in den Winterferien auf einem Bauernhof kennen lernte. Ihr wundervoll nach Heu duftendes Haar machte mich glücklich (um nicht mehr zu sagen).
Beirut war damals schon ein wichtiges Handelszentrum mit stark westlichem Einschlag. Viele verschiedene Kulturen, Sprachen, Religionen, Mentalitäten lebten hier zusammen – oder getrennt.
Meine Mutter nahm mich öfters mit an jenen Ort, wo alle sich trafen und wo das Orientalische am stärksten zu spüren war: auf den Basar. Seltsam: Mitten im geschäftigen Treiben, unter dem Geschrei der feilschenden Händler stand ich gebannt vor einem großen Stück Fleisch, das unter der Sonne vor sich hin faulte. Ein Heer von kleinen, summenden Fliegen umwimmelte es.
Schon sehr früh merkte ich, dass die Welt außerhalb unseres Quartiers eine andere, keine heile war. Dass es zwei Sorten von Kindern gab. Jene wie ich, die in einem schönen Haus wohnten, mit schönen Spielsachen und schönen Kleidern. Die von ihren Eltern in den Kindergarten der Amerikanischen Schule gebracht und wieder abgeholt wurden. Und jene anderen, die auf der Straße lebten, die schmutzig waren und verlumpte Kleider trugen. Deren Väter nicht im feudalen Wagen, sondern mit einem Eselskarren unterwegs waren.
Es gab nicht nur viele verschiedene, es gab vor allem auch arme und reiche Menschen.
Offenbar hatte ich also großes Glück, als ich am 28. März 1938 im American University Hospital von Beirut als Sohn von Paul und Frieda Duttle-Bohner geboren wurde. Und trotzdem war ich kein glückliches Kind. Das Glückskind der Familie kam ein Jahr später zur Welt. Mit Rudi begann meine große Verzweiflung. Rudi war alles, was ich nicht war. Extravertiert, lebensfroh, ein Lausbub, der keck auf die Leute zuging, sie unterhielt und zum Lachen brachte. Mein kleiner Bruder machte mir vor, wie man sein musste, wenn man geliebt werden wollte.
Rudi brachte Sonne und Schatten in unsere Familie, Sonne für meine Eltern, Schatten für mich. Dieses Gefühl, gegen meinen Bruder nicht anzukommen, eine Art zweitrangiges, unzulängliches Kind zu sein, war so stark, dass es sich zu einer Grundgewissheit entwickelte. Einer tragischen Grundgewissheit, an der es absolut nichts zu rütteln gab. Von da an erscheint mir mein Leben als eine Reihe von Versuchen, vor dieser traurigen Gewissheit davonzulaufen.
Liebe Mama! Da sitzt du in unserem Zimmer und liest uns vor und singst mit uns – oft auch auf Englisch, denn du warst ehrgeizig und wolltest uns auf diese Weise einen Vorteil fürs spätere Leben verschaffen. »Mother Goose«, »Tales from Ebony«, aber auch die Märchen von Andersen und den Gebrüdern Grimm. Ich versank in diesen Geschichten, sie beschäftigten und beglückten mich.
Hans im Glück war mein großes Vorbild. Nicht im Sinne einer Erwachsenenmoral, als Vorbild für eine optimistische Weltsicht, die in allem nur das Positive sieht. Das war mir ganz unmöglich und auch nie erstrebenswert. Vorbildlich war für mich das schlichte Schicksal dieses Hans im Glück: Er verlor auf naive Weise sein ganzes Vermögen und kam völlig mittellos, aber glücklich jubelnd nach vielen Jahren zu seiner einsamen und armen Mutter zurück, die ihn mit großer Liebe an ihr Herz drückte.
Neben einer tiefen Trauer setzte sich in diesen Jahren auch eine ständige Angst in mir fest. Die Angst vor dem Krieg. Weshalb war sie so stark?
»Beirut im Krieg« steht unter einer Fotografie aus dem Jahr 1941. Sie zeigt einen kleinen Jungen in kurzen Latzhosen und weißen Schuhen. Jemand hat ihm einen Offizierssäbel in den Gurt gesteckt. Seine linke Hand umfasst den Lauf eines Gewehrs, das neben seinem linken Fuß auf dem Boden steht. Ratlos und verloren schaue ich in die Kamera.
Woher also kam diese große Angst vor dem Krieg? Beirut war nicht unmittelbar in Kriegshandlungen verwickelt. Aber Vater sprach ständig davon. Erst später habe ich mich über die damalige politische Situation informiert.
In Europa vergessen wir gern, dass sich dieser Weltkrieg wirklich auf der ganzen Welt abspielte. Die Regionen Syrien und Libanon, unter französischem Völkerbundsmandat, waren für Nazi-Deutschland strategisch wichtig. Von hier aus wollte man mit...