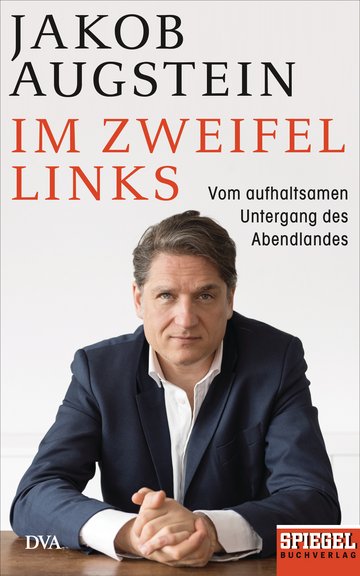Vorwort
Der Diplomat, Dichter und Widerstandskämpfer Stéphane Hessel hat in seinem wichtigen Essay »Empört Euch!« geschrieben: »Ich wünsche jedem Einzelnen von Ihnen einen Grund zur Empörung. Das ist sehr wertvoll. Wenn etwas Sie empört, wie mich die Nazis empört haben, werden Sie kämpferisch, stark und engagiert.«
Man liest das und denkt gleich: Das ist ein sehr schöner Satz! Ja, Empörung muss sein! Es gibt genug Grund zur Empörung. Und tatsächlich gibt es auch jede Menge Empörung im Land. Es herrscht an Empörung gar kein Mangel. Wir sind eine empörte Republik. Das Netz, das inzwischen abbildet, was man die öffentliche Meinung nennt, ist voll von Empörung. Da haben alle recht. Keiner hört dem anderen zu. Und es geht immer um alles. Da wächst der Hass, und die Wut wächst auch.
Und währenddessen arbeitet »das System« im Verborgenen einfach weiter: Die Reichen werden reicher, die Mächtigen sichern ihre Macht, und an der Klimakatastrophe ändert sich auch nichts. Wer bei dem Begriff »das System« ins Stutzen kommt, der muss erst einmal erklären, was sonst die deliberative Demokratie an zentralen Herausforderungen scheitern lässt. Oder sind die Gerechtigkeit und das Klima keine zentralen Herausforderungen? Das ist das Theodizee-Problem der Moderne: Wie können wir sagen, die parlamentarische Demokratie sei die letzte Antwort, wenn wir gleichzeitig sehen, welche Ungerechtigkeiten im Rahmen dieser Demokratie möglich sind?
Alle Empörung ändert nichts daran, dass »das System« die Demokratie überwölbt, sie einhüllt, sie durchwirkt.. Im Gegenteil: Die allgemeine Empörung lenkt die Leute einerseits ab von dem, was notwendig wäre – eine andere Politik. Und andererseits sorgt sie auf Dauer dafür, dass die Institutionen, die man für die Reform des »Systems« bräuchte, destabilisiert werden. Dadurch stabilisiert die Empörung »das System«.
Das ist eine schwierige, zirkuläre Erkenntnis, und sie ist es für den Kolumnisten in besonderem Maße. Denn für den Kolumnisten ist Empörung beinahe eine notwendige Arbeitsbedingung. Aber was, wenn selbst die Empörung, die sich in einer Kolumne unter dem Titel »Im Zweifel links« niederschlägt, am Ende nur »das System« stabilisiert?
Meine erste Kolumne auf SPIEGEL ONLINE – und ich wechsle jetzt in die erste Person, was ich in Artikeln beinahe nie tue – erschien im Januar 2011 und beschäftigte sich tatsächlich mit diesem Essay von Stéphane Hessel. Das ist noch keine zehn Jahre her und doch eine Ewigkeit. Man hat das damals noch nicht gleich gemerkt, aber im Nachhinein wird deutlich, dass sich genau zu dieser Zeit das Wesen der öffentlichen Debatte zu ändern begann. Inzwischen ist der Wandel offenkundig. Die Kolumnen, die Mathias Müller von Blumencron und Jan Fleischhauer damals für SPIEGEL ONLINE erfanden, darunter auch meine eigene, haben diesen Wandel nicht bewirkt, sie waren eines seiner Symptome.
Kolumnen dürfen persönlich sein, unfair, hart, riskant. Sie sind ein Spiel mit den heiklen und den verbotenen Seiten des Journalismus: mit Meinungen und Übertreibungen, mit dem Populismus, manchmal mit der Propaganda, immer mit der Satire. Ich habe als Kolumnist meine Erfahrungen mit diesen heiklen Seiten gemacht. Kolumnen sind das passende Medium einer rauer gewordenen Debattenlandschaft.
Wer allerdings den einzigen Zweck des Journalismus im sprichwörtlichen »Sagen, was ist« sieht, wird Kolumnen gar nicht für Journalismus halten. Denn das ist nicht ihre wichtigste Aufgabe. Kolumnen nehmen sich die Freiheit, auch das zu sagen, was hätte sein können, was auf keinen Fall sein darf, und vor allem das, was sein soll. Es ist vielleicht darum kein Zufall, dass der bekannteste Journalist unseres frühen 21. Jahrhunderts gar kein Journalist ist, sondern Ökonom und Kolumnist: Paul Krugman von der New York Times.
Andererseits sieht man daran aber auch: Ohne das richtige Medium hilft dem Kolumnisten weder Witz noch Weisheit. In Deutschland ist SPIEGEL ONLINE das richtige Medium: groß und unabhängig. Die Freiheit, dort Woche für Woche alles schreiben zu können, beinahe alles, und buchstäblich Hunderttausende lesen mit – das ist ein großes Geschenk. In all den Jahren ist nur ein einziges Mal ein Text nicht erschienen – über Joachim Gauck und seine Stasiakte. Tempi passati, wie man in Rostock sagt.
Woche für Woche Hunderttausende von Lesern, Millionen von Klicks im Jahr – von solchen Zahlen könnte der Kolumnist ganz betrunken werden und sich an der Vorstellung berauschen, es mache tatsächlich für unsere Wirklichkeit einen Unterschied, was er da schreibt, er habe eine Wirkung, er habe gar Einfluss. Und Einfluss wäre doch schön. Denn natürlich denkt der Kolumnist, er habe etwas zu sagen und die Leute sollten gefälligst auf ihn hören. Das ist eben die Versuchung, wenn man nicht nur sagen will, »was ist«, sondern auch »was sein soll«. Eine gefährliche Versuchung. Und wenn man darüber eine Weile nachdenkt, gerät man in Verwirrung. Was soll man denn als Kolumnist von seiner Arbeit erhoffen dürfen? Es gibt Autoren und Autorinnen, die tragen mit selbstvollem Ernst ihr Ich vor sich her und sind in ihrer lustigen Kürbisköpfigkeit alles andere als ein Vorbild. Demut tut dem Kolumnisten unbedingt not! Aber von der Demut ist es nur ein kleiner Schritt in die Bitterkeit und in die traurige Erkenntnis der ganzen Vergeblichkeit des eigenen Tuns.
Wie geht man damit um? Wenn man sich wie die Kassandra fühlt, die bei Schiller mit solchen Worten ihre Klage gegen den Gott führt:
»Warum warfest du mich hin
In die Stadt der ewig Blinden
Mit dem aufgeschloßnen Sinn?
Warum gabst du mir zu sehen,
Was ich doch nicht wenden kann?
Das Verhängte muß geschehen,
Das Gefürchtete muß nahn.«
Oder – etwas prosaischer – wenn man sich wie im Kasperletheater vorkommt, wo das Publikum das Krokodil von hinten kommen sieht und versucht, mit lautem Rufen die Protagonisten zu warnen – aber die hören einfach nicht.
Jahr für Jahr warnt man vor Angela Merkel. Und Jahr für Jahr wird sie wieder gewählt. Jahr für Jahr schreit man der SPD ins Ohr, sie solle endlich aufwachen. Und Jahr für Jahr muss man zusehen, wie die Partei sich selber zerstört. Jahr für Jahr beklagt man die zunehmende Ungerechtigkeit im Land und die wachsende soziale Spaltung. Und Jahr für Jahr hört man von Politikern und Leitartiklern, dass die Leute froh sein sollen, dass die Globalisierung sie nicht noch schlimmer erwischt hat.
Noch kurz ein Wort zu Angela Merkel, die in den folgenden Texten eine so große Rolle spielt: Im Frühjahr 2011 habe ich geschrieben: »Wie die Cheshire Cat aus Alice im Wunderland löst sich die Kanzlerin in Luft auf, wenn man sie greifen will. Und es bleibt nur ihr spöttisches Grinsen zurück. Das ist nicht viel.«
In den Jahren danach gab es keinen Grund, dieses Urteil zu revidieren. Es hieß immer, der Erfolg dieser Kanzlerin beruhe auch darauf, dass sie nicht polarisiere, keinen Punkt zum Angriff böte, keine Fläche zur Reibung. Bei mir hat das nicht funktioniert. Sie hat mich vom ersten Tag an wahnsinnig gemacht. Denn Merkel hat ihre zweifellos hohe Intelligenz hinter einem schlecht gespielten stoffeligen Gleichmut versteckt und damit uns alle beleidigt: die Öffentlichkeit, die Medien, die Wähler, mich. Merkel hat die Leute für dumm verkauft und gewonnen. Eine größere Kränkung des demokratischen Souveräns kann es nicht geben.
»Frau Doktor Merkel arbeitet als Fachärztin für politische Anästhesie im Kanzleramt«, habe ich geschrieben – dabei hätte es für sie so viel zu tun gegeben. So vieles wäre möglich und nötig gewesen: Klima, Atomwaffen, Europa, Migration, Bildung, Digitalisierung, Verkehr. So viel stand – und steht – auf dem Spiel. Und noch dazu leidet das Land unter einem unerhörten Generationenkonflikt: Früher meinte man mit dem Wort, dass die Alten beim Anblick der Jugend um ihre Werte fürchteten. Heute meint man damit, dass die Jungen mit atemlosem Zorn zusehen müssen, wie die Alten diese Werte verraten.
Als Kolumnist stößt man auf Dauer unweigerlich auf die Frage: Muss das alles so sein? Oder könnte alles anders sein? Warum wurde Martin Schulz nicht Kanzler? Weil er Fehler gemacht hat, die er hätte vermeiden können? Oder musste er seine Fehler machen, weil er nun einmal der ist, der er ist? Oder war das alles ganz gleichgültig, weil die Sozialdemokratie in einer nicht auflösbaren Krise steckt, aus der kein Schulz der Welt sie hätte befreien können?
Ich weiß nicht, wie groß oder klein der Gestaltungsspielraum der Politik heute ist. Ich glaube, dass es die Geschichte gibt und dass sie irgendwohin treibt. Es gibt die Strukturen, und der Gang der Dinge lässt sich von ihnen prägen. Aber man mag sich ungern ganz von der Idee verabschieden, dass es auch Menschen gibt, die Entscheidungen treffen, und dass diese Entscheidungen einen Unterschied machen können. Geschichte entwickelt sich unter unseren Augen. Wir schreiben an der Realität mit, die unser Roman ist.
Realität ist ein gefährliches Wort. Man muss vorsichtig sein, wenn jemand von Realität spricht. Wenn einer Realität sagt, meint er meistens nur: Man kann nichts machen. Alles bleibt, wie es ist. Linkes Denken soll das Gegenteil davon sein. Es soll von der Veränderbarkeit der Welt handeln.
Die Bundeskanzlerin ist dafür berühmt, eine große Realistin zu sein. Im Jahr 2004, als sie 50 Jahre alt wurde, ließ sie den Hirnforscher Wolf Singer eine Rede darüber...