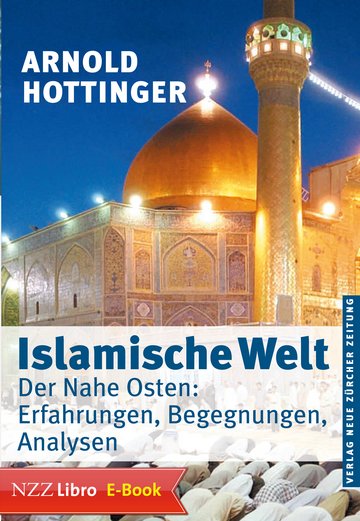Reisen ins Innere: Jordanien und Syrien
Von Beirut aus unternahm ich im Früh- und Hochsommer 1956 meine ersten Reisen alleine in das arabische Hinterland. Sie sollten dazu dienen, die so mühsam gelernte Umgangssprache nun auch anzuwenden und zu erproben, wieweit man mit ihr in den benachbarten arabischen Ländern durchkommen konnte. Darüber hinaus sah ich es auch als meine Aufgabe an, diese Länder wirklich kennenzulernen, und mir war klar, dass nichts zu diesem Zweck mehr beitrage, als in ihnen auf dem bescheidenen Niveau der Einheimischen Reisen zu unternehmen. Erste Ziele wurden, via Damaskus, Amman, Petra und Aqaba. Diesmal wollte ich auf die Taxis verzichten und mit Autobussen reisen. Nicht nur weil dies noch billiger war, sondern in erster Linie, weil es in den Bussen ein anderes, volkstümlicheres Publikum gab als in den Taxis.
Der Bus nach Damaskus war denn auch ein wirkliches Arbeitspferd der Strasse. Er hielt nicht nur in den Dörfern an, die er durchquerte, sondern auch unterwegs, wann immer jemand zusteigen wollte. Dies bedeutete, dass die Landbevölkerung ihn benützte, wenn sie auf kürzeren Strecken zwischen zwei Dörfern reiste. Die schnelleren Service-Taxis waren mehr auf den Verkehr von Stadt zu Stadt eingestellt. In meinem Bus fuhren Gruppen von Frauen, die metallene Milchkannen transportierten, entweder, um ihre eigene Milch in die Stadt oder eine der grösseren Ortschaften zu bringen, oder um die leeren Kannen wieder nach Hause zurückzubringen. Lebende Hühner, an den zusammengebundenen Beinen getragen, konnten auch von der Partie sein. Weiter entfernt von der Stadt brachten andere Frauen genähte Ledersäcke auf den Bus, gefüllt mit der eingedickten Sauermilch, die Laban genannt wird und eines der wichtigsten und gesundesten Volksnahrungsmittel bildet. Generationen von Kindern sind damit aufgewachsen. In dieser Form ist die Milch lange haltbar und zugleich ein vorzügliches Mittel gegen Magenverstimmung. Die Ledersäcke wurden einfach auf den Boden des Busses gelegt, und wenn wenig Raum war, traten die Leute mit ihren Sandalen auf sie, ohne für ihren Inhalt zu fürchten. Bauernfrauen, die etwas auf den Markt zu bringen hatten, reisten immer in Gruppen. Manche schleppten auch Kinder mit.
Sie gehörten nicht zu den ärmsten Teilen der Bevölkerung; offensichtlich noch ärmer waren die, welche die Mitreisenden als «Zigeuner» bezeichneten. Dies waren Gruppen von Fahrenden, die ihre Haushaltsgerätschaften mitschleppten, manchmal hatten sie einen Esel dabei. Sie wanderten der Strasse entlang, um sich als Wanderarbeiter zu verdingen. Das seien keine Beduinen, bei Leibe nicht, wurde dem jungen Europäer erklärt, bloss «Zigeuner», mindere Leute, denen man nicht recht trauen könne. Wenn einige von ihnen in den Bus einstiegen, wurden sie dementsprechend behandelt. Niemand wollte mit ihnen zu tun haben. Über die Fahrgelder, die sie zu entrichten hatten, gab es lange Diskussionen mit dem Chauffeur und seinem Gehilfen, dem Conducteur. Sie liessen sie erst in den Bus einsteigen, nachdem sie ihr Geld erhalten hatten.
Dass ein junger Europäer mitfuhr, erregte die Neugier der Passagiere. Sie stellten Fragen und waren bestrebt, ins Gespräch zu kommen, und das war natürlich eine der Absichten bei der Wahl dieses volkstümlichsten aller Transportmittel gewesen. Auch die Langsamkeit der Reise war von Gewinn. Sie erlaubte, die Berglandschaft, die man durchquerte, vollständiger in sich aufzunehmen, als das beim Vorübersausen im Taxi möglich gewesen war. Doch die Reise bis nach Damaskus dauerte lang. Vom frühen Morgen bis zum späten Nachmittag war der Bus unterwegs. Der Fahrer hielt an, um sich zu verköstigen, und erlaubte so auch den Reisenden einen kurzen Imbiss in einem der vielen Teehäuser von Chtora, dem ersten Ort in der Bekaa-Ebene, die es am Rande der Strasse gab.
Syrien, der grössere, aber ärmere Nachbar
Die Fahrgäste wechselten mehrmals. In der Bekaa stiegen viele syrische Land- und Bauarbeiter ein, die in Libanon gearbeitet hatten. Schon damals bestand eine Arbeitswanderung der ärmeren Syrer nach dem reicheren Libanon. Die Grenzstation bedeutete einen langen Aufenthalt. Säcke, Kisten, Holz- und Blechkoffer mussten vom Dach abgeladen, geöffnet und inspiziert werden. Doch jenseits der Grenze ging die Reise zügig voran; der libanesische Bus durfte keine syrischen Passagiere aufnehmen, weil der Verkehr zwischen syrischen Orten für die syrischen Autobusse reserviert war. Syrien war ärmer als Libanon, aber schon damals viel stärker reglementiert. Der Staat bestimmte die Wirtschaft und liess ihr nur enge Freiräume. In Libanon waren es eher die Wirtschaftskräfte, die den Staat lenkten – zu ihren Gunsten natürlich, wie es schien jedoch auch zugunsten der ganzen Gemeinschaft, die deutlich wohlhabender war.
Die Konkurrenz zwischen den beiden Mittelmeerhäfen Beirut und Lattakiya war ein Beispiel für den Unterschied: Beirut hatte das Rennen schon damals haushoch gewonnen. Die meisten Transporte, auch die für Syrien bestimmten, gingen über Beirut, weil die Zölle und Abfertigungsformalitäten in Lattakiya so viel Zeit in Anspruch nahmen, dass Seefahrtslinien und Transporteure den syrischen Hafen, so weit sie konnten, vermieden. Weil auch die syrische private Wirtschaft ihre Importgüter rasch und reibungsfrei erhalten wollte, war es den syrischen Behörden nicht möglich gewesen, die über Beirut fliessenden Warenströme abzuwürgen und ihren eigenen Hafen zu privilegieren. Dies wurde versucht, führte jedoch zu solchen Lieferungsverzögerungen und Verstopfungen in Lattakiya, dass es wieder aufgegeben werden musste. Lattakiya war zum Hafen der staatlichen Importe und Exporte Syriens abgesunken – und auch das nur, wenn keine Eile geboten war.
Damaskus auf eigene Faust
In Damaskus gab es damals, sogar im Zentrum der Stadt, sehr viele bescheidene Hotels, die den einfachen Leuten unter den Einheimischen dienten. Fliessendes Wasser besassen sie alle. Esslokale fand man gleich in der Nähe. Das Schild: «Besonderes Lokal für Familien» in arabischer Sprache bedeutete, dass dieses Restaurant einen eigenen Raum besass, in dem ganze Familien, nicht nur alleinstehende Männer, speisen konnten. Solche Familien waren fast immer reisende Familiengruppen, die in der Stadt keine Verwandten hatten, bei denen sie absteigen konnten. Wo Frauen und Kinder assen, gab es keinen Alkohol und keine ruppigen oder lauten Gäste. Meistens war auch das Essen reichhaltig und gut, weil die Frauen sich nichts schlecht Zubereitetes vorsetzen liessen. Daneben gab es aus der französischen Zeit ausgesprochene Feinschmeckerlokale, mit typisch französischen Namen wie «Socrate», natürlich mit Alkohol, deren einige etwas heruntergekommen waren. Franzosen, die sie regelmässig besucht hätten, fehlten. Doch sie konnten immer noch ein paar hervorragende Spezialitäten des Hauses anbieten.
Der grosse Basar übte bei jedem Besuch seine Faszination neu aus. Es war schon auf jener zweiten Fahrt nach Damaskus, dass ich dort einen Laden entdeckte, der die bunten volkstümlichen Drucke feilbot, die allerhand islamische Gestalten und Episoden sowie Figuren aus der arabischen Sage abbildeten oder auch in bunten Farben kalligraphierte Verse und Sprüche aus dem Koran wiedergaben. Diese Bilder waren für Bauernhäuser und einfache Kaffeehäuser bestimmt. Damals fand man sie eher auf dem Lande als in den Städten. Das Geschäft verkaufte auch Volkserzählungen und -romane in billigen Drucken, die kürzeren als Hefte, die längeren, unter denen ich auch die Märchensammlung von «Tausend und eine Nacht» fand, in mehrbändigen Ausgaben, die in Karton gebunden waren. Die Kunden dürften in erster Linie Bauern und Kaffeehausbesizer gewesen sein, die vom Lande kamen und derartige Bilder und Bücher nach Hause mitbrachten.
Ich wurde ein fleissiger Besucher jenes Ladens (er ist heute verschwunden), wo ich mir nach und nach die attraktivsten Bilder und die interessantesten Volksbücher zusammenkaufte. In Kairo sollte ich später ähnliche Geschäfte finden; in Persien wurden vergleichbare Drucke in persischer Sprache, oft auf der Strasse, etwa am Rande der städtischen Parks, feilgeboten. Auch in der Türkei fand ich später ähnliche bunte Drucke, die jedoch meistens patriotische Figuren wie Sultane oder berühmte Heerführer und Seehelden oder aber die Bilder von islamischen Mystikern zeigten. Die Volksbücher hatten früher dazu gedient, in den Cafés von Berufsvorlesern rezitiert zu werden. Doch in Damaskus war nur noch ein einziges derartiges Kaffeehaus, direkt hinter der Grossen Moschee, übrig geblieben. Die Volksbilder und -bücher sind heute durch die photographischen Reproduktionen und Illustrierten, oft allerbanalster Natur, verdrängt worden.
Ich lernte allmählich die verschiedenen Menschengruppen zu unterscheiden, die sich durch den Basar bewegten. Neben den Damaszenern der bürgerlichen und der Unterschichten entdeckte man viele Fremde. Die Beduinen waren an ihrer Tracht, an ihren Sandalen und an der Art, wie sie gingen, zu erkennen. Sie nahmen mehr Raum ein als ihre sesshaften Landsleute, sogar in den Basargängen und -gassen schufen sie Leere um sich, die einfach dadurch entstand, dass ihnen ausweichen musste, wer nicht Gefahr laufen wollte, mit ihnen zusammenzustossen. Die Besucher aus dem Persischen Golf und aus Saudi-Arabien, noch nicht so zahlreich wie später, waren an ihren langen weissen Hemden zu erkennen, die stets frisch gewaschen wirkten. Irakis kamen manchmal in der Dischdascha daher, die sich kaum von einem bunt gestreiften Nachthemd unterschied, nur dass ein Kopftuch dazu gehörte. Die syrischen Bauern, vor allem die Drusen, trugen die schwarzen osmanischen Pluderhosen, enganliegend an den Waden. Händler aus den...