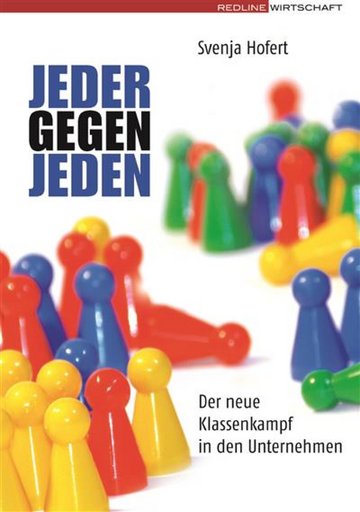Überlebenskampf im Konzern: Warum Größe die Konkurrenz fördert
„Große Unternehmen sind oft böse Unternehmen, die gut spielen“, vertraute mir einst ein Managementtrainer an. Damals war ich mir nicht sicher, wie er dies meinte. Zehn Jahre später und um diverse Erfahrungen reicher, bin ich fest davon überzeugt: Große Unternehmen fördern das Jeder-gegen-jeden – allein durch ihre Größe. Sie sind Demokratien ohne Gesetzbücher und ohne dauerhafte Regierung. Sie können weder feste Regeln noch Kontinuität bieten und verhindern deshalb Identität. Sie locken charakterliche Wendehälse an, Opportunisten, die sich schnell auf unterschiedliche Strömungen einstellen können. Sie dürfen sich im Zweifel nicht allzu sehr durch feste eigene Wertvorstellungen aufhalten lassen, um die Unternehmensziele zu erreichen. Langfristig töten große Unternehmen die Leistungsbereitschaft des Einzelnen, sie lassen Starrsinn wachsen. Sich regelmäßig wiederholende Personal-Abbaumaßnahmen legen das Fundament zu einem dauerhaften Überlebenskampf, der Mitarbeiter geradezu verführt, mit Guerilla-Methoden um den eigenen Stand und Status zu kämpfen.
Warum das System „großes Unternehmen“ vor allem dann nicht funktionieren kann, wenn es börsennotiert ist, möchte ich in diesem Kapitel erklären.
Zur Einstimmung eine kleine wahre Geschichte, die einerseits Normalität spiegelt, andererseits zeigt, wie mühelos selbst leitende Angestellte im großen Unternehmen ein egoistisches Eigenleben führen können.
Wir befinden uns in einem der größten und am stärksten wachsenden europäischen Konzerne. Es ist ein Tag wie jeder andere: Schon vor acht Uhr kleben gelbe, grüne und blaue Zettelchen an den Bildschirmrändern. Darauf stehen Arbeitsanweisungen für die Mitarbeiter von Herrn X. Die Mitarbeiter arbeiten Zettel für Zettel ab. Der Chef liest derweil wie jeden Morgen Zeitung, die Beine auf dem Tisch, er telefoniert privat. Zwischendurch besucht er das eine oder andere Meeting. Was dort besprochen wird, erfährt kein Mitarbeiter. Dieser Chef kennt nur Befehle. Abends kontrolliert er, ob alles erledigt ist. Er spricht kaum ein Wort mit den Mitarbeitern, lediglich „Warum geht das nicht?“ rutscht ihm zwischendurch einmal raus. Herr X, nennen wir ihn Post-It-Manager, besucht seit acht Jahren einmal im Jahr ein Führungskräftetraining. Er kennt die Methoden modernen Managements, er propagiert sie auch vor seinem Chef, aber selbst umsetzen will er sie lieber nicht. Er befürchtet, Macht und Privilegien zu verlieren, verrät er dem externen Führungskräftetrainer einmal unbedacht nach einem Glas Wein.
Führungskräftetrainings sind nichts anderes als gehobene Betriebsausflüge, das bestätigt auch ein Kollege von mir – er selbst führt diese Trainings seit zwei Jahrzehnten durch. Die Teilnehmer geben dem Trainer im Feedbackbogen gute Noten, wenn er sie angeregt unterhalten hat und sie im Nebenprogramm – abends im Restaurant und auf der Piste – bei Laune gehalten wurden. Da der Trainer im nächsten Jahr wiederkommen darf, wenn er überall „gut“ und „sehr gut“ bekommen hat, geht es auch ihm vor allem um eine gute Evaluierung. Anders ausgedrückt: Ihn interessiert eine hohe Zustimmungsquote. Und die kommt nicht von ungefähr, sondern entfaltet sich am besten vor dem Hintergrund einer besonders netten Atmosphäre.
Die Mitarbeiter des Post-It-Managers leiden nicht unter ihrem Chef. Er ist ihnen gleichgültig, sie nehmen ihn sowieso nicht ernst. „Der Chef“ ist jemand, der niemandem gerade in die Augen sieht. Offenheit macht ihm Angst; deshalb liebt er die kurzen Absprachen und Info-Gespräche auf dem dunklen Flur. Ihm ist völlig gleich, dass seine Sekretärin die Post der neuen Mitarbeiterin verschwinden lässt. Als diese ihn weinend darauf anspricht und um Hilfe bittet, murmelt er: „Macht das unter euch aus“. Es wundert in diesem Unternehmen niemanden, dass ein solcher Mann ohne Führungspersönlichkeit Chef werden konnte. Jeder weiß hier, dass es die Berufserfahrung in Jahren, die Lobbyarbeit und der Draht nach oben sind, die zählen. Gute Chefs gibt es auch; aber die sind Zufallsprodukte.
In einer anderen Abteilung desselben Unternehmens arbeitet ein Ingenieur, der mir stolz erzählt, dass er für seine immerhin 7 000 Euro Gehalt nur ein paar Planungen durchführen und ansonsten die Zeit bis 17 Uhr weitgehend unbehelligt von seinem Vorgesetzten absitzen würde. Er arbeitet in dem Unternehmen, weil es ihm maximale Sicherheit bei minimalem Einsatz bietet. Er behauptet feixend, nie arbeitslos werden zu können, und lästert über Menschen, die so dumm waren, das Falsche zu studieren. Geschichte zum Beispiel, wie ich. Unter Historikern herrsche eine Arbeitslosenquote von 30 Prozent, triumphiert er und meint, dass ich Glück gehabt hätte, einen Einstieg in einen Job gefunden zu haben, der sonst nur Betriebswirten vorbehalten ist.
Er hat durchaus Interesse am Erfolg seines Konzerns – so lange dieser Erfolg seinen persönlichen Frieden nicht stört und nicht zu mehr Arbeit verpflichtet.
Die Produktivität der Abteilung mit dem Post-It-Manager sei gering, verrät mir ein Controller, der mein Beratungskunde ist. Das fällt derzeit nicht auf, denn das Unternehmen schafft Arbeitsplätze. Manche Leute, so der Controller, schleppe man einfach mit. Die Gewinne sind groß und die Aktionäre zufrieden. Dass die Kommunikation in einigen Abteilungen lausig ist, manche Manager grausig, die Abläufe stümperhaft sind, dass Arbeiten doppelt und dreifach verrichtet werden – dies und auch die Geldverschwendung interessiert nur sehr wenige, meist Zeitarbeiter, die sich als Zweite-Klasse-Angestellten begreifen, die Erste Klasse arbeiten müssen. Sie sehen wie jeder gegen den anderen agiert, dabei Geld, Zeit und Energie verschwendet wird, schütteln den Kopf und schweigen in Sorge um ihre eigene Übernahme und das, was im Zeugnis stehen wird.
Zu gut geht es jedem Einzelnen in seinem Mikrokosmos, zu leicht ertragbar sind die Unzulänglichkeiten der Chefs, zu ungemütlich scheinen die Welt und die Jobs da draußen. Das stumpft ab; was interessieren einen da noch die anderen? Unternehmensziele – wie bitte? Der Klassenkampf tobt noch nicht; es ist eine Vorstufe.
Zu groß für unser Großhirn
Die wahre Geschichte vom Post-It-Manager ist ein typisches, sehr normales und unspektakuläres Beispiel für Geschehnisse und Führungsstile, die in großen Unternehmen fast zwangsläufig und in kleinen Unternehmen bei schlechter Firmenleitung an der Tagesordnung sind. Und mir geht es zunächst um die normal-banalen Zustände des Unternehmensalltags, denn dort keimt das „Jeder-gegen-jeden“.
Normal und banal ist unter anderem das: Es entstehen individuelle Einflussbereiche, bündeln sich persönliche Interessengebiete, erheben sich Inseln im Unternehmensmeer. Das Unternehmen wird so nach und nach ein unübersichtliches und deshalb nicht mehr zu kontrollierendes Gebilde. Irgendwann ist es ein gewachsener Mikrokosmos, in dem verschiedene Evolutionsstufen aufeinandertreffen: alte Bereiche und sehr junge, fortschrittliche und rückständige. Ein Artenreichtum, geprägt von verschiedenen Herrschafts- und auch historischen Epochen, wechselnden unternehmerischen Zielsetzungen, individuellen Vorstellungen der Führungskräfte und ganz sicher auch vom Zufall. Die Sünden der Vergangenheit prägen etablierte Unternehmen: Die Sünden, die in Phasen zu schnellen Wachstums begangen worden sind, als zu schnell und unbedacht eingestellt worden ist. Die Sünden des Abbaus, die Löcher in den Arbeitsabläufen hinterlassen und Wunden in der Seele.
Durch Fusionen wachsen große Unternehmen zuerst, bevor sie schrumpfen. Sie erhalten neue Schichten, die mit den alten zusammenwachsen sollen. Sie erben die Sünden, die verschiedene „Regentschaften“ unterschiedlicher Abteilungsleiter und Top-Manager hinterlassen haben. Deren Führungsstil schwankt mitunter in ein und demselben Unternehmen zwischen dem Terrorregime eines Ivan dem Schrecklichen, dem tapferen Edelmut eines Richard Löwenherz und der Dummheit eines König Midas. Ingesamt scheint es ein wenig so, als würden Steinzeit, Mittelalter und Moderne zeitgleich existieren.
Je größer ein Unternehmen, desto unübersichtlicher wird es. Niemand kann mehr in alle Ecken sehen. Aus genau diesem Grund können ganze Abteilungen gut in diesen Ecken verschwinden. Das macht es einem Kapitän...