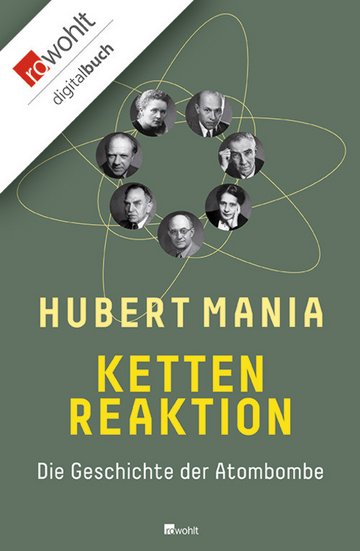Kapitel 1 Radioaktivität
Das Fauchen im Windofen des Labors klingt fast bedrohlich. Der mächtige Luftzug facht das Feuer an, damit es genügend Hitze entwickelt, um Metalle zu schmelzen. Mit der Wärme verfliegt auch allmählich der modrige Dunst aus den dunklen Steinen, die in der Kiste vor dem Ofen liegen. Sie schwitzen die Feuchtigkeit des Bergwerks aus, den Schwamm der verfaulten Schalhölzer. Selbst die saure Luft des aufgegebenen Silberstollens ist – so scheint’s – in die Ritzen der Mineralien gekrochen und wird jetzt von der behaglichen Wärme im Raum wieder hervorgelockt. Aber bald schon wird sich der Muff ohnehin restlos verflüchtigt haben wie die rasch verblassende Erinnerung an einen Dauerregen im Herbst. Denn gegen die hier aufgefahrene Batterie ätzender Flüssigkeiten in Flaschen, Glasröhrchen und Ampullen kann nichts auf der Welt anstinken.
Der Berliner Apotheker Martin Heinrich Klaproth hat seinen kompletten Bestand bewährter Substanzen und Mixturen in Position gebracht, um den neuen Gesteinsproben aus dem Erzgebirge auf den Leib zu rücken. Mit Feuer und Säuren will er sie spalten und zerbröckeln, sie mit Salzen anlösen und mit Wasser erweichen. Während er leuchtend rote Klumpen Blutlaugensalz im Mörser zerknirscht, überwacht er die Färbung der frisch angesetzten Galläpfeltinktur. Sie wird aus den grob gemahlenen, apfelförmigen Kokons von Gallwespenlarven gewonnen, deren Mütter die Eier in Eichenblätter hineinbohren. Ihre Gerbsäure wird so manche Unreinheit im Erz fortspülen. Mit der schwarzen Tinte, die aus demselben Sud produziert wird, schreiben im fernen Paris der leidenschaftliche Demokrat Lafayette und der radikale Robespierre gerade ihre Entwürfe zur Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte, in der sie so unerhörte Forderungen wie gleiches Wahlrecht für alle Männer und gar die Abschaffung der Monarchie stellen.
In diesen revolutionären Sommermonaten des Jahres 1789 herrscht auch in Klaproths Bärenapotheke im Schatten der wuchtigen Nikolaikirche an der Spandauer Straße, Ecke Probststraße eine ziemlich brenzlige Atmosphäre. In respektvollem Abstand zu den Schmelz- und Porzellanöfen bläst der Experimentator durch das Lötrohr fortwährend so viel Luft in eine offene Flamme, wie seine Lungen eben hergeben. Er hat den Docht einer Kerze in zwei Teile geschnitten und hält nun sein Blasrohr mitten in die Gabelung hinein. So kann er die Flamme modulieren, sie lang und spitzig blasen, bis sie genau die haselnussgroße Erzprobe umzüngelt, die auf einer aus Birkenholz hergestellten, knisterfreien Holzkohle liegt. Hier, im beengten Labor, können unkontrollierter Funkenflug oder winzige Körner aufspritzenden Metalls in Reichweite leicht entzündlicher Chemikalien und Kohlen selbst dem umsichtigsten Praktiker schon mal zum Verhängnis werden. Aber Martin Heinrich Klaproth ist mit riskanten Situationen beim Ablauf chemischer Prozesse vertraut. Als Mitglied der Loge «Zur Eintracht» ist er sogar im «Handbuch der Freimaurerei» von 1787 lobend erwähnt worden. Bei einem schlampig vorbereiteten alchemistischen Großexperiment bewahrte er seine Logenbrüder vor einer Explosionskatastrophe.
Mit der Geheimniskrämerei der Alchemistenfraktion will er nichts zu tun haben. Er distanziert sich klar vom mystischen Brimborium der Adepten, die noch immer auf der Suche nach dem Stein der Weisen sind, mit dem sie unedle Metalle in Gold verwandeln wollen. Als vorbildlicher Verfechter der wissenschaftlich begründeten Chemie lässt Klaproth nur gelten, was er in seinen Tiegeln und Retorten sehen, riechen und wiegen kann. Manchem Hersteller von Wunderarznei weist er betrügerische Absichten nach. So identifiziert er das beliebte «wunderthätige Luftsalz» als simples, zusatzfreies Glaubersalz, und das zu Wucherpreisen verkaufte «Pneumalkali» des Begründers der Homöopathie Samuel Hahnemann entlarvt er als gewöhnliches Borax [Dan:60].
Der Mineralkörper, den der Apotheker und Chemiker Klaproth in seine Bestandteile zergliedern will, wird von den Bergleuten des Erzgebirges Pechblende genannt. Sie schimmert gräulich bis tiefschwarz und erinnert ein wenig an den fetten Glanz von Pech. Die schweren Klumpen sind spröde und zerbrechen in muschel- und nierenförmige Stücke. Wegen ihres hohen Gewichts glaubten zu Beginn des 17. Jahrhunderts die ersten Silberschürfer in den niedrigen Stollen des böhmischen St. Joachimsthal noch an einen massiven Metallgehalt des Gesteins. Aber sie entdeckten nichts. Also hielt man die pechschwarzen Fundstücke eben für «Blende», die den verborgenen Schatz nur vorgaukele. In Wirklichkeit sei die Pechblende – so lautete das abschließende Urteil der Experten – taub, zu nichts nutze und behindere obendrein nur die Suche nach abbauwürdigen Erzen. Seitdem wirft man sie in den Silberstollen des Erzgebirges als Abfall beiseite.
Klaproth jedoch will es jetzt genauer wissen und das allseits verschmähte Mineral gründlicher untersuchen. Neugierig zerreibt er kleinere Brocken der Pechblende zwischen den Fingern, krümelt sie in Kalisalz hinein und bringt die Mischung im Schmelztiegel zum Fließen. Die schwarzgraue Masse bleibt starr und unauflöslich. Auch in der vom Lötrohr verstärkten Flamme erweist sich die Pechblende als unschmelzbar. Und so glüht er denn seine Steine, auf der Suche nach ihrer Essenz, aus und äschert sie ein, backt sie mit Blutlaugensalz zusammen, alkoholisiert und destilliert, färbt und filtriert sie, lässt sie verglimmen und trocknen, bis aus einer Mischung mit Phosphorsalz überraschenderweise eine klare grüne Perle hervorgeht – ein erster Hinweis auf die richtige Intuition des Experimentators. Da hält sich offenbar doch etwas Besonderes im Inneren des Gesteins versteckt.
Die vielversprechendsten Proben stammen aus der kleinen Silbergrube «Georg Wagsfort» im sächsischen Johanngeorgenstadt, nahe der Grenze zu Böhmen. In diesem Sommer hat Klaproth häufig in Karlsbad zu tun gehabt – ein beliebter Kurort für Zaren, Könige und den europäischen Adel. Gerade hat er einen Aufsatz über die Mineralquellen des weltberühmten böhmischen Thermalbads vollendet. Seine chemische Analyse des heilsamen Mineralwassers genügt hohen wissenschaftlichen Standards und soll im nächsten Jahr veröffentlicht werden.
Johanngeorgenstadt liegt 25 Kilometer nördlich von Karlsbad. Mitte des 17. Jahrhunderts hatten einige protestantische Familien die böhmische Bergbaustadt St. Joachimsthal verlassen, weil sie wegen ihres Glaubens verfolgt wurden. Auf der sächsischen Seite des Erzgebirges, am Fuß des Fastenbergs, bauten sie eine neue Stadt, die sie nach ihrem Landesherrn, dem Kurfürsten Johann Georg II., benannten. Eine Brauerei mit Schankstube war eher fertig als Rathaus und Kirche.
Die Stadt liegt 850 Meter über dem Meeresspiegel am fast abgeholzten Osthang des Fastenbergs. Als Martin Klaproth im Juli 1789, von Karlsbad kommend, hier Station macht, ist sie in den Qualm der Tag und Nacht brennenden Kohlefeuer der Hammerwerke und Hüttenbetriebe eingehüllt. Seine beste Zeit erlebte der Ort Mitte des 17. Jahrhunderts, als bis zu 180 Silbergruben in der näheren Umgebung rentabel waren. Inzwischen sind die meisten von ihnen zwar erschöpft, aber es arbeiten hier immerhin noch mehr als 600 Bergleute. Kilometerlange, von Quecksilber und Schlacke trübe Wassergräben und hohe, zum Teil noch schwelende Abraumhalden prägen die Landschaft. Der Schwefelgeruch scheint hier nie zu verfliegen. Mit geschultem Blick erkennt Klaproth auf dem Weg zur Grube «Georg Wagsfort» die Lichtlöcher von einem Meter Durchmesser am Berghang. Sie spenden den Arbeitern unter Tage frische Luft und Sonnenlicht. Aus vielen Öffnungen quillt Rauch. Er registriert die ordentlich gebauten Grubeneingänge – in manchen steht das Wasser kniehoch – und die von Glücksrittern hastig gegrabenen und dürftig wieder zugeschütteten Erdlöcher.
Im Berliner Labor kommt jetzt die Allzweckwaffe Salpetersäure zum Einsatz. Automatisch hält Klaproth respektvollen Abstand zur weißen Glasflasche mit dem «starken Wasser», aqua fortis, wie die mittelalterlichen Alchemisten die Auflösungskraft der Salpetersäure rühmten. Einen Brocken der matt glänzenden Pechblende übergießt er damit so lange, bis unter roten Dämpfen die schwarze Farbe völlig verschwindet – ein Ereignis, das Klaproth als vollständige Zerlegung seiner Probe wertet. Mit Wasser verdünnt, hat die Auflösung eine «hellweingelbe, ins Grünliche schimmernde Farbe» [Kla:203] angenommen.
Auch an der kuriosen Rathausuhr von Johanngeorgenstadt fährt Klaproths Kutsche vorbei. Bei jedem Viertelstundenschlag springen zwei blecherne Steinböcke aus dem Uhrenkasten und stoßen mit den Hörnern zusammen. Gleichzeitig lüftet ein Bergmann den Schachthut – ein Zylinder ohne Krempe – und klopft mit seinem Stock auf den Boden. Mancher Hausbesitzer klagt hinter vorgehaltener Hand über die Folgen des «Berggeschreys», wie man hier den inzwischen verflüchtigten Silberrausch nennt. Die vielen, kaum mehr überschaubaren Schächte und horizontalen Erzgänge unter der Stadt sollen verantwortlich sein für die ersten feinen Risse in den Hausmauern und die vermeintliche Absenkung der Fundamente – Schäden, die offenbar nur die Besitzer selbst wahrnehmen können. Sie sind Opfer der Furcht, auch bald zu den Verlierern des Berggeschreys zu gehören. Hinter dem Hammerwerk von Wittingsthal, einem Bergflecken von sieben Häusern am Rand von Johanngeorgenstadt, liegen an besonders matschigen Stellen, wo der Breitenbach in...