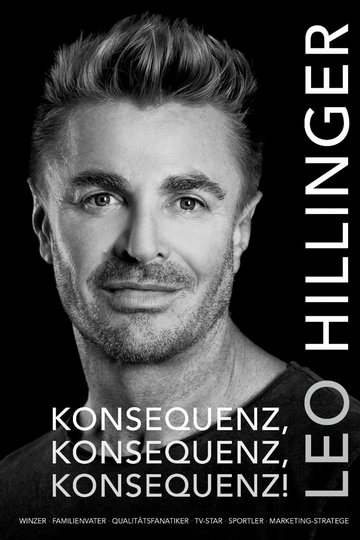1
Der „Schläger“ von Krems
Als ich im Dezember 1967 auf die Welt kam, hatte meine Mutter Stunden zuvor mit einer Gehilfin noch Flaschen etikettiert. Dann wurden die Schmerzen größer und sie fuhr, obwohl alle fünf Minuten die Wehen kamen, selbst nach Eisenstadt. Um halb vier Uhr früh war sie im Krankenhaus und eine halbe Stunde später ich auf der Welt. Die Geburt verlief unkompliziert und reibungslos, und da ich der erste Junge in der Familie Hillinger war, war es ein großes Fest für den Papa.
Meine Großeltern väterlicherseits waren Katharina (geborene Weber) und Martin Hillinger, Wagnermeister und Weinhändler. Meine Eltern waren ebenfalls im Weingeschäft tätig, führten einen gut gehenden Heurigen und hatten bereits eine Tochter, die den Namen der Mutter erhalten hatte, Martha. Eineinhalb Jahre nach mir kam mein Bruder Gerhard auf die Welt und Catharin war eine Nachzüglerin. Von den drei großen Kindern war ich somit das Mittelkind, und die haben es immer ein bisschen schwieriger. Zudem war ich der erste Sohn, trug den Namen meines Vaters, Leopold. Das verpflichtet, und mein Vater ließ es mich sein Leben lang spüren.
Mit dem Blick zurück verklärt sich zuweilen die Vergangenheit und man behält des Öfteren nur die positiven Aspekte in Erinnerung. Diesem Trend kann ich mich nicht verschließen, denn es gab in meiner Kindheit sehr viele schöne Ereignisse. Ich war ein schlaues, gewitztes Kind, wusste mit zweieinhalb Jahren, wie ich mich unter dem Tor des elterlichen Betriebs in Jois in die Gasse hinausstehlen konnte und war meinem jüngeren Bruder Lehrmeister. Ja, wir wuchsen wie Zwillinge auf. Ich spielte Fußball mit Freunden und alle waren wir an Autos, Motorrädern und Maschinen aller Art interessiert.
Kindergarten und Volksschule besuchte ich in Jois, die Hauptschule in Neusiedl am See, und ich muss zugeben, dass ich nicht der allerbeste Schüler war. Meine Legasthenie verbesserte diesen Umstand genauso wenig wie mein Interesse für alles andere als schulische Materien. Alles andere war eben wichtiger und hätte es meine Mutter nicht gegeben, die ein Auge auf meine Hausaufgaben hatte, dann wäre der Tag wie folgt abgelaufen: Schulzeit, dann nach Hause, raus auf die Straße und mit Freunden unterwegs bis zum Abend. Sagen wir so: Ich kämpfte und trickste mich nicht unerfolgreich durch die Schuljahre. Meinen Eltern hatte ein Lehrer die allergrößte Sorge genommen. „Frau Hillinger“, sagte dieser einmal zu meiner Mutter, „ich sage Ihnen mal was: um das Kind brauchen Sie sich keine Sorgen machen.“
Autofahren habe ich schon mit sieben oder acht Jahren gelernt. Zuweilen nahm mich mein Vater mit auf die Jagd, ließ mich fahren – und schimpfte dann lautstark in einem fort, was ich alles falsch machte: zu langsam, zu schnell, zu hoher Gang, zu niedriger Gang. Er brüllte die ganze Zeit, nicht nur mit mir, sondern prinzipiell. Er schlug mich, mit Händen, mit Gegenständen, ins Gesicht, auf den Rücken, überall hin, und er demütigte mich, stellte mich in die Ecke oder ließ mich auf einem Holzscheit knien. Doch war er einerseits hart und brutal, so war er andererseits warmherzig und rücksichtsvoll. Es gab Momente, in denen er mich abgöttisch liebte und in denen er wahnsinnig stolz auf mich war. Bis zum nächsten Schreianfall, der mir, einem anderen seiner Kinder oder seiner Frau galt.
Ich ging noch zur Hauptschule, als mein Vater einmal von einer Weinlieferung nach Hause kam. Der Lastwagen stand noch auf der Gasse und bis zu diesem Tag war nur er in der Lage gewesen, den 5,5-Tonner durch das enge Haustor in den Hof zurückzuschieben. Meine Eltern unterhielten sich gerade in der Küche, als sie ein Motorengeräusch hörten und sahen, wie der Laster sich in Bewegung setzte. „Wer fährt denn da durch das Tor?“, schimpfte mein Vater, war dann aber ganz gerührt, als er mich am Steuer sitzen sah. Ich hatte den Lastwagen rückwärts dorthin eingeparkt, wo er hin sollte und es waren Aktionen wie diese, die das Vertrauen meiner Eltern, oder besser: meiner Mutter, in mich wachsen ließen.
„Leo, du kannst ohnehin Auto fahren. Fahr du“, hatte meine Mutter während meiner Schulzeit einmal zu mir gesagt. Sie befand sich im vorweihnachtlichen Stress mit dem Etikettieren der Flaschen und hatte einfach keine Zeit, meinen Bruder und mich nach Neusiedl in die Schule zu bringen. Ein Skikurs stand an, und so packten wir unsere Ausrüstung zusammen, setzten uns ins Auto und fuhren die fünf, sechs Kilometer in den Nachbarort von Jois. In der Schule angekommen, musste ich natürlich damit prahlen. Ich ließ den Autoschlüssel um meinen Zeigefinger kreisen und erklärte jedem, der das hören wollte, und jedem, dem es egal war, dass ich heute mit dem Auto gekommen sei. Wenig später klingelte bei meiner Mutter das Telefon.
„Hallo, Frau Hillinger, hier spricht der Schuldirektor. Wie geht es Ihnen?“
„Danke, gut. Wie kann ich Ihnen helfen?“
„Hören Sie, ich habe da was gehört. Kann das wahr sein, dass der Leo heute mit dem Auto in die Schule gefahren ist?“ „Ja, das stimmt schon. Ich habe keine Zeit und er kann ja eh fahren.“
„Kommen Sie bitte sofort und holen Sie das Auto ab!“ „Werde schauen, was ich tun kann. Wie gesagt, ich habe eigentlich keine Zeit.“
Mama kam dann doch und stellte die natürliche Ordnung – Eltern fahren, Kinder fahren nicht – wieder her. Klar hätte ich mich nicht an das Steuer setzen sollen und dass meinem kleineren Bruder nicht ganz wohl bei der Sache gewesen war, hatte Mama auch nicht bedacht. Aber es ist alles gut gegangen und klarer Weise hätte ich den Rückweg auch alleine geschafft.
Weil vieles andere eben wichtiger war, habe ich mit 13 schon den ersten Kunden für unseren Wein nach Hause gebracht. Ein Geschäftsmann, der eine VW-Werkstatt leitete und mit dem wir noch heute Kontakt haben, hatte mich gefragt, wo er denn hier guten Wein bekäme. „Einfach dem Schulbus hinterherfahren“, hatte ich geantwortet, „ich bring dich hin“. Und so stand sein Mercedes in unserer Einfahrt und wir hatten jahrelang einen guten Kunden. Es war die Zeit, in der die österreichische Weinszene vom Glykolskandal heftig getroffen worden war – weswegen sich ein burgenländischer Winzer sogar das Leben genommen hatte – und das Vertrauen der Konsumenten war erschüttert, die Umsätze brachen ein. Jeder Kunde zählte. Und leutselig war ich schon immer. Im Heurigen meiner Eltern half ich beim Bedienen mit und verdiente mir mein so Taschengeld. So groß das Vertrauen der Mama in mich war, so schwer hatte ich es, den Vorstellungen meines Vaters gerecht zu werden. Leopold senior hatte nicht wirklich eine fundierte Ausbildung im Wein- und Winzerwesen genossen, und eventuell hat ihn dieser Mangel an theoretischem Wissen verunsichert. Doch er war ein Mann, der sich mit jedem unterhalten konnte, vom Generaldirektor abwärts, und der, wenn er einen Raum betrat, automatisch die Blicke und das Interesse auf sich zog. Er erschien.
Wenn ich heute ein selbstbewusster Mann bin, dann habe ich diesen Charakterzug wohl mehr durch meine Mutter, aber sicher auch von meinem Vater übernommen. Ich glaube an dich, motivierte sie mich. Du bist ein Taugenichts, ein Verlierer, aus dir wird nichts, hat er mir hingegen immer wieder gesagt. Vater hat mich richtiggehend fertiggemacht, und wenn man Negativ-Sätze wie ein Mantra immer und immer wieder hört, dann fängt man auch an, sie selbst zu glauben. (Oder man denkt sich: Dir zeige ich es noch. Ich bin nicht so schlecht, wie du mich machst.) Dass ich in den Jahren, in denen seine Erniedrigungen am schlimmsten waren, auf die Weinbauschulen in Krems und Eisenstadt ging und meine schulischen Leistungen schlecht waren, hat die Sache nicht vereinfacht. Nach Niederösterreich kam ich auf Empfehlung meines Onkels Franz, der Geistlicher ist, aber ich glaube, dass mein Verwandter eine Zeit lang nicht sonderlich erbaut war von dem, was ihm zu Ohren kam. In Krems herrschte zur damaligen Zeit ein erbittertes Konkurrenzdenken zwischen Burgenländern und Niederösterreichern. Klar, zuweilen waren wir Schüler alle auf der gleichen Seite gegen das pädagogische Personal, und es bildeten sich auch Freundschaften, die bis heute halten. Vom Bruder eines Mitschülers, der jetzt im Ruhestand ist, kaufte ich das Weingut in Oggau. Mit anderen Schulkameraden habe ich ebenfalls Kontakt, wir tauschen uns aus und sind füreinander da. Doch es gab auch Raufereien und Schlägereien. Als ich einmal „dreckiger Kroate“ geschimpft wurde, rutschte mir die Hand aus. Himmel, öffne dich: Leo Hillinger, der „Schläger“ von Krems.
Etwa 25.000 bis 30.000 Menschen im Burgenland bekennen sich heute noch als Kroaten. Sie sind in sechs von sieben burgenländischen Bezirken beheimatet, stellen aber in keinem die Mehrheitsbevölkerung. Die größte Zahl Kroatisch sprechender Burgenländer lebt in den Bezirken Eisenstadt-Umgebung und Oberpullendorf. Aber ich war keiner von ihnen – und wenn doch: Hätte man mich tatsächlich beleidigen...