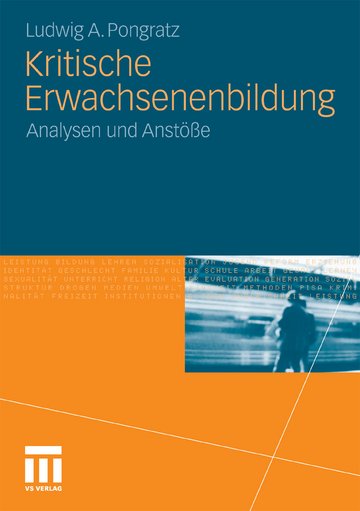| Inhalt | 5 |
| Vorwort | 6 |
| 1. Kritische Erwachsenenbildung: ein Interview | 8 |
| Wenn ich an die „Bildung Erwachsener“ denke, dann... | 8 |
| Worin liegt das Spezifische Ihres Zugangs zur Erwachsenenpädagogik so-wie insbesondere Ihrer Forschung und Theorie? | 8 |
| Welchen besonderen Chancen (um nicht zu sagen: „Herausforderungen“) sehen sich Erwachsenenbildung und Erwachsenenpädagogik derzeit gegenüber? | 9 |
| Welche Gefahren bestehen für die Erwachsenenbildung und ihre Wissen-schaft? | 10 |
| Welches sollten die drei prioritären Fragestellungen einer zukünftigen Er-wachsenenbildungsforschung sein? | 10 |
| 2. Aufstörende Erbschaft: eine Erinnerung | 12 |
| 2.1 Rückblende: Frühe Szenen | 12 |
| 2.2 Erwachsenenbildung im 19. und 20. Jahrhundert: eine historische Skizze | 14 |
| 2.3 Erwachsenenbildung in den 80er Jahren: Die ‚Qualifizierungsoffensive‘ | 19 |
| 2.4 Erwachsenenbildung vor und nach der Jahrtausendwende: der Kompetenzdiskurs | 21 |
| 2.5 Kritische Erwachsenenbildung: Urteilskraft – Einbildungskraft – Widerstandskraft | 25 |
| 3. Kritisches Verhalten: eine Vergegenwärtigung | 28 |
| 3.1 Krise und Kritik | 28 |
| 3.1.1 Kant: Erkenntniskritik als frühe Form Kritischer Theorie | 28 |
| 3.1.2 Marx: Der Umschlag von Erkenntnisin Gesellschaftskritik | 29 |
| 3.1.3 Horkheimer: Kritische Theorie als Zeitdiagnose | 32 |
| 3.2 Kritische Theorie und Erwachsenenbildung | 33 |
| 3.2.1 Erwachsenpädagogische Theoriekonjunkturen | 33 |
| 3.2.2 Der Aufschwung Kritischer Theorie in der Erwachsenenbildung | 35 |
| 3.2.3 Der Abschwung Kritischer Theorie in der Erwachsenenbildung | 37 |
| 3.2.4 Die Permanenz von Krise und Kritik | 39 |
| 3.3 Erwachsenenbildung als ‚Krisenwissenschaft‘ | 42 |
| 4. Konstruktivistische Erwachsenenbildung: eine Kritik | 45 |
| 4.1 Radikaler Konstruktivismus: Erkenntnistheorie als Zauberkunststück | 46 |
| 4.1.1 Das Verschwinden(-lassen) der Wirklichkeit | 48 |
| 4.1.2 Das Erscheinen(-lassen) des Bewusstseins | 51 |
| 4.1.3 Das (Über-)Blenden der Beobachter | 54 |
| 4.2 Pädagogischer Konstruktivismus: Die Banalisierung der Tricks | 56 |
| 4.2.1 Fiktionalität, Perspektivität, Subjektivität: Von der Nichterkennbarkeit der Welt zum interpretativen Paradigma | 58 |
| 4.2.2 Anschlussfähigkeit, Viabilität, Passung: Von der Relativität der Wahrheit zur konsensuellen Vernunft | 62 |
| 4.2.3 Operationale Geschlossenheit, Strukturdeterminiertheit, Strukturelle Kopplung: Von der Nichtplanbarkeit von Systemveränderungen zurInszenierung von Lernumwelten | 66 |
| 4.3 Ideologieimport: Der (neoliberale) Tiger im (konstruktivistischen) Tank | 70 |
| 5. Polemische Spitzen: eine Erwiderung | 73 |
| 5.1 Die erkenntnistheoretische Ebene | 75 |
| 5.2 Die Ebene der Intervention | 80 |
| 5.3 Zwischenresümee | 82 |
| 5.4 Die Ebene der Normativität | 83 |
| 6. Verhinderte Erfahrung: ein Problemaufriss | 86 |
| 6.1 Erfahrung als ‚Hirngespinst‘: Aspekte des neurobiologischen Erfahrungsbegriffs | 86 |
| 6.1.1 Erfahrung als autopoietische Selbstschöpfung | 86 |
| 6.1.2 Die Vergegenständlichung des Subjekts | 89 |
| 6.2 Erfahrung als Vermittlung: Aspekte des dialektischen Erfahrungsbegriffs | 91 |
| 6.2.1 Die Intentionalität des erfahrenden Bewusstseins | 91 |
| 6.2.2 Neurodidaktische Kurzschlüsse | 92 |
| 6.3 Aufstieg der Kontrollgesellschaft: Das Gehirn als ‚unternehmerisches Selbst‘ | 94 |
| 6.4 Erfahrung im gesellschaftlichen Kontext: Aspekte eines kritischen Erfahrungsbegriffs | 96 |
| 6.4.1 Strukturen des Alltagsbewusstseins | 97 |
| 6.4.2 Erfahrungshorizonte im Umbruch | 99 |
| 6.5 Kritische Erwachsenenbildung: die Erfahrung verhinderter Erfahrung | 101 |
| 7. Verkaufte Bildung: ein Einspruch | 105 |
| 7. 1 Universitätsreform und Optimierungskalkül: Zur Ökonomisierung des Bildungssektors | 106 |
| 7.2 Halbbildung und Marketing-Orientierung: Vom Bildungsbürger zum Selbstvermarkter | 108 |
| 7.3 Realitätsverlust und Pseudo-Befreiung: Marketing als Ideologie | 111 |
| 7.4 Bruchlinien und Widerspruchspotentiale: Bildung als Überschreitung | 114 |
| 8. Kontrolliert autonom: ein Lagebericht | 119 |
| 8.1 Freiheits-Rhetorik: Entfesselung, Entgrenzung, Deregulierung | 119 |
| 8.2 Kontrollgesellschaft: Modulation, Chiffre, Marketing | 120 |
| 8.2.1 Die Krise der Disziplinargesellschaft | 120 |
| 8.2.2 Der Aufstieg der Kontrollgesellschaft | 124 |
| 8.3 Gouvernementalität: Disziplinarprozeduren, (Selbst-)Führungstechniken, Subjektivierungspraktiken | 126 |
| 8.4 Bildungsreform: Kommerzialisierung, Flexibilisierung, Qualitätsregime | 128 |
| 8.5 Kontrolliert autonom: Widerspruchslagen, Bruchlinien, Diskontinuitäten | 133 |
| 8.6 Kritische Perspektiven: erfahren, (sich) aussetzen, widerstehen | 135 |
| 9. Radikaler Systemumbau: eine Skizze | 137 |
| 9.1 Erwachsenenbildung im Spiegel von Gutachten und Expertisen | 137 |
| 9.2 Radikaler Systemumbau: „Bildung neu denken!“ | 140 |
| 9.2.1 Krisenszenarien | 141 |
| 9.2.2 Die Quadratur des Kreises | 142 |
| 9.3 Dimensionen der Systemrevision | 143 |
| 9.3.1 Sozioökonomische Herausforderungen | 143 |
| 9.3.2 Lernorganisatorische Konsequenzen | 145 |
| 9.3.3 Curriculare Anpassungsprozesse | 147 |
| 9.3.4 Wissenschaftstheoretische Grundlagen | 148 |
| 9.4 Neue Widerspruchslagen | 149 |
| 10. Lernen lebenslänglich: eine Absage | 152 |
| 10.1 Europäische Sprachregelungen | 152 |
| 10.2 Lebenslang lernen dürfen | 154 |
| 10.3 Lebenslang lernen können | 156 |
| 10.4 Lebenslang lernen sollen | 157 |
| 10.5 Lebenslang lernen müssen | 158 |
| 10.6 Widerstand gegen den lebenslangen Lernzwang? | 163 |
| Literatur | 166 |
| Textnachweise | 179 |