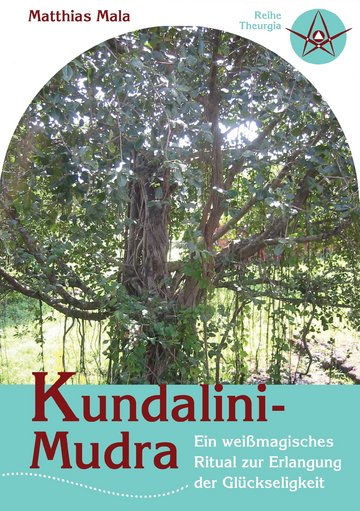1. TEIL – DER INNERE HORIZONT
SCHANGRI-LA, UNSER STREBEN NACH GLÜCKSELIGKEIT
In seinem klassischen utopischen Roman »Der verlorene Horizont« schilderte James Hilton Schangri-La als eine ideale Gesellschaft, die auf allumfassender Weisheit gründet. Der Protagonist dieses Romans, Conway, entwickelt, nachdem ihn ein Missgeschick in dieses Traumland verschlagen hatte, ein tiefes Verständnis für jene grundlegende Weisheit. Dennoch verlässt er Schangri-La. Als er schließlich ermessen kann, was er dadurch aufgegeben hat, nimmt er jede erdenkliche Mühe auf sich, um ins »Tal aller heiligen Zeiten« zurückzukehren. Ob ihm diese Rückkehr zu guter Letzt gelingt, lässt der Autor allerdings offen.
In jedem von uns scheint die Vision eines Schangri-La zu schlummern, sie erblüht in unserem Herzen als unbestimmtes Sehnen nach Glückseligkeit. Unser Wunsch, diesem Sehnen auch Erfüllung zu gewähren, lenkt unsere Schritte. Viele suchen das Glück im Äußeren und eilen dabei rastlos von einem Ort zum anderen oder stürzen sich von einem scheinbar beglückenden Ereignis ins nächste. Das wahre Glück aber finden sie so nur in den seltensten Fällen. Meist rührt die erfahrene Freude nur an der Oberfläche, wird allzu schnell alltäglich und verblasst alsbald zur angenehmen Erinnerung. Andere, und nicht gerade wenige wollen sich vom äußeren Schein nicht blenden lassen und suchen deshalb ihr Schangri-La als Hort der Freude statt im Äußeren in sich selbst. Auch sie nehmen hierbei jede erdenkliche Mühe auf sich, um dieses Ziel in sich zu verwirklichen. Gleichwohl bleiben auch hier die meisten ewig Suchende.
Doch was treibt uns eigentlich zur Suche nach Glückseligkeit, und was ist es genau, nach dem wir suchen? Nun, prinzipiell können wir nur nach dem suchen, was wir kennen, oder von dem wir zumindest eine gewisse Vorstellung entwickelt haben. Unsere Vorstellung vom Glück leitet sich daher von den uns mehr oder weniger widerfahrenen Glücksmomenten ab. Als Augenblicke wahren Glücks empfinden wir hauptsächlich solche Situationen, in denen wir scheinbar über uns hinaustreten und uns in harmonischer Weise mit unserer Welt vereinen. Es sind dies meist jene Augenblicke intensiver Gegenwärtigkeit, von denen wir später sagen, dass unser Herz weit wurde und überquoll vor Glück. In diesen Momenten erleben wir uns in einer seltsamen Weise selbstvergessen und doch von außergewöhnlicher Präsenz. In unserer Erinnerung behalten wir solcherart empfundene Seligkeit als Phasen durchdringender Lebenskraft und unerschöpflicher Lebensfreude. Zugleich verbinden wir dieses Erleben mit dem jeweiligen inneren oder äußeren Geschehen: sei es etwa mit dem Anblick eines prächtigen Baumes in seinem Herbstkleid oder einer Weile inniger Zweisamkeit mit einem geliebten Menschen oder mit der stillen Freude über beglückende Einsamkeit.
In unserem Streben nach Glückseligkeit lassen wir uns insofern von unseren Erinnerungen und Vorstellungen leiten und suchen das Glück in der Wiederholung des Erfahrenen oder in der Konstruktion des Erwünschten. So schaffen wir uns dann entsprechende Gegebenheiten, die wir auch durchaus freudvoll durchleben, doch die kostbaren Gefühle allumfassenden Glücks bleiben uns dennoch in der Regel versagt: Wir sind zwar zufrieden, aber nicht wirklich glücklich!
Erinnertes Glücksempfinden führt uns folglich auch nicht zur Glückseligkeit. Es treibt uns zwar auf unserer Suche an, doch kommen wir mit zunehmender Lebenserfahrung zu dem Schluss, dass wir Glückseligkeit nicht erstreben können, sondern sie etwas ist, was uns nur widerfahren kann. Trotzdem setzen wir ihr weiter unermüdlich nach. Was ist es also, das uns so unaufhörlich treibt, diesen ersehnten Zustand zu erlangen?
Selbst wenn wir noch nie von der Glückseligkeit gekostet hätten, besäßen wir zumindest so viel Ahnung von ihr, dass wir klar erkennen könnten, wann wir in ihr verweilen und wann nicht. Von daher könnte man mutmaßen, dass unser Streben nach Glückseligkeit ein uns angeborener Trieb ist. Doch wäre dem so, müssten wir uns fragen, warum wir ihn im eigentlichen Sinne nicht befriedigen können − schließlich widerfährt uns Glückseligkeit nur − und warum wir darob so wenig darben. Das heißt, die Sehnsucht nach Glückseligkeit liegt zwar einerseits in unserer Natur, andererseits sind wir nicht zwingend unglücklich, wenn sie ungesättigt bleibt. Widerfährt uns jedoch das erstrebte Glücksgefühl, empfinden wir es als die restlose Erfüllung unseres Seins und erleben uns in ungeahnter Weise als heil; wir empfinden uns nicht nur glückselig, sondern auch gottselig. In eben dieser möglichen Gottseligkeit aber liegt die wirklich treibende Kraft. Sie weist in ihrem unbestimmten Drängen auf einen Urgrund hin, dem sie entspringt und zu dessen Rückbindung es sie verlangt.
Das wesentliche Moment bei solchem Glücksempfinden ist das Gefühl der Weitung, in der wir unsere Welt in unmittelbarer Weise wahrnehmen, so als gäbe es keine Trennung zum anderen, keine Spaltung zwischen dem Du und dem Ich. Es sind Augenblicke der Ein-Sicht, in denen wir die Schöpfung ohne Worte zu verstehen scheinen. Von daher entspricht unsere Sehnsucht nach Glückseligkeit unserem unausgesprochenen Verlangen, am Unermesslichen teilhaben zu wollen, uns gleichsam mit ihm zu vereinigen. Andererseits erleben wir die Trennung und Lösung aus der Allverbundenheit als beständige Gegebenheit: dort das Unermessliche und hier wir in unserer Ich-bewussten Begrenztheit. Da es aber die Eigenart des Begrenzten ist, begrenzt zu sein und zu bleiben, kann es niemals im Unermesslichen aufgehen. Aber dennoch widerfahren uns Momente, in denen gerade dies zu geschehen scheint.
Betrachten wir das Geschehen vollkommenen Glücksempfindens genauer, so fällt uns die Ich-Ferne auf, aus der heraus wir es beobachten und daran teilhaben. Es mutet uns an, als kommuniziere ein anderes Selbst in uns mit dem Göttlichen. Spüren wir jedoch diesem »anderen Selbst« in uns nach, so bemerken wir, wie es sich unserem Bemühen, es zu fassen und zu bestimmen, auf zweifache Weise entzieht: Nähern wir uns ihm in bedachter, rationaler Weise, mögen wir es zwar mit Worten immer näher bestimmend einkreisen, gelangen aber letztlich nur an jene unüberwindliche Schwelle, hinter der wir es mit Gewissheit vermuten, allerdings nicht weiter fassen können. Der Raum hinter dieser Schwelle erscheint uns still und leer wie das Auge eines Taifun. In ihm steckt zwar die ganze, das Geschehen bindende Kraft, gleichwohl bleibt sie jedwelcher Erfahrung verborgen. Überwinden wir andererseits diese Schwelle, werden wir dieser Kraft nur so weit gewahr, als wir uns auch in ihr verlieren. Sie widerfährt uns dann als unverfälschte Ursprünglichkeit, als Strom reinsten Lebens, der uns mit fortreißt und in dem wir uns gänzlich lösen. Treiben wir schließlich wie Strandgut zurück an sein Gestade, finden wir zwar wieder zu uns selbst, doch zum Widerfahrenen hatten wir keine Distanz, die wir, um Erfahrene zu sein, notwendigerweise gebraucht hätten. Unser Eifer, uns unser anderes oder innerstes Selbst begreifbar zu machen, läuft somit leer. Wir bleiben in dieser Hinsicht sprachlos. Gleichwohl hindert uns das nicht, das Unaussprechliche mit Worten fixieren zu wollen. Wobei wir uns dann fatalerweise in Worte verhaften. So sprechen wir vom »Höheren Selbst« oder vom »göttlichen Funken« in uns und hinterlegen diese Begriffe entweder philosophisch oder empirisch. Auf diese Weise bleiben wir jedoch weiterhin in dem uns Bekannten gefangen und entfremden uns selbst wieder dem in uns erahnten Ursprünglichen.
Spätestens an diesem Punkt müsste nun strenggenommen der Satz: »Wovon man nicht reden kann, darüber sollte man schweigen«, greifen. Doch beließen wir es andererseits bei dieser Feststellung, würden wir zugleich etwas verschweigen: Denn im Prozess der Annäherung an das Ursprüngliche, das wir als höchste Glückseligkeit empfinden, erfahren wir uns soweit selbst, dass uns unsere individuelle Ferne als auch unsere wesenhafte Nähe zum spirituellen Geschehen offenbar wird. Mittels unserer Ich-zentrierten Erkenntnisfähigkeit können wir die himmlische Glückseligkeit nicht erfassen, empfinden sie aber zugleich unmittelbar. Folglich muss es für diese unmittelbare Wahrnehmung in uns eine Entsprechung geben. Und diese Entsprechung muss dazu von gleicher Art sein, ansonsten wäre jene Kommunikation mit dem Ursprünglichen nicht möglich. Begriffe wie »Höheres Selbst« oder »göttlicher Funken«, mögen diese Entsprechung umschreiben. Jedoch verschleiern sie sie eher, als dass sie sie benennen. Die in uns wirkende Entsprechung zum Ursprünglichen wird hierbei nur mystifiziert und erscheint uns dementsprechend fern und entrückt.
Versuchen wir deshalb, uns ihr in anderer Manier zu nähern: Uns widerfahrene Glückseligkeit entspricht, wie gesagt, der Vereinigung zweier gleichartiger Kräfte, nämlich dem allumfassenden Ursprünglichen um uns und seiner wirkenden Entsprechung in uns. Es ist diese wirkende Kraft der Entsprechung in uns, die wir erahnen und die uns, unserer Ahnung folgend, nach Glückseligkeit streben lässt. Wollen wir nun diese Kraft, anstatt sie zu benennen, zunächst in uns orten, so werden wir auf eine seltsame Weise orientierungslos. Wir empfinden uns als weit und voll von Widerhall, ohne dass wir auf den Quell dieser Wahrnehmung stoßen können. Als ihren Ursprung vermuten wir zwar richtigerweise die uns beseelende Kraft, doch im Versuch, sie zu bestimmen, verlieren wir uns erneut. Demgemäß bleibt es beim fassungslosen Erleben einer anderen Dimension.
Trotz alledem gewinnen wir durch dieses Erleben die Erkenntnis, dass die in uns wirkende...