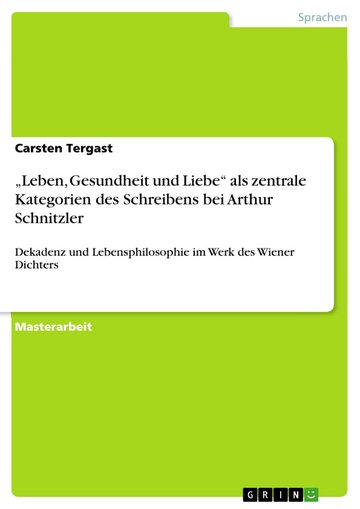1. Einleitung
Das Werk Arthur Schnitzlers ist - gemessen an den Schriften zeitgenössischer Autoren – relativ leicht lesbar und weist auf den ersten Blick keine nennenswerten hermetischen Textstrukturen auf. Dies hat auch in der literaturwissenschaftlichen Forschung verschiedentlich dazu verführt, die Texte auf einer eher oberflächlichen Ebene zu rezipieren und ihre Gedankenwelt allzuschnell in scheinbar passende Kategorien einzuordnen. So gelangte man beispielsweise zu dem Eindruck, Schnitzlers Werk bliebe „bei Deskription und nüchterner Analyse ohne Wertung und Stellungnahme.“[1] Darüber hinaus blieb lange Zeit die Wertung Hermann Bahrs wirkmächtig, der über Schnitzler schrieb:
Er ist ein großer Virtuose, aber einer kleinen Note. [...] Schnitzler darf nicht verschwenden. Er muß sparen. Er hat wenig. So will er es denn mit der zärtlichsten Sorge, mit erfinderischer Mühe, mit geduldigem Geize schleifen, bis das Geringe durch seine unermüdlichen Künste Adel und Würde verdient. [...] Er weiß immer nur einen einzigen Menschen, ja nur ein einziges Gefühl zu gestalten. [...] Der Mensch des Schnitzler ist der österreichische Lebemann. Nicht der große Viveur, der international ist und dem Pariser Muster folgt, sondern die wienerisch bürgerliche Ausgabe zu fünfhundert Gulden monatlich, mit dem Gefolge jener gemütlichen und lieben Weiblichkeit, die auf dem Weg von der Grisette zur Cocotte ist, nicht mehr das Erste, und das Zweite noch nicht. [...] Nur darf er freilich, weil sein Stoff ein weltlicher, von der Fläche der Zeit ist, Wirkungen in die Tiefe der Gefühle nicht hoffen, und von seinem feinem, aber künstlerischen Geiste mag das Wort des Voltaire von Marivaux gelten: Il sait tous les sentiers du coeur, il n’en connaît pas le grand chemin.[2]
Eine einseitige Festlegung Schnitzlers auf die immer gleichen Themen und Motive von Eros und Thanatos hat sich jedoch als wenig sinnvoll erwiesen, zumal dabei oft zu wenig Gewicht auf die mannigfaltigen Diskurse der Zeit gelegt wurde.
In dieser Arbeit soll eine differenziertere Sichtweise versucht werden. Es wird prinzipiell davon ausgegangen, daß die dominanten theoretischen Diskurse einer Epoche immer auch in literarische Texte einfließen und deren Aussagekraft somit wesentlich beeinflussen. Die Interpretation orientiert sich damit im wesentlichen an dem, was Michael Titzmann mehrfach formuliert hat, so etwa 1991:
Die gegebenen Ereignisse, die Texte, sind nun zwar in der Interpretation als komplexe semantische Systeme analysierbar, aber sie sind keine isolierten Systeme: Sie sind Systeme, die in vielfältigen Relationen zu einer (ebenfalls sehr komplexen) Umwelt, d.h. zu einer Menge anderer Systeme, stehen; diese anderen Systeme können ebenfalls durch vielfältige Relationen untereinander korreliert sein.[3]
Diese Sichtweise verweist auf system- sowie diskurstheoretische Modelle. Der Text wird nicht mehr als eindeutig in seinem vom Autor gegebenen Sinn zu erfassende Einheit gesehen, sondern muß als Produkt verschiedenster Quellen verstanden werden:
In solchem Sinn kann man von der Pluralität eines Textes sprechen, der stets aus Aussagen verschiedener Diskurse besteht und allein in seiner Existenz immer schon auf Intertextualität bzw. auf Interdiskursivität verweist.[4]
Zur Zeit der Jahrhundertwende, die in der Forschung immer wieder in die unterschiedlichsten Strömungen aufgeteilt wird und sich einem einheitlichen Epochenbegriff entzieht, drehte sich die theoretische Auseinandersetzung mit der eigenen Zeit sehr stark um einen bestimmten Begriff, nämlich den des „Lebens“.[5] Man hat dafür folgerichtig die Bezeichnung „Lebensphilosophie“ gefunden, als deren Wegbereiter Friedrich Schlegel, Arthur Schopenhauer und der in Deutschland weitgehend unbekannte Jean-Marie Guyau gelten. Ihre wesentliche theoretische Grundlegung erfuhr diese Richtung in der Folge bei Friedrich Nietzsche, Wilhelm Dilthey und Henri Bergson, während ihre volle Ausprägung sich schließlich bei Denkern wie Georg Simmel, Ludwig Klages, Theodor Lessing oder José Ortega y Gasset vollzog.[6] In dieser Arbeit werden zusätzlich zu Schopenhauer, Nietzsche und Dilthey einige Grundpositionen Sören Kierkegaards herangezogen, die den Wert des Lebens auf bestimmte Weise reflektieren. Man kann diese Reflexion über „Leben“ allgemein als einen der zentralen Diskurse der frühen Moderne auffassen.
Explizite Äußerungen Schnitzlers zum Thema Lebensphilosophie lassen sich kaum finden, weder in den Tagebüchern noch in den Briefen oder den theoretischen Schriften. Auch seine Figuren sind nie bloße Sprachrohre für diese Denkweise der Zeit. Das ist allerdings auch gar nicht nötig, um Schnitzlers Werk in diesen Zusammenhang einzuordnen:
Um eben dieses zu sein [kreativ, innovativ, originell], muß er [der Text] entweder gegebenem Wissen widersprechen oder gegebenes Wissen zu erweitern suchen. [...] (Mehr oder weniger) Vollständig kann eine Interpretation also nur bei Einbeziehung des kulturellen Wissens sein.[7]
Die Strömung der Lebensphilosophie wird in dieser Arbeit im Sinne Titzmanns als „kulturelles Wissen“ verstanden und zwar als „gruppenspezifisches Wissen“[8], welches zu den „Prämissen der Produktion, Distribution, Rezeption von Texten“[9] gehört. Daher soll hier auch gezeigt werden, daß Arthur Schnitzlers Werk sehr wohl den sozialen und historischen Hintergrund seiner Zeit reflektiert. Gerade die Werke der Hoch- und Spätphase ab ca. 1910 sind hier zu nennen und werden in dieser Arbeit auch unter diesem Aspekt betrachtet.
Darüber hinaus mag die mangelnde explizite Nennung eines Bezugs zum zeitgenössischen kulturellen Hintergrund in dem generellen Mißtrauen Schnitzlers gegenüber philosophischen Weltentwürfen begründet sein, die ihm oft als zu unpräzise und verschwommen erschienen:
‚Im Dunkeln ist gut munkeln;‘ – dieser Spruch läßt sich sehr gut auf das philosophische Gebiet übertragen; in Klarheit und Licht ist nur den wenigsten wohl und sie flüchten sich gerne dahin, wo es keine Kontrolle gibt; also dorthin, wo das einzige menschliche Verständigungsmittel, das Wort, seine Geltung verliert, vielmehr von Augenblick zu Augenblick seinen Kurs und seine Bedeutung wechselt. (BSB, 128)
Schnitzler hat sich nie offen als Anhänger irgendeiner philosophischen oder literarischen Zeitströmung zu erkennen gegeben, seine Werke sollten nicht dazu dienen, bestimmte Theorien zu beweisen: „he distrusted philosophical systems and held them to the beautiful, artistic creations.“[10] Das Schubladendenken vieler Kritiker war ihm stark zuwider. Dies ist ein Hauptgrund warum Schnitzler selbst sich einer Tätigkeit als Feuilletonist immer verweigert hat, und zwar im Gegensatz zu den meisten seiner Schriftstellerkollegen. Auch der verhältnismäßig geringe Umfang des theoretisch-essayistischen Werkes hängt mit dem Bestreben zusammen, das literarische Werk für sich sprechen zu lassen.[11] Allerdings eignen sich die Aphorismen oft, um Anhaltspunkte für Schnitzlers grundsätzliche Positionen zu finden:
Die Aphorismen sind ein wichtiger Anhaltspunkt, wenn man eine häufig für zweitrangig gehaltene Seite an Schnitzler, nämlich die philosophische oder besser: ethische, verstehen und einordnen möchte. [...] Letztlich kann man bei Schnitzler nicht so sehr von einer im engeren Sinne philosophischen Orientierung sprechen als vielmehr von einer rigoros persönlichen Weltanschauung, die uns zeigt, daß sein Werk eine ethische Dimension hat und uns eine Vorstellung sowohl von seiner Sicht auf Leben und Kunst vermittelt als auch von der Tiefe seines gesellschaftlichen und menschlichen Anliegens.[12]
Dennoch kann man auch an vielen Stellen des erzählerischen und dramatischen Werkes des Wieners festmachen, wie einflußreich der Begriff des Lebens, der gerade in der Philosophie der Jahrhundertwende eine tragende Rolle spielt, für die Handlungsweise seiner Figuren ist. Er erfährt im Werk Schnitzlers eine eigene Deutung. Seine große Wichtigkeit zeigt sich aber beispielsweise in seiner Einordnung unter die drei „Absoluten Güter“, und zwar vor „Gesundheit“ und „Liebe“ an erster Stelle (vgl. EV, 30).
Auch ist Schnitzler selbst sich darüber im klaren gewesen, daß ein Autor nie die letztgültige Deutung seiner eigenen Schriften kennen kann, wie aus dem Vorwort zu seiner Aphorismensammlung deutlich wird:
Auch zu Beiläufigkeiten bekenne ich mich, deren eigentlicher Sinn dem Leser zuweilen deutlicher werden könnte, als er mir selbst immer geworden ist. (BSB, 9)
Man hat das Werk Arthur Schnitzlers oft sehr einseitig mit der zeitgenössischen Dekadenzliteratur in Verbindung gebracht. Meist wurde dieser Begriff dabei zusätzlich ausschließlich negativ...